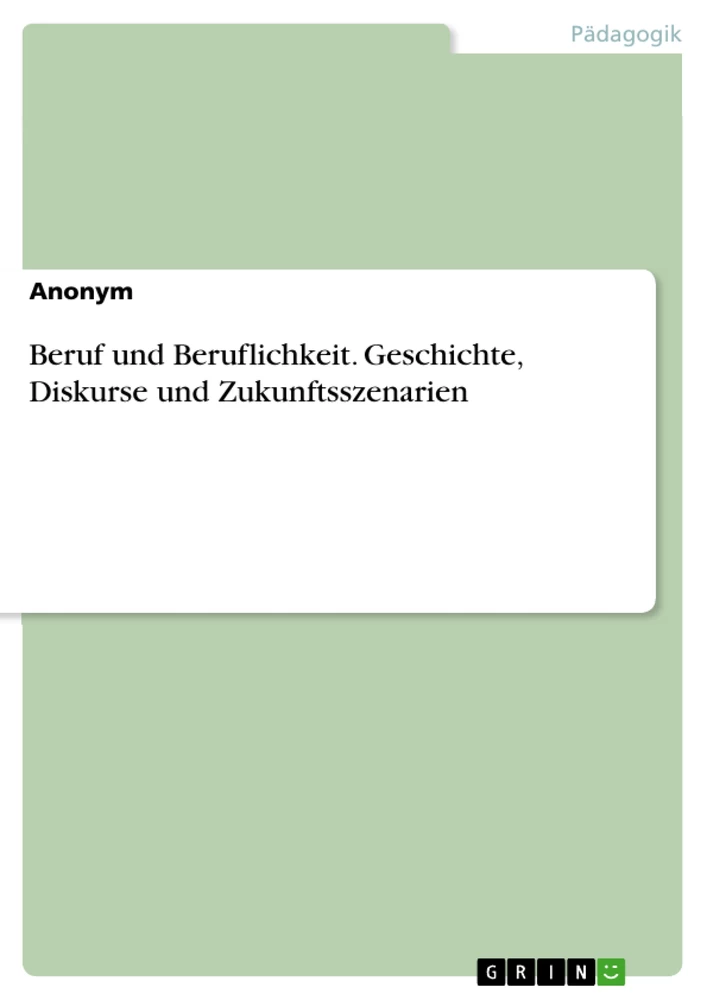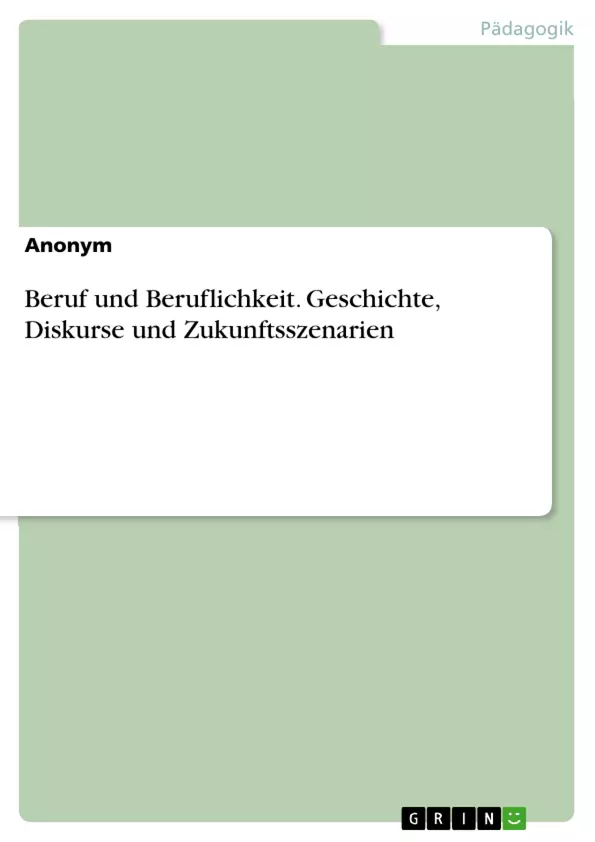Es handelt sich bei dieser veröffentlichten Arbeit um ein Portfolio, welches aus drei Textrezensionen, einem Ideenpapier und einer schriftlichen Ausarbeitung zu den Hürden, Abläufen und Verfahren der Integration von Migrant*innen mit und ohne beruflicher Qualifikation in das deutsche Berufsbildungssystem besteht.
Das Thema, welches vortragen wird, sind die „Studien und Prognosen zur Weiterentwicklung von Ausbildungs- und Fortbildungsberufen im Kontext der Migration“. Die Problemstellung befasst sich hierbei im genaueren mit dem Kontext und der Wirkung von Migration auf die Weiterentwicklung und die Gestaltung des Berufsmodells bzw. im speziellen auf die Ausbildungs- und Fortbildungsberufe, mit dem Hintergrund der Universalisierung qualifikatorischer Orientierungen, aber auch welche Wirkung diese auf Migrant*innen, sowie Flüchtlinge und die Migration in Deutschland als solches hat.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird im Hauptteil der Schwerpunkt daraufgelegt, Hürden, Abläufe und Verfahren der Integration von Migrant*innen mit und ohne beruflicher Qualifikation in das deutsche Berufsbildungssystem kurz darzustellen und die unterschiedlichen Herausforderungen und Chancen aufzuzeigen, sowie die Wirkung von Migration auf das Berufsmodell zu beschreiben und darzulegen. Da es für die vorliegende Arbeit den Rahmen übersteigen würden, wird auf die einzelnen Aspekte nur in komprimierter Form eingegangen. Im Fazit werden die wesentlichen Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Textrezensionen
- 1. Sitzung
- 2. Sitzung
- 3. Sitzung
- Ideenpapier „Berufliche Aus- und Fortbildung im Kontext von Migration“
- Schriftliche Ausarbeitung
- Einleitung
- Hauptteil
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Selbstverständnis der Berufs- und Wirtschaftspädagogik im Kontext von Beruf und Beruflichkeit. Sie analysiert historische Diskurse, aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven. Die Arbeit basiert auf Textrezensionen, einem Ideenpapier und einer schriftlichen Ausarbeitung.
- Historische Entwicklung des Berufsverständnisses
- Wandel von Beruf und Beruflichkeit im 20. und 21. Jahrhundert
- Der Einfluss von ökonomischen, sozialen und technologischen Veränderungen auf die Berufsbildung
- Herausforderungen für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik
- Zukunftsperspektiven der beruflichen Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Textrezensionen: Die Textrezensionen analysieren zwei Texte. Der erste Text von Büchter (2021) befasst sich mit der historischen Entwicklung und den Diskursen rund um die Begriffe „Beruf“ und „Beruflichkeit“. Er beleuchtet den Wandel des Berufsverständnisses im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und untersucht die Funktionen des Berufs im Beschäftigungs- und Bildungssystem. Der Fokus liegt auf der Flexibilisierung von Berufen, dem Rückgang der Berufsanzahl und dem Einfluss der Digitalisierung. Der zweite Text von Walter und Sattel (2020) thematisiert die Herausforderungen für das Berufsbildungssystem im Angesicht des Wandels von Arbeits- und Beschäftigungsformen. Er hinterfragt das traditionelle Berufsverständnis und diskutiert die Notwendigkeit einer Anpassung des Systems an die neuen Realitäten. Die Autoren untersuchen die Arbeitsmarktsegmentation und betrachten verschiedene Perspektiven für die Zukunft der beruflichen Bildung.
Ideenpapier „Berufliche Aus- und Fortbildung im Kontext von Migration“: (Zusammenfassung fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht erstellt werden.)
Schriftliche Ausarbeitung: Die schriftliche Ausarbeitung bietet eine umfassende Betrachtung der Thematik. Die Einleitung führt in die Problematik ein. Der Hauptteil vertieft die Analyse der historischen Entwicklung, der aktuellen Herausforderungen und der Zukunftsperspektiven, wobei die Erkenntnisse aus den Textrezensionen und dem Ideenpapier integriert werden. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und bietet einen Ausblick.
Schlüsselwörter
Beruf, Beruflichkeit, Berufsbildung, Wirtschaftspädagogik, Arbeitsmarkt, Digitalisierung, Wandel, Zukunftsperspektiven, Migration, Berufskonstruktion, Beschäftigungssystem.
Häufig gestellte Fragen zu: Unbekannter Texttitel (Inhaltsverzeichnis, Zusammenfassung etc.)
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Selbstverständnis der Berufs- und Wirtschaftspädagogik im Kontext von Beruf und Beruflichkeit. Sie analysiert historische Diskurse, aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der beruflichen Bildung, basierend auf Textrezensionen, einem Ideenpapier und einer schriftlichen Ausarbeitung.
Welche Themen werden in den Textrezensionen behandelt?
Die Textrezensionen analysieren zwei Texte. Der erste Text (Büchter, 2021) befasst sich mit der historischen Entwicklung und den Diskursen rund um „Beruf“ und „Beruflichkeit“, beleuchtet den Wandel des Berufsverständnisses und den Einfluss der Digitalisierung. Der zweite Text (Walter & Sattel, 2020) thematisiert Herausforderungen für das Berufsbildungssystem aufgrund des Wandels von Arbeits- und Beschäftigungsformen, die Arbeitsmarktsegmentation und Perspektiven für die Zukunft der beruflichen Bildung.
Was ist der Inhalt des Ideenpapiers?
Eine Zusammenfassung des Ideenpapiers „Berufliche Aus- und Fortbildung im Kontext von Migration“ fehlt im Ausgangstext.
Wie ist die schriftliche Ausarbeitung aufgebaut?
Die schriftliche Ausarbeitung umfasst Einleitung, Hauptteil und Fazit. Der Hauptteil vertieft die Analyse der historischen Entwicklung, der aktuellen Herausforderungen und Zukunftsperspektiven, basierend auf den Erkenntnissen aus den Textrezensionen und dem Ideenpapier. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Beruf, Beruflichkeit, Berufsbildung, Wirtschaftspädagogik, Arbeitsmarkt, Digitalisierung, Wandel, Zukunftsperspektiven, Migration, Berufskonstruktion, Beschäftigungssystem.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Selbstverständnis der Berufs- und Wirtschaftspädagogik im Kontext von Beruf und Beruflichkeit, indem sie historische Entwicklungen, aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven untersucht.
Welche Aspekte der beruflichen Bildung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die historische Entwicklung des Berufsverständnisses, den Wandel von Beruf und Beruflichkeit im 20. und 21. Jahrhundert, den Einfluss ökonomischer, sozialer und technologischer Veränderungen auf die Berufsbildung, Herausforderungen für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik und Zukunftsperspektiven der beruflichen Bildung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Beruf und Beruflichkeit. Geschichte, Diskurse und Zukunftsszenarien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1173842