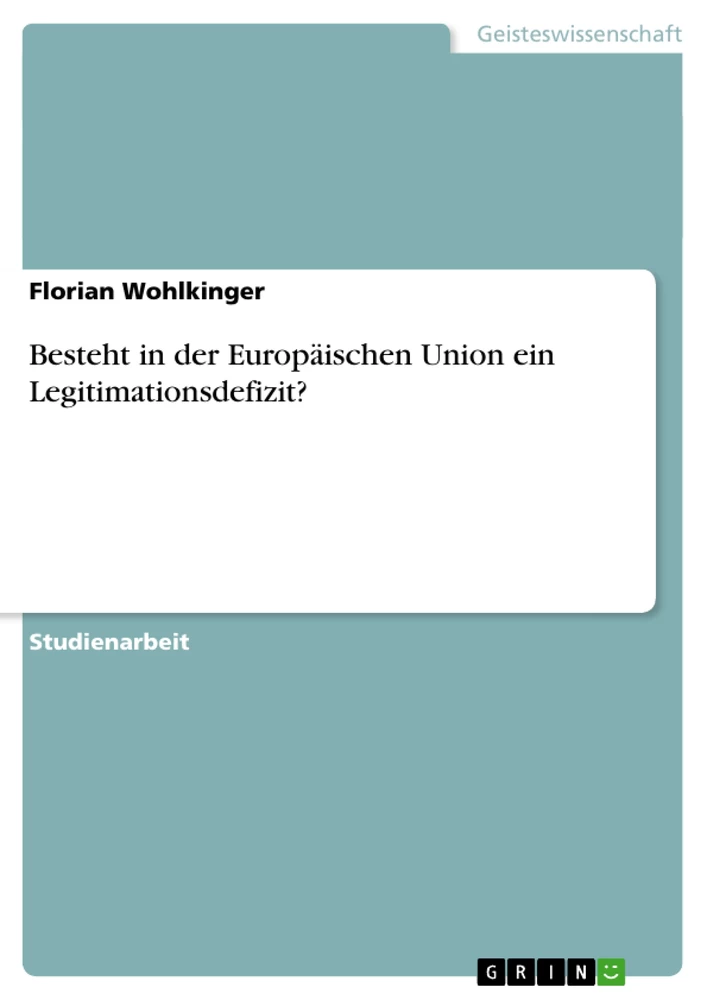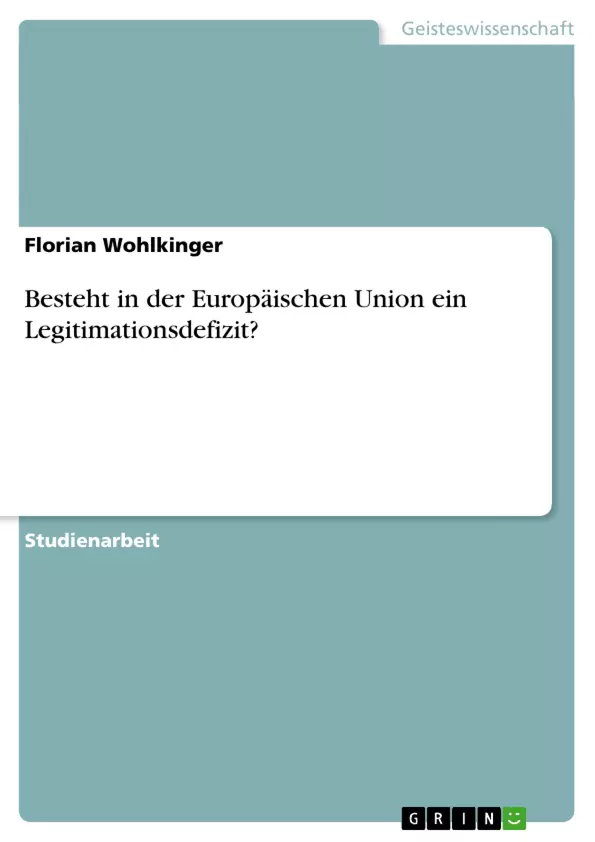Mit der Gründung der Europäischen Union bzw. Europäischen Gemeinschaft wurde der
Aufbau einer Sorte der politischen Ordnung in die Wege geleitet, wie es sie in dieser Form
bisher noch nicht gegeben hat. Diese unterscheidet sich in so mancherlei Hinsicht von der
altbekannten Konzeption des Nationalstaats. Daher stellen sich in soziologischer Hinsicht
einige hochinteressante analytische Fragestellungen: Woher bezieht ein neuartiges Herrschaftsgebilde
wie die Europäische Union ihre Legitimität? Entspricht die Legitimitätsgrundlage
den Legitimität stiftenden Quellen des Nationalstaates? Oder bezieht die EU ihre Legitimation
aus anderen als den von Nationalstaaten bekannten Legitimationsquellen? Besteht für
die EU überhaupt so etwas wie Legitimierungsbedarf? An diese Punkte knüpft die vorliegende
Arbeit an, indem sie sich mit der Untersuchung des oft proklamierten „Legitimationsdefizits“
befasst.
Dieser Text versucht, unterschiedliche Perspektiven zur Legitimitätsfrage der EU zu beleuchten
und sich kritisch mit ihnen auseinander zusetzen. Um diesem Anspruch gerecht zu
werden, sollen im folgenden Kapitel eingangs die zugrunde gelegten Fachausdrücke kurz erläutert
werden, um eine begriffliche Grundlage zu schaffen. Im Anschluss daran werden zunächst
diejenigen Legitimationsmechanismen vorgestellt, die im Nationalstaat zum Tragen
kommen. Anschließend werden die legitimierenden Kräfte in der Europäischen Union näher
beleuchtet. Dabei soll insbesondere auf die außergewöhnliche Situation eingegangen werden,
die sich durch das in historischer Hinsicht einmalige System der EU darbietet. Abschließend
sollen diese Positionen diskutiert und kritisch hinterfragt werden.
Insgesamt soll dargelegt werden, dass das oft proklamierte Legitimationsdefizit lediglich
eine Frage der Sichtweise ist, da bei eingehender Betrachtung eine ganze Menge an legitimationsstiftenden
Elementen entdeckt werden können, die durch die Neuartigkeit des transnationalen
Regimes bedingt sind und daher bei einer nationalstaatlich geprägten Sichtweise oft
nicht genügend Berücksichtigung finden.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffliche Explikationen
2.1 Das klassische Legitimationskonzept nach Max Weber
2.2 Legitimationsbedarf
2.3 Der Begriff der Legitimationskrise
3 Demokratische Legitimationskräfte
3.1 Input-orientierte Legitimation
3.2 Output-orientierte Legitimation
4 Legitimität in der Europäischen Union
4.1 Das ‚Demokratiedefizit’ der EU
4.2 Die EU als supranationale Technokratie
4.3 Legitimationskräfte technokratischer Politik in der EU
5 Diskussion der Legitimationsfrage
5.1 Methodologischer Nationalismus vs. transnationale Betrachtung
5.2 Besteht in der EU eine Legitimationskrise?
6 Zusammenfassung
7 Fazit
8 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Mit der Gründung der Europäischen Union bzw. Europäischen Gemeinschaft[1] wurde der Aufbau einer Sorte der politischen Ordnung in die Wege geleitet, wie es sie in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat. Diese unterscheidet sich in so mancherlei Hinsicht von der altbekannten Konzeption des Nationalstaats. Daher stellen sich in soziologischer Hinsicht einige hochinteressante analytische Fragestellungen: Woher bezieht ein neuartiges Herrschaftsgebilde wie die Europäische Union ihre Legitimität? Entspricht die Legitimitätsgrundlage den Legitimität stiftenden Quellen des Nationalstaates? Oder bezieht die EU ihre Legitimation aus anderen als den von Nationalstaaten bekannten Legitimationsquellen? Besteht für die EU überhaupt so etwas wie Legitimierungsbedarf? An diese Punkte knüpft die vorliegende Arbeit an, indem sie sich mit der Untersuchung des oft proklamierten „Legitimationsdefizits“ befasst.
Dieser Text versucht, unterschiedliche Perspektiven zur Legitimitätsfrage der EU zu beleuchten und sich kritisch mit ihnen auseinander zusetzen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sollen im folgenden Kapitel eingangs die zugrunde gelegten Fachausdrücke kurz erläutert werden, um eine begriffliche Grundlage zu schaffen. Im Anschluss daran werden zunächst diejenigen Legitimationsmechanismen vorgestellt, die im Nationalstaat zum Tragen kommen. Anschließend werden die legitimierenden Kräfte in der Europäischen Union näher beleuchtet. Dabei soll insbesondere auf die außergewöhnliche Situation eingegangen werden, die sich durch das in historischer Hinsicht einmalige System der EU darbietet. Abschließend sollen diese Positionen diskutiert und kritisch hinterfragt werden.
Insgesamt soll dargelegt werden, dass das oft proklamierte Legitimationsdefizit lediglich eine Frage der Sichtweise ist, da bei eingehender Betrachtung eine ganze Menge an legitimationsstiftenden Elementen entdeckt werden können, die durch die Neuartigkeit des transnationalen Regimes bedingt sind und daher bei einer nationalstaatlich geprägten Sichtweise oft nicht genügend Berücksichtigung finden.
2 Begriffliche Explikationen
Um die Frage nach der Legitimationsgrundlage der EU angemessen beantworten zu können ist eine klare Vorstellung von den verwendeten Begrifflichkeiten unabdingbar. Daher sollen diese und einige damit verbundene Vorstellungen hier zunächst einmal grundlegend erläutert werden.
Schlägt man in politikwissenschaftlichen oder soziologischen Fachlexika nach, so finden sich meist gleich mehrere unterschiedliche Varianten der Definition von Legitimität, die zwar alle auf ihre eigene Art und Weise formuliert sind, jedoch immer einen gemeinsamen Kern zum Inhalt haben: Grundsätzlich ist unter Legitimität nichts anderes zu verstehen als „Berechtigung“, und der Begriff zielt darauf ab, entweder Handlungen gegenüber Beherrschten (oder anderen) selbst oder aber die Herrschaft zu rechtfertigen (vgl. Fuchs-Heinritz 1994). Dementsprechend ist es bei einer etwas genaueren Explikation des Begriffs sinnvoll, auch dem Herrschaftsbegriff ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Dies soll im folgenden Abschnitt in Anlehnung an Max Weber geschehen.
2.1 Das klassische Legitimationskonzept nach Max Weber
„Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden“ (Weber und Sukale 1995: 311). Unter Verwendung dieser Herrschaftsdefinition unterschied Max Weber drei Typen von Legitimität, aus denen sich die drei Typen legitimer Herrschaft ergeben (Weber und Sukale 1995; vgl. hierzu auch Münch 2002):
1. Rational-legale Herrschaft: Sie wird durch den Glauben an die Legalität einer sozialen Ordnung und die Entscheidungsgewalt der Herrschenden begründet.
2. Traditionale Herrschaft: Diese stützt sich auf den Glauben an die Heiligkeit von Traditionen und den darauf berufenen Herrschern.
3. Charismatische Herrschaft: Sie basiert auf der Hingabe an die Heiligkeit, die Heldenkraft oder die vorbildlichen Persönlichkeitsmerkmale einer Führungsperson und deren Anordnungen.
Politische Herrschaft beinhaltet also immer „eine je spezifische Beziehung zwischen Herrschendem, Verwaltungsstab und den Beherrschten“ (Münch 2002: 178) und bedeutet somit im Alltag vorrangig Verwaltung (vgl. Weber und Sukale 1995). Das Besondere bei der rational-legalen Herrschaft ist die Tatsache, dass sich diese Herrschaft nicht in einzelnen Personen manifestiert, sondern in der Herrschaft durch Recht und Verfassung. Es handelt sich dabei also um eine Herrschaftsform, die ihre Legitimität aus der Einhaltung von formalen Verfahren und festen Regeln bezieht. Weitere Kennzeichen sind die Ämterhierarchie und die Organisation in einer Bürokratie. Der Idealtypus der bürokratischen Organisation der Verwaltung einer rational-legalen Herrschaft beinhaltet eine klare hierarchische Befehlsgliederung, Entscheidungsfindung durch Vorschriften, ein fest angestelltes und fachlich ausgebildetes Personal, routinierte Handlungen und Überprüfbarkeit durch Aktenführung (vgl. Fuchs-Heinritz 1994, Münch 2002).
2.2 Legitimationsbedarf
Legitimations bedarf besteht letzten Endes überall dort, wo Herrschaftsansprüche geltend gemacht werden. Entsprechen herrschaftliche Maßnahmen den Interessen der davon Betroffenen, so ist Legitimation nur in geringem Maße erforderlich – schließlich kommen solche Handlungen ja den jeweiligen Adressaten zugute. Erst bei Maßnahmen, die Interessen oder Präferenzen der Betroffenen verletzen, wird eine deutlich umfangreichere Legitimierung erforderlich. Das Ausmaß der notwendigen Legitimierung richtet sich dementsprechend nach der jeweiligen Schwere der Interessens- bzw. Präferenzverletzung bei der Gruppe der Betroffenen. Es handelt sich folglich um eine ordinalskalierte Kategorie: in manchen Fällen ist mehr, in anderen Fällen weniger Legitimität erforderlich, um bestimmte Maßnahmen zu rechtfertigen (vgl. Scharpf 2004). Am meisten Legitimationsbedarf besteht demzufolge also dort, wo die Befriedigung der Interessen einer Gruppe nur auf Kosten der Interessen einer anderen Gruppe erreicht werden kann.
Zusammengefasst lässt sich somit bisher sagen, dass Legitimität in sehr engem Zusammenhang mit Herrschaft steht, auf die Rechtmäßigkeit einer Handlung abzielt und überall dort vonnöten ist, wo Interessen oder Präferenzen von Betroffenen möglicherweise verletzt werden. Im nächsten Abschnitt soll nun geklärt werden, welche Implikationen mit einem vorliegenden Mangel an Legitimation verbunden sind.
2.3 Der Begriff der Legitimationskrise
Unter dem Begriff der Legitimationskrise versteht man allgemein „Situationen, in denen die Herrschenden nicht mehr ohne weiteres mit der Wirksamkeit gewohnter Anerkennung der Rechtmäßigkeit ihrer Herrschaft durch die Beherrschten rechnen können“ (Fuchs-Heinritz 1994: 396). Eine Legitimationskrise kann in einer politischen Ordnung auf zweierlei Arten entstehen: Zum einen, wenn die ihr Wirken rechtfertigenden Grundwerte und Leitnormen ihren Verbindlichkeitscharakter einbüßen, und zum anderen, wenn der Handlungsauftrag und die Entscheidungsbefugnisse der Institutionen nicht mehr im erforderlichen Maße durchgesetzt werden können (vgl. Bach 1999). Mögliche Gründe für eine solche „Delegitimation“ (Bach 1999: 83) könnten zum Beispiel politische Widerstände oder praktische Ineffizienz der Regierung sein.
Unzureichende bzw. gänzlich fehlende Legitimation stellt also die Herrschenden vor das Problem, dass ihnen gegebenenfalls nicht mehr der Gehorsam entgegengebracht wird, der für eine reibungslos funktionierende Ausübung der Herrschaft vonnöten wäre. Eine derart untergrabene Herrschaftsausübung kann im Extremfall sogar zur Folge haben, dass der gesamte politische Apparat zusammenbricht und eine komplette Umstrukturierung des Regierungssystems erfolgen muss.
Nachdem nun also die wesentlichen Begrifflichkeiten geklärt wurden und somit eine grundlegende Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel geschaffen wurde, kann im nächsten Abschnitt mit dem ersten thematischen Schwerpunkt dieser Arbeit begonnen werden: die Vorstellung der legitimierenden Prinzipien, die im nationalstaatlichen Rahmen zum Tragen kommen.
3 Demokratische Legitimationskräfte
Dass die Ausübung von herrschaftlicher Gewalt unweigerlich an die Notwendigkeit legitimierender Kräfte gekoppelt ist, wurde bereits im vorangegangenen Abschnitt kurz dargestellt. In diesem Kapitel soll nun der Frage nachgegangen werden, welche Formen diese legitimierenden Kräfte annehmen können und wie die Legitimationsbasis im Rahmen der wohlbekannten nationalstaatlichen Herrschaftsausübung aussieht.
Fritz Scharpf (1999; vgl. auch Scharpf 1970, 2004) differenziert bei den Legitimationskräften zwischen „input-orientierten“ und „output-orientierten“ Legitimationsargumenten:
„Die input-orientierte Perspektive betont die ‚Herrschaft durch das Volk ’. Politische Entscheidungen sind legitim, wenn und weil sie den ‚Willen des Volkes’ widerspiegeln – das heißt, wenn sie von den authentischen Präferenzen der Mitglieder einer Gemeinschaft abgeleitet werden können. Im Unterschied dazu stellt die output-orientierte Perspektive den Aspekt der ‚Herrschaft für das Volk ’ in den Vordergrund. Danach sind politische Entscheidungen legitim, wenn und weil sie auf wirksame Weise das allgemeine Wohl im jeweiligen Gemeinsinn fördern“ (Scharpf 1999: 16; Hervorhebungen im Original).
Diese Unterscheidung der Legitimationsargumente wird in den folgenden beiden Abschnitten detailliert dargestellt.
3.1 Input-orientierte Legitimation
Bei den input-orientierten Legitimationsargumenten im Nationalstaat geht es vorrangig um die Frage, wie alle Menschen möglichst gleichberechtigt an der Demokratie teilnehmen können. Die Präferenzen der Mitglieder des Gemeinwesens spielen daher eine wesentliche Rolle, da sie es sind, die von der Politik umzusetzen versucht werden müssen. Ein Problem stellen dabei solche Präferenzen dar, die nicht uneingeschränkt von allen Gemeinschaftsmitgliedern geteilt werden: Welcher Präferenzgruppe gewährt man die Forderungen? „Die Mehrheitsregel erlaubt die Unterdrückung der Minderheit; werden aber qualifizierte Mehrheiten oder gar Einstimmigkeit gefordert, so ermöglicht man die Diktatur von status-quo-orientierten Minderheiten“ (Scharpf 2004). Allein aus der Aggregation individualistischer Präferenzen lassen sich daher keine normativ plausiblen Argumentationsargumente herleiten.
Erst die Ergänzung von zusätzlichen Argumenten, die das Vertrauen der Minderheit in die Mehrheit begründen können, ermöglicht die Rechtfertigung von Mehrheitsentscheiden, bei denen die Präferenzen einzelner hinter die der Mehrheit zurücktreten müssen. Das Konzept der kollektiven Identität (also ein Gefühl von Zugehörigkeit und Verbundenheit zu einer bestimmten Gruppe) stellt ein solches Argument dar: Ist eine derartige Gemeinschaftsorientierung der Mitglieder vorhanden, „so verliert die Mehrheitsherrschaft in der Tat ihren bedrohlichen Charakter und kann dann auch Maßnahmen der interpersonellen und interregionalen Umverteilung legitimieren, die andernfalls nicht akzeptabel wären“ (Scharpf 1999). Die input-orientierte Legitimation macht also die demokratische Legitimität von einer bereits existierenden kollektiven Identität abhängig.
[...]
[1] Anmerkung: Die Bezeichnungen EU bzw. EG beziehen sich hier auf das europäische Institutionengefüge als Ganzes und werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Sie sollen nicht auf die politikfeldbezogenen Säulen abzielen.
- Arbeit zitieren
- Florian Wohlkinger (Autor:in), 2007, Besteht in der Europäischen Union ein Legitimationsdefizit?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/117122