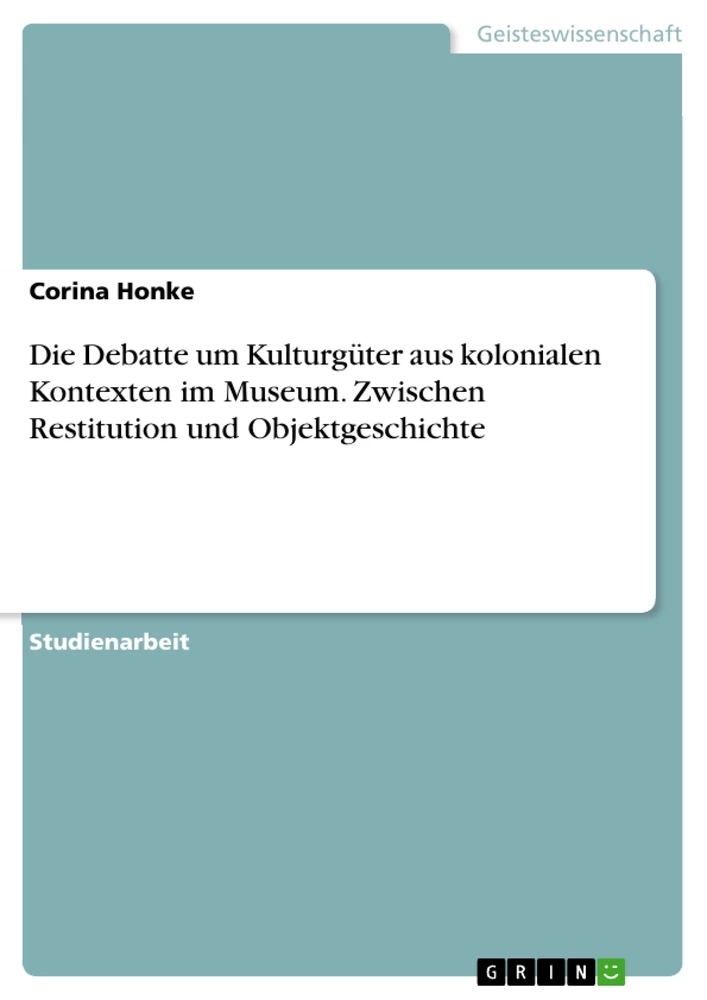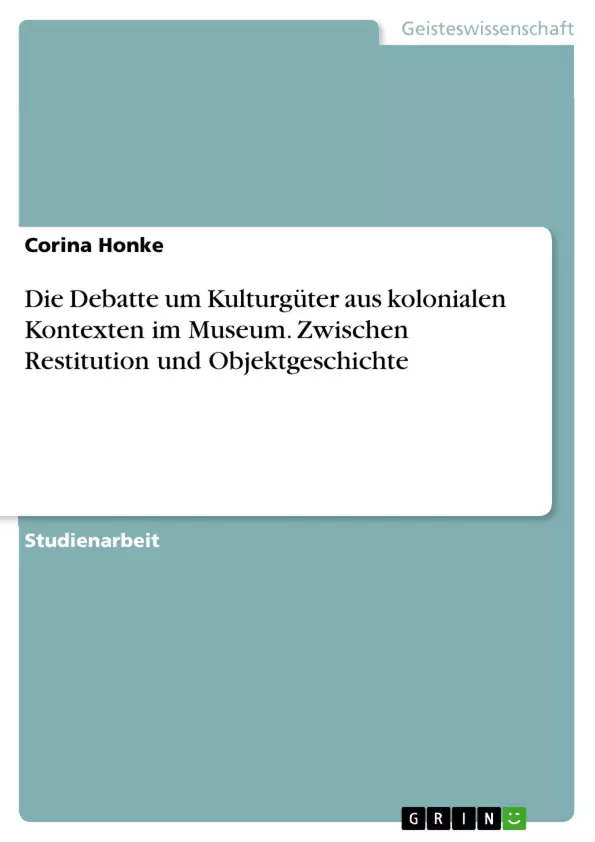Die Debatte über den Umgang mit kolonialen Kulturgütern in europäischen Museen wird zunehmend seit Anfang der 2000er Jahre geführt und nimmt seit einigen Jahren stark zu. Das liegt u.a. an der Rolle der Museen, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen, einer zunehmenden gesellschaftlichen Sensibilisierung für globale Geschichte und dem Informationsaustausch über die konfliktbeladenen Kulturgüter. Die Forderung nach Restitutionen und nach einer intensiveren Provenienzforschung werden immer eindringlicher, so dass Gesellschaft und Museen sich ihnen nicht mehr entziehen können. In der vorliegenden Arbeit geht es um die Besonderheit von kolonialen Kulturgütern und ihren Charakter als sensible Objekte, die Entwicklung der Debatte und den Möglichkeiten, wie mit ihnen in musealen Kontexten umgegangen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Koloniale Kulturgüter als „Sensible Objekte“.
- 3. Positionen im Diskurs über die Benin Bronzen......
- 3.1 Das Beschweigen der Objektgeschichte im Museum - Rebekka Habermas
- 3.2 Argumentationsmuster in der Debatte über koloniales Raubgut – Belinda Kazeem..
- 4. Koloniale Kulturgüter als Herausforderung für Museum und Gesellschaft …………………………………………
- Literaturverzeichnis........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Debatte um den Umgang mit kolonialen Kulturgütern in europäischen Museen, die seit Anfang der 2000er Jahre zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Die Arbeit analysiert den Charakter dieser Güter als „Sensible Objekte“, untersucht die Entwicklung der Debatte und erörtert mögliche Strategien für den Umgang mit diesen Objekten in musealen Kontexten.
- Die Besonderheit von kolonialen Kulturgütern als „Sensible Objekte“
- Die Entwicklung der Debatte um koloniale Kulturgüter in Museen
- Zentrale Argumente im Diskurs über den Umgang mit kolonialen Kulturgütern
- Herausforderungen im Umgang mit kolonialen Kulturgütern in musealen Kontexten
- Mögliche Strategien für den Umgang mit kolonialen Kulturgütern in Museen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Aktualität und Relevanz der Debatte um koloniale Kulturgüter in europäischen Museen dar. Sie beleuchtet die steigende öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema, die Forderung nach Restitutionen und die Bedeutung der Provenienzforschung. Die Einleitung führt den Restitutionsreport von Bénédicte Savoy und Felwine Sarr ein, der im November 2018 erschien und eine neue Dynamik in die Debatte brachte. Sie skizziert die zentralen Leitfragen der Hausarbeit, die sich mit den Herausforderungen im Umgang mit kolonialen Kulturgütern, den zentralen Argumenten im Diskurs und deren Bewertung befassen.
2. Koloniale Kulturgüter als „Sensible Objekte“
Dieses Kapitel definiert den Begriff der „Sensiblen Objekte“ im Kontext kolonialer Kulturgüter. Es zeigt auf, dass diese Objekte häufig im Zusammenhang mit Unterdrückung und Entwürdigung von Minderheiten erworben wurden und eine enge Beziehung zu den Herkunftsgemeinschaften besitzen. Der Text analysiert die kulturelle und historische Bedeutung dieser Objekte, ihre Funktion in den Herkunftsgesellschaften und die spezifischen Herausforderungen, die sich aus der kulturellen Sensibilität dieser Objekte ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich der Debatte um koloniale Kulturgüter in Museen, besonders dem Konzept von „Sensiblen Objekten“. Sie analysiert Argumentationsmuster und zentrale Positionen im Diskurs, etwa die Beiträge von Rebekka Habermas und Belinda Kazeem. Im Mittelpunkt stehen die Provenienzforschung, Restitutionsforderungen und die Herausforderungen für Museen und Gesellschaft im Umgang mit diesem Thema. Die Arbeit untersucht auch die Rolle der Objektgeschichte im Museum und den Konflikt zwischen Restitution und der Bewahrung kultureller Artefakte.
- Quote paper
- Corina Honke (Author), 2019, Die Debatte um Kulturgüter aus kolonialen Kontexten im Museum. Zwischen Restitution und Objektgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1169818