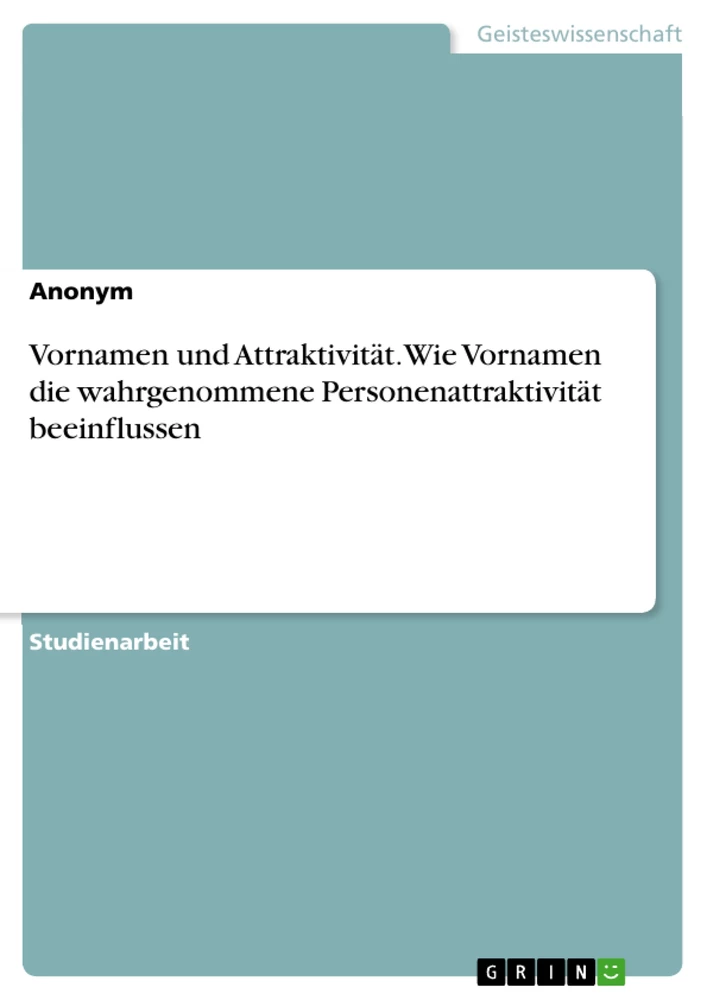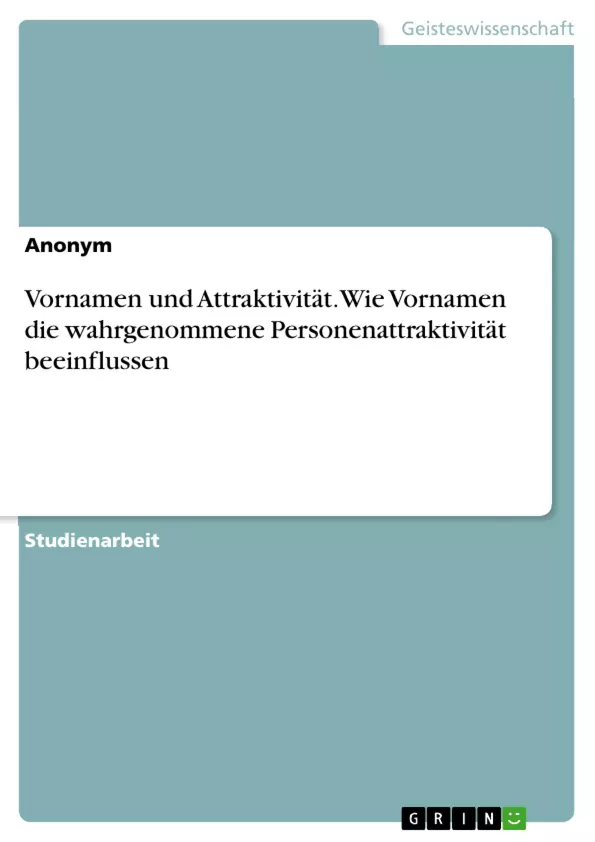Die vorliegende Forschungsarbeit umfasst die Untersuchung einer möglichen Abhängigkeit der eingeschätzten Personenattraktivität davon, ob ihr Vorname modern oder altmodisch ist. Dies erfolgt anhand der Erhebung, Auswertung und Interpretation von empirisch erfassten Daten. Sobald wir einen Vornamen hören, assoziieren wir gewisse Persönlichkeitsmerkmale mit der betreffenden Person, wie beispielsweise das Alter, den Bildungsgrad oder die ethnische Zugehörigkeit.
Diese stereotypen Vorstellungen entwickeln sich automatisch aufgrund der persönlichen Erfahrungen und Leitbilder, welche dem Vornamen bewusst oder unbewusst gegenübergestellt werden. Oftmals bleiben diese Assoziationen bestehen, bis nähere Informationen über die betreffende Person gegeben sind. Allerdings werden anhand des Vornamens einer Person nicht nur Annahmen über ihre charakteristischen Eigenschaften getroffen, zusätzlich entsteht eine Vorstellung über ihr äußerliches Erscheinungsbild. Aufgrund dessen lässt sich vermuten, dass der Vorname einen erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung der Attraktivität einer Person hat.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Definition zentraler Begriffe
- Studie der Technischen Universität Chemnitz
- Empirische Untersuchung
- Forschungsgegenstand und -hypothese
- Versuchsdesign
- Stichprobe
- Materialien
- Datenerhebung
- Datenauswertung
- Interpretation der Ergebnisse
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Forschungsarbeit befasst sich mit der Abhängigkeit der wahrgenommenen Attraktivität einer weiblichen Person von der Modernität bzw. Nicht-Modernität ihres Vornamens. Ziel ist es, einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Grad der Modernität eines weiblichen Vornamens und der daraus resultierenden Einschätzung der Attraktivität seiner Trägerin zu untersuchen.
- Die Auswirkungen von Vornamen auf die Wahrnehmung von Attraktivität
- Die Rolle der Modernität und Nicht-Modernität von Vornamen in der Personenwahrnehmung
- Die Beziehung zwischen stereotypen Vorstellungen und der Attraktivitätsbeurteilung
- Die Analyse empirischer Daten zur Untersuchung der Hypothese
- Die Interpretation der Ergebnisse und deren Bedeutung für die Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Kapitel "Zusammenfassung" bietet eine kurze Übersicht über die Forschungsfrage, die Methodik und die wichtigsten Ergebnisse der Studie. Es wird der Zusammenhang zwischen der Modernität eines Vornamens und der wahrgenommenen Attraktivität einer weiblichen Person beleuchtet.
- Das Kapitel "Einleitung" führt in die Thematik ein und erläutert die Relevanz des Forschungsthemas. Es werden die grundlegenden Annahmen und die Beweggründe für die Untersuchung dargelegt.
- Das Kapitel "Theoretischer Hintergrund" befasst sich mit der Definition zentraler Begriffe wie "Attraktivität" und "Modernität". Es wird zudem die Studie der Technischen Universität Chemnitz vorgestellt, die als Grundlage für die vorliegende Arbeit dient.
- Das Kapitel "Empirische Untersuchung" beschreibt die Methodik der Forschungsarbeit. Hier werden der Forschungsgegenstand, die Hypothese, das Versuchsdesign, die Stichprobe und die verwendeten Materialien erläutert.
- Das Kapitel "Datenerhebung" befasst sich mit der Vorgehensweise bei der Datenerhebung. Es wird die Methode der schriftlichen Befragung in Form eines Fragebogens beschrieben.
- Das Kapitel "Datenauswertung" erläutert die statistische Auswertung der gesammelten Daten. Es werden die Methoden zur Analyse der Ergebnisse und die wichtigsten Ergebnisse der Auswertung dargelegt.
- Das Kapitel "Interpretation der Ergebnisse" interpretiert die Ergebnisse der Datenauswertung. Es werden die Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen und der Hypothese erläutert und die Relevanz der Ergebnisse diskutiert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Forschungsarbeit beschäftigt sich mit den Themen Vornamen, Attraktivität, Modernität, Personenwahrnehmung, Stereotypisierung, empirische Forschung, Fragebogenuntersuchung und Datenauswertung. Die Ergebnisse der Studie liefern Erkenntnisse über die Beziehung zwischen dem Grad der Modernität eines weiblichen Vornamens und der wahrgenommenen Attraktivität seiner Trägerin.
Häufig gestellte Fragen
Beeinflussen Vornamen die wahrgenommene Attraktivität?
Ja, die Forschung legt nahe, dass wir mit Vornamen automatisch Stereotype über Alter, Bildung und eben auch über das äußere Erscheinungsbild verknüpfen.
Werden moderne Vornamen als attraktiver wahrgenommen?
Die Studie untersucht genau diesen Zusammenhang: Ob die Modernität eines weiblichen Vornamens zu einer höheren Einschätzung der Attraktivität führt.
Welche wissenschaftliche Grundlage nutzt diese Arbeit?
Die Arbeit stützt sich unter anderem auf eine bekannte Studie der Technischen Universität Chemnitz zum Thema Vornamen und soziale Wahrnehmung.
Wie wurden die Daten in dieser Untersuchung erhoben?
Die Datenerhebung erfolgte durch eine empirische Untersuchung mittels schriftlicher Befragung in Form eines Fragebogens.
Bleiben die durch Vornamen ausgelösten Assoziationen bestehen?
Oft bleiben diese ersten stereotypen Vorstellungen so lange bestehen, bis konkretere Informationen über die Person vorliegen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Vornamen und Attraktivität. Wie Vornamen die wahrgenommene Personenattraktivität beeinflussen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1169042