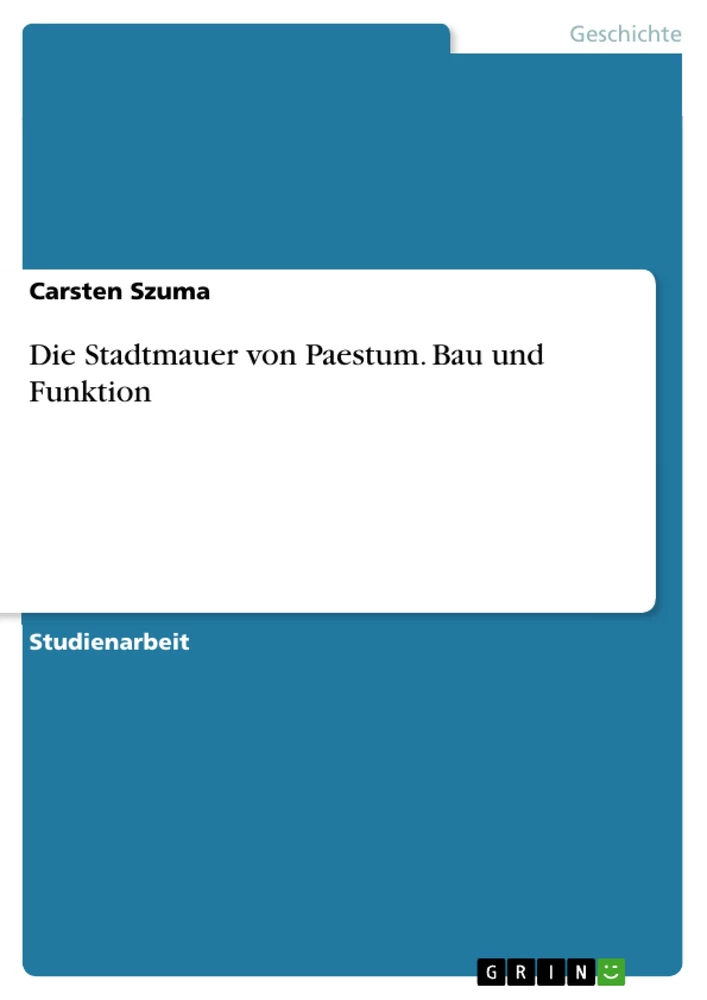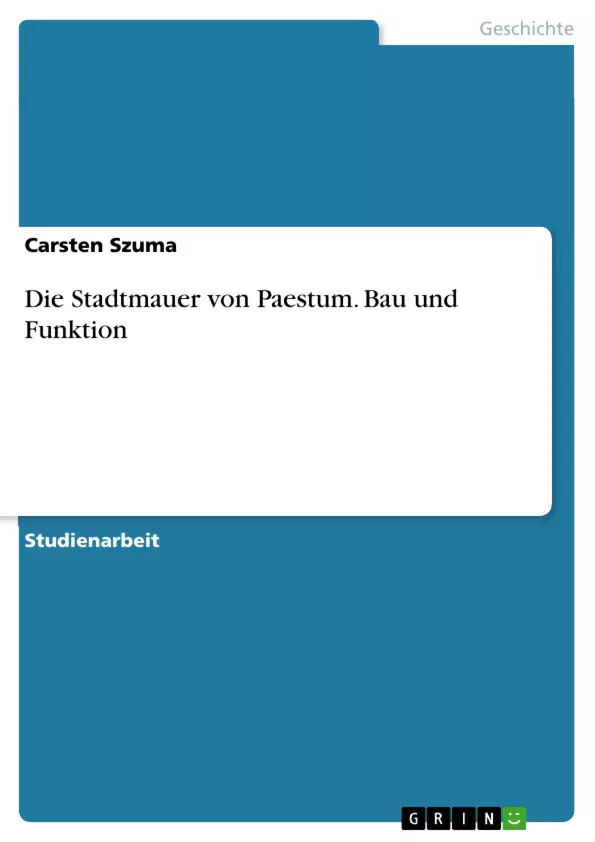In der vorliegenden Arbeit soll es mit Paestum um eine Stadt gehen, welche von griechischen Siedlern aus Sybaris gegründet wurde und welche eher für ihre überragenden Tempelbauten, wie der sogenannten Basilika, des sogenannten Neptuntempels und des sogenannten Cerestempels sowie der hervorragenden Tomba del Tuffatore, als für ihre Stadtmauer bekannt ist. Dabei ist die Stadtmauer, welche die ursprünglich Poseidonia genannte Kolonie umschloss, ebenso sehr hervorzuheben. Denn sie vereint in sich alles, was eine wehrhafte Befestigung ausmacht. Diese Arbeit soll zumindest einen kleinen Überblick über die Wehrhaftigkeit Paestums liefern. Seitdem es Menschenansammlungen gibt, aus denen im Laufe der Zeit Dörfer, Städte oder Kolonien hervorgingen, seitdem gibt es auch Stadtmauern.
Dabei konnten sie verschiedenste Funktionen haben. Sie konnten sowohl fortifikatorische als auch repräsentative oder kontrollbehaftete Zwecke haben. Dabei wurden Stadtmauern als Bewehrung zur Abgrenzung und zum Schutz nach außen hin angelegt, entweder als Abschnittsbefestigung, wenn es zum Beispiel die Umgebung zuließ oder als Ringmauer. Auch als Abgrenzung dienend, konnten so bestimmte städtische Bereiche wie Heiligtümer von anderen Sektoren abgegrenzt werden. Weiterhin konnten Stadtmauern zu Kontrollzwecken konstruiert worden sein, wie zum Beispiel an belebten Handelsverbindungen oder ebenfalls an Heiligtümern. Zu guter Letzt gab es auch Stadtmauern, die aufgrund architektonischer Ausgestaltung schlichtweg einen repräsentativen Nutzen mit sich brachten.
Da es der technologische Fortschritt bereits in der Antike schnell voranschritt, bedingte die stetige Weiterentwicklung der Angriffswaffen und -methodiken stets eine Umgestaltung in der Defensive. Dies konnte in der Verdickung der Mauer geschehen, wie auch der nachträglichen Errichtung von Türmen und Bastionen, sowie dem Ausbau der Tore. So konnten stets größere, technologisch fortgeschrittenere Artilleriewaffen stationiert werden. Auch eine Hinzufügung zahlreicher Ausfallpforten zur Unterstützung der Belagerten ist immer schon ein wehrhaftes Mittel gegen die Belagerer gewesen. Neben dieser Art der Umbau- und Ausbaumaßnahmen gab es aber auch gegenläufige Maßnahmen. So wurden Stadtmauern situationsbedingt auch zurückgebaut bei rückläufiger Gefahr oder eventuellem Niedergang einer Stadt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die Stadtmauer
- Äußere Form
- Innere Struktur
- Die Bauphasen
- Die Tore
- Porta Sirena
- Porta Marina
- Die Türme
- Turm 4
- Turm 19
- Die Pforten
- Die Mauer
- Der Graben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Stadtmauer von Paestum, einer griechischen Kolonie in Magna Graecia, und analysiert ihre Entwicklung von der archaischen bis in die hellenistische Zeit. Sie betrachtet die verschiedenen Bauphasen der Mauer, die Tore, Türme und Pforten sowie den umlaufenden Wassergraben. Die Arbeit soll einen umfassenden Einblick in die fortifikatorischen und repräsentativen Aspekte der Stadtmauer liefern.
- Die Entwicklung der Stadtmauer von Paestum über verschiedene Bauphasen
- Die fortifikatorischen und repräsentativen Funktionen der Mauer
- Die Architektur und Konstruktion der Tore, Türme und Pforten
- Der Wassergraben als wichtiger Bestandteil der Wehranlage
- Der Vergleich mit anderen Wehranlagen in Magna Graecia
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung von Stadtmauern in der Antike dar und beschreibt die verschiedenen Funktionen, die sie erfüllten. Sie führt außerdem die Stadt Paestum und ihre Bedeutung für die Erforschung der griechischen Architektur und Wehranlagen ein.
- Die Stadtmauer: Dieses Kapitel befasst sich mit der äußeren Form und der inneren Struktur der Stadtmauer von Paestum. Es beschreibt die Länge, die Fläche, die Form und die Höhe der Mauer sowie die verschiedenen Elemente, die sie bilden, wie Tore, Türme und Pforten. Es werden auch die Spuren des ehemaligen Wassergrabens behandelt.
- Die Bauphasen: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Bauphasen der Stadtmauer, die von der archaischen Zeit bis in die hellenistische Zeit reichen. Es beschreibt die Bautechniken, die verwendeten Materialien und die Veränderungen, die die Mauer im Laufe der Zeit erfahren hat. Das Kapitel beleuchtet auch die Rolle der lukanischen und der römischen Herrschaft bei der Entwicklung der Mauer.
- Die Tore: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die drei erhaltenen Toranlagen von Paestum: die Porta Sirena, die Porta Marina und die Porta Giustizia. Es beschreibt die Konstruktion, die Ausstattung und die verschiedenen Bauphasen der Tore.
- Die Türme: Dieses Kapitel stellt die verschiedenen Typen von Türmen an der Stadtmauer vor, darunter quadratische, runde und fünfeckige Türme. Es beschreibt die Konstruktion, die Funktion und die Ausstattung der Türme, die zum Teil mit architektonischen Elementen verziert waren.
- Die Pforten: Dieses Kapitel analysiert die 47 Ausfallpforten, die entlang der Mauer verteilt waren. Es beschreibt die verschiedenen Typen von Pforten und ihre Funktion als Zugang zwischen der Mauer und dem vorgelagerten Graben.
- Die Mauer: Dieses Kapitel untersucht die Bautechnik und die verschiedenen Bauphasen der Stadtmauer, insbesondere anhand des südöstlichen Mauerabschnitts. Es beschreibt die Konstruktion der Mauer, die verwendeten Materialien und die verschiedenen Schichten, die sich im Laufe der Zeit übereinander gelegt haben.
- Der Graben: Dieses Kapitel widmet sich dem umlaufenden Wassergraben, der die Stadt auf drei Seiten schützte. Es beschreibt die Konstruktion, die Funktion und die Bedeutung des Grabens als wichtigen Bestandteil der Wehranlage.
Schlüsselwörter (Keywords)
Stadtmauer, Paestum, Magna Graecia, Bauphasen, archaische Zeit, hellenistische Zeit, fortifikatorische Funktionen, repräsentative Funktionen, Tore, Türme, Pforten, Wassergraben, Bautechnik, Architektur, Konstruktion, lukanische Herrschaft, römische Herrschaft, archäologische Untersuchungen.
- Quote paper
- Carsten Szuma (Author), 2019, Die Stadtmauer von Paestum. Bau und Funktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1168630