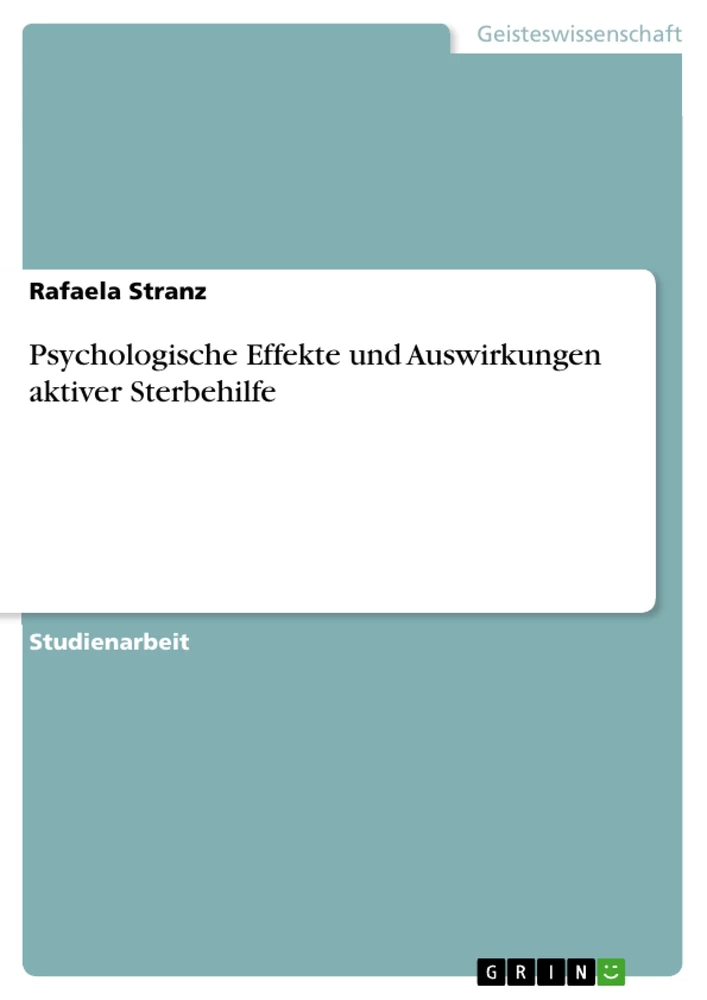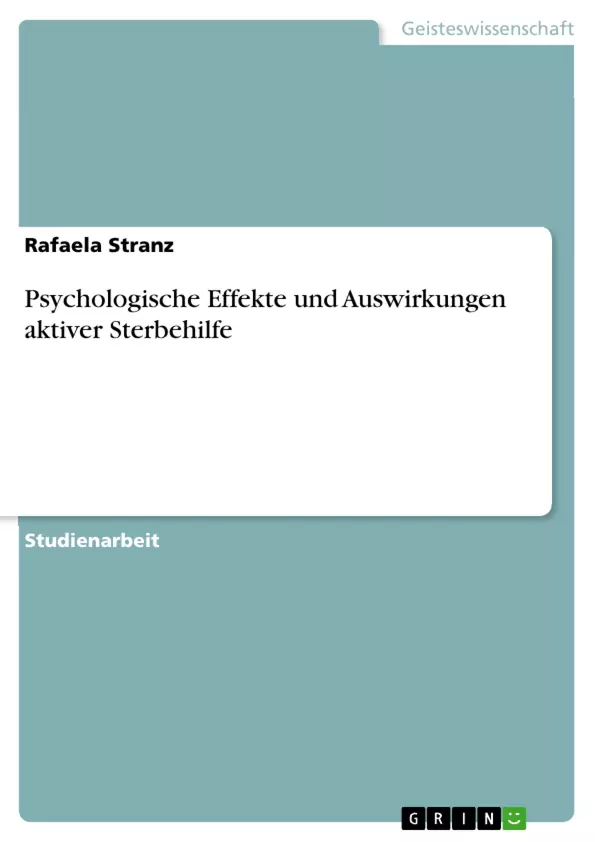Das Thema dieser Arbeit sind die psychologischen Effekte und Auswirkung aktiver Sterbehilfe, explizit in Bezug auf den Sterbenden. Zunächst werden die Begrifflichkeiten Sterben und Tod definiert sowie die verschiedenen Formen aktiver Sterbehilfe dargestellt. Anschließend werden die psychologischen Effekte und Auswirkungen aktiver Sterbehilfe erläutert. Dies erfolgt, indem die psychischen Entlastungsfaktoren unter Einbezug der Gesichtspunkte Autonomie und Selbstkonzept diskutiert werden und im Anschluss auf die psychischen Belastungsfaktoren anhand der Gesichtspunkte Entscheidungsfindung und Kognitive Dissonanz eingegangen wird. Im Fazit werden die Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick zum Thema gegeben. Angestrebt wird, einen grundlegenden Überblick zu dieser komplexen Thematik zu schaffen und auf die gesellschaftliche Relevanz hinzuweisen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aktive Sterbehilfe
- 2.1 Definition Sterben und Tod
- 2.2 Formen und Abgrenzung aktiver Sterbehilfe
- 3. Psychologische Effekte und Auswirkungen aktiver Sterbehilfe
- 3.1 Aktive Sterbehilfe als psychische Entlastung
- 3.1.1 Autonomie
- 3.1.2 Selbstkonzept
- 3.2 Aktive Sterbehilfe als psychische Belastung
- 3.2.1 Entscheidungsfindung
- 3.2.2 Kognitive Dissonanz
- 4. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den psychologischen Effekten und Auswirkungen von aktiver Sterbehilfe aus der Perspektive des Sterbenden. Sie untersucht die verschiedenen Formen der aktiven Sterbehilfe und analysiert ihre Auswirkungen auf die Psyche des Betroffenen, insbesondere in Bezug auf psychische Entlastung und Belastung.
- Definition von Sterben und Tod
- Formen der aktiven Sterbehilfe
- Psychische Entlastung durch aktive Sterbehilfe: Autonomie und Selbstkonzept
- Psychische Belastung durch aktive Sterbehilfe: Entscheidungsfindung und Kognitive Dissonanz
- Gesellschaftliche Relevanz des Themas
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der aktiven Sterbehilfe ein und beleuchtet die aktuelle gesellschaftliche Diskussion sowie die Relevanz des Themas in Bezug auf den zunehmenden Suizidtourismus. Die Arbeit zielt darauf ab, einen Überblick über die psychologischen Effekte und Auswirkungen aktiver Sterbehilfe auf den Sterbenden zu schaffen.
2. Aktive Sterbehilfe
Dieses Kapitel definiert die Begriffe Sterben und Tod und stellt die verschiedenen Formen der aktiven Sterbehilfe vor. Die direkte aktive Sterbehilfe, die indirekte aktive Sterbehilfe und der assistierte Suizid werden in ihrer Bedeutung und Abgrenzung erläutert.
2.1 Definition Sterben und Tod
Dieser Abschnitt beleuchtet den Sterbeprozess als Übergangsphase des Lebens zum Tod und beschreibt die verschiedenen Phasen des Sterbens. Zudem wird der Tod als biologischer Zustand nach dem Sterben definiert und die Unterscheidung zwischen natürlichem und nicht natürlichem Tod erläutert.
2.2 Formen und Abgrenzung aktiver Sterbehilfe
Dieses Unterkapitel erklärt die drei Kategorien der aktiven Sterbehilfe: die direkte aktive Sterbehilfe, die indirekte aktive Sterbehilfe und der assistierte Suizid. Die verschiedenen Formen werden in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden dargestellt.
Schlüsselwörter
Aktive Sterbehilfe, Sterben, Tod, psychische Entlastung, psychische Belastung, Autonomie, Selbstkonzept, Entscheidungsfindung, Kognitive Dissonanz, Suizidtourismus, Gesellschaftliche Relevanz
- Arbeit zitieren
- Rafaela Stranz (Autor:in), 2021, Psychologische Effekte und Auswirkungen aktiver Sterbehilfe, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1167718