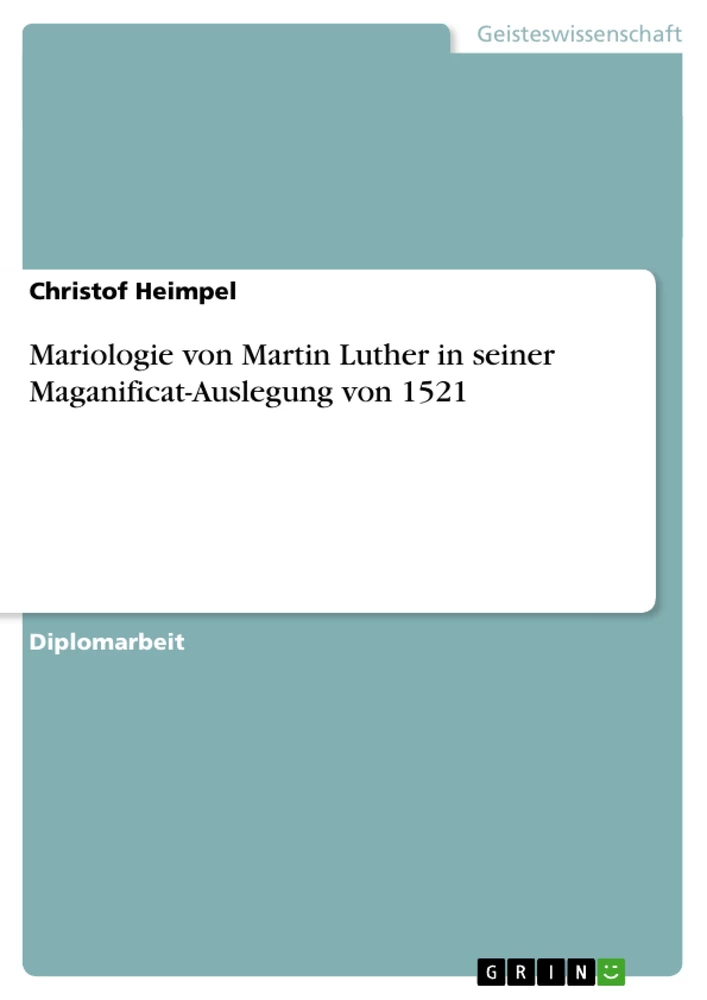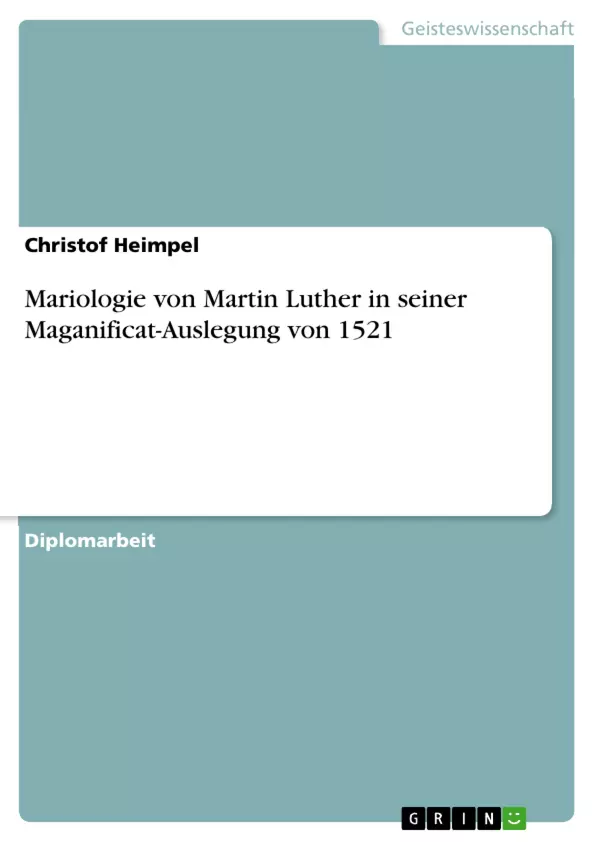Die Mariologie Martin Luthers, die in dieser Arbeit untersucht werden soll, ist nur dann zu verstehen, wenn man sie als konkrete historische Äußerung eines Theologen versteht, die in einer bestimmten Situation geschehen ist. Für diese Untersuchung, die sich an der Magnificat-Auslegung Luthers orientiert, bedeutet das, dass als erstes der Kontext darzustellen ist, aus dem heraus Luther so gedacht und geschrieben hat.
So soll nun in Kürze versucht werden, die Mariologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung darzustellen; danach soll dies speziell auf Martin Luther und dessen persönlichen Werdegang bezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Mariologie im Vorfeld von Luthers Magnificat-Auslegung
- Kurzer Abriss der Geschichte der Mariologie
- Mariologie und Marienverehrung im 15. und 16. Jahrhundert
- Mitwirkung Marias am Erlösungswerk
- Verdienst Marias
- Die Eva-Maria -Parallele
- Zwei Theologen im Umfeld Luthers
- Mariologie bei Johann von Paltz
- Mariologie bei Johann von Staupitz
- Mariologie und Marienverehrung bei Martin Luther vor 1521
- Luthers Darstellung Marias in der Auslegung des Magnificat
- Maria als Jungfrau
- Maria, die Mutter Gottes
- Maria als Vorbild und Beispiel - Luthers neuer Akzent
- Maria als Beispiel in Niedrigkeit
- Maria als Vorbild im Glauben
- Maria als Beispiel der übergroßen Gnade Gottes
- Andeutung von Konsequenzen für die Marienverehrung
- Mariologie und Rechtfertigungslehre
- Die Rechtfertigungslehre als „,articulus stantis et cadentis ecclesiae \"
- Die Rechtfertigungslehre Martin Luthers
- Das Geschehen der Rechtfertigung
- Rechtfertigung allein durch Christus
- Rechtfertigung allein aus Glauben
- Die Lehre von der Rechtfertigung in der Magnificat-Auslegung
- Der Glaube Marias
- Die Niedrigkeit-Marias
- Gott wirkt allein
- „Evangelium“ als der Kern der Rechtfertigungstheologie und als der entscheidende Inhalt des Magnificat
- Die praktische Unterordnung der Mariologie unter die Christologie
- Luthers Mariologie aus heutiger katholischer Sicht
- Die veränderte Ausgangssituation in der katholischen Dogmatik
- Gemeinsamkeiten mit Luther
- Die Verbindung der Mariologie mit Soteriologie und Ekklesiologie
- Jungfrau und Mutter Gottes
- Niedrigkeit und Glaube Marias
- Maria als vollkommen Erlöste
- Maria als Typos der Kirche
- Protestantische Stimmen - Ökumenisches Gespräch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Mariologie Martin Luthers, insbesondere in seiner Auslegung des Magnificat von 1521. Ziel ist es, Luthers Mariologie als konkrete historische Äußerung eines Theologen im Kontext seiner Zeit zu verstehen und zu analysieren, wie er die Rolle Marias im christlichen Glauben interpretiert hat. Dabei stehen Luthers Abgrenzung von den mariologischen Strömungen seiner Zeit und sein neues Verständnis von Maria als Vorbild im Glauben im Vordergrund.
- Die Entwicklung der Mariologie in der Kirchengeschichte
- Luthers Kritik an bestimmten Strömungen der Marienverehrung im 16. Jahrhundert
- Luthers Sicht auf Maria als Vorbild im Glauben und in der Niedrigkeit
- Der Einfluss der Rechtfertigungslehre auf Luthers Mariologie
- Vergleich von Luthers Mariologie mit der katholischen Sicht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die Geschichte der Mariologie und die Marienverehrung im 15. und 16. Jahrhundert, wobei die Rolle Marias in der Erlösung, ihre angeblichen Verdienste und die Eva-Maria-Parallele hervorgehoben werden. Das zweite Kapitel analysiert Luthers Darstellung Marias in seiner Magnificat-Auslegung, wobei seine Betonung von Marias Niedrigkeit, Glaube und Vorbildcharakter im Vordergrund steht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Mariologie, Martin Luther, Magnificat, Rechtfertigungslehre, Marienverehrung, Vorbildcharakter, Niedrigkeit, Glaube, Christologie, katholische Theologie.
- Quote paper
- Christof Heimpel (Author), 1985, Mariologie von Martin Luther in seiner Maganificat-Auslegung von 1521, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/11623