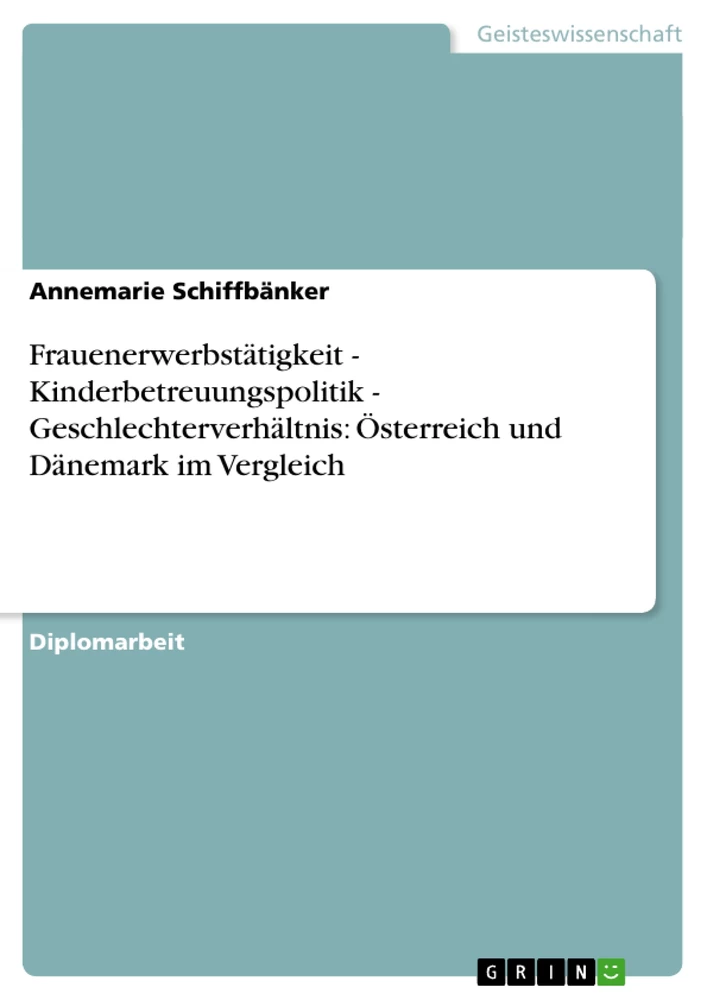Kinderbetreuung ist in allen Ländern eine geschlechtsspezifische Aktivität. Die
Wohlfahrtsstaaten unterscheiden sich allerdings im Ausmaß, in dem sie die Verantwortung für die Betreuungsarbeit zwischen öffentlich und privat verteilen sowie im Ausmaß, in dem Frauen mit kleinen Kindern in den Arbeitsmarkt integriert sind.
Die vergleichende Wohlfahrtsstaatsanalyse verknüpft das Ausmaß der Frauenerwerbstätigkeit mit der Zuteilung der Verantwortung für die Wohlfahrtsproduktion zwischen Staat, Markt und Familie. Während die "Mainstream" - Wohlfahrtsstaatsforschung die Analyse bei der Einheit Familie belässt, kommt in der feministischen Wohlfahrtsstaatsforschung der Arbeitsteilung innerhalb der Familie eine zentrale Bedeutung zu. Ein wesentliches Element der Ausgestaltung der Arbeitsteilung im Wohlfahrtsdreieck Staat - Markt - Familie betrifft die Behandlung von Betreuungsarbeit. Die soziale Organisation der Kinderbetreuung bestimmt die Arbeitsteilung und das Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Geschlechtern.
Problemstellung:
In dieser Arbeit werden die institutionellen Rahmenbedingungen der Kinderbetreuung sowie die Arbeitsmarktintegration von Frauen in den beiden Wohlfahrtsstaaten Österreich und Dänemark verglichen und deren Auswirkung auf das Geschlechterverhältnis analysiert.
These:
Der Wohlfahrtsstaat wird als geschlechterstrukturierende Institution angenommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Ausgestaltung der sozial- und familienpolitischen Maßnahmen die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern strukturiert und somit Art und Umfang der Abhängigkeit zwischen den Geschlechtern beeinflusst. Die Ausgestaltung der sozial- und familienpolitischen Maßnahmen ist das Ergebnis einer konkreten Politik und variiert daher zwischen den Wohlfahrtsstaaten. Durch die spezifische Ausgestaltung wohlfahrtsstaatlicher Politik wird sowohl das Verhältnis der Frauen zum Wohlfahrtsstaat als auch das Verhältnis zwischen den Geschlechtern innerhalb der Familie mitbestimmt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG.
- METHODE UND BEGRIFFSKLÄRUNG
- Methode und Literatur
- Begriffsklärung.
- THEORETISCHER ZUGANG
- Vergleichende Perspektive
- Individualisierung versus Familialisierung durch den Wohlfahrtsstaat.
- Der "frauenfreundliche" Wohlfahrtsstaat..
- Der "patriarchale" Wohlfahrtsstaat..
- Wohlfahrtsstaats-Regime: Arbeitsteilung zwischen öffentlich und privat
- Feministische Kritikansätze
- Feministische Kritik am Verhältnis Staat - Markt - Familie.
- Feministische Kritik am Konzept der Stratifizierung
- Feministische Kritik am Konzept der Dekommodifizierung..
- Geschlechter-Regime: Arbeitsteilung innerhalb der Familie....
- Ernährer-Modell (Jane Lewis, Ilona Ostner)....
- Breadwinner Model - Individual Model (Diane Sainsbury).
- Familienerhaltersysteme (Jill Rubery, Colette Fagan)....
- Typologie patriarchalisch-kapitalistischer Länder (Susanne Schunter-Kleemann).
- Defamilialisierung in der Vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung
- Defamilialisierung in feministischen Ansätzen.
- Defamilialisierung bei Gøsta Esping-Andersen
- Wohlfahrtsstaats-Regime unter Berücksichtigung der Defamilialisierung
- Familialismus - Fertilität..
- Defamilialisierung durch Staat oder Markt?
- Defamilialisierung durch den Staat oder Arbeitsteilung innerhalb der Haushalte?
- KENNZAHLEN ZUR ARBEITSMARKTINTEGRATION VON FRAUEN
- Frauenerwerbstätigkeit in Dänemark.
- Teilzeitbeschäftigung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie..
- Arbeitslosigkeit bei Frauen mit Kindern......
- Unterschiede im Erwerbsverhalten von Frauen und Männern mit Kindern
- Frauenerwerbstätigkeit in Österreich
- Arbeitslosigkeit.
- Teilzeitbeschäftigung
- Erwerbsverhalten von Frauen in Österreich und Dänemark im Vergleich.......
- Altersspezifische Erwerbsquoten
- Erwerbsverhalten von Frauen mit Kindern.
- Erwerbsverhalten von Frauen nach dem Alter der Kinder
- Erwerbsverhalten von Frauen nach Anzahl der Kinder und Familienstand
- Nicht-Erwerbstätigkeit bei Frauen.....
- Chancengleichheit am Arbeitsmarkt.
- Arbeitsmarktsegregation in Österreich
- Arbeitsmarktsegregation in Dänemark.
- Geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede.
- Der Dienstleistungssektor als Chance für Frauen...
- Geschlechtsspezifische Zeitverwendung.
- SOZIALSTAATLICHE PRINZIPIEN UND REGELUNGEN IN ÖSTERREICH UND DÄNEMARK
- Erwerbsarbeitsorientiertes Sicherungssystem in Österreich.
- Erwerbsarbeit
- Ehe
- Hinterbliebenenversorgung..
- Familienunterhalt
- Mutterschaft und Betreuungsarbeit
- Staatsbürgerschaft
- Universalistisches Sicherungssystem in Dänemark.
- Staatsbürgerschaft
- Grundsicherung für alle
- Erwerbsarbeit - Teilzeitbeschäftigung
- Arbeitslosenversicherung.
- Die ATP-Zusatzrente...
- Eigenständige soziale Sicherung im Alter
- Sozialisierung von Betreuungsarbeit..
- Steuersystem in Österreich und Dänemark...
- Alleinverdienerabsetzbetrag....
- FREISTELLUNGSREGELUNGEN ZUR KINDERBETREUUNG
- Österreich.....
- Mutterschutzregelung.
- Elternkarenzregelung....
- Anspruchsvoraussetzungen
- Kündigungsschutz im Anschluss an die Karenzzeit
- Dauer des Karenzgeldbezuges...
- Leistungsniveau des Karenzgeldes.
- Pflegefreistellung….....
- Dänemark..
- Mutterschaftsurlaub.
- Teilzeitkarenz.....
- Vaterschaftsurlaub..
- Elternkarenzurlaub
- Erziehungsurlaub...
- Dauer des Erziehungsgeldbezuges..
- Leistungsniveau des Erziehungsgeldes.
- Pflegefreistellung
- ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN FÜR DIE KINDERBETREUUNG
- Geldleistungen in Österreich
- Familienbeihilfe
- Steuerbegünstigungen...
- Karenzgeld......
- Karenzgeld zugunsten privater Kinderbetreuung
- Geschlechtsspezifische Wirkung bei geschlechtsneutraler Formulierung...
- Sondernotstandshilfe
- Individualisierung und Privatisierung sozialpolitischer Probleme.....
- Kinderbetreuungsbeihilfe.....
- Dienstleistungen in Österreich...
- Versorgungsgrad..
- Öffnungszeiten..
- Individualisierung versus Familialisierung durch Geld- und Dienstleistungen in Österreich ..
- Geldleistungen in DK.
- Familienbeihilfe
- Kinderbeihilfen
- Erziehungsgeld.
- Erziehungsgeld oder Betreuungseinrichtungen.
- Dienstleistungen in Dänemark.
- Öffnungszeiten .....
- Versorgungsgrad - Garantie auf Betreuungsplatz..
- Individualisierung versus Familialisierung durch Geld- und Dienstleistungen in Dänemark .......
- RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Vergleich der Kinderbetreuungspolitik in Österreich und Dänemark und untersucht die Auswirkungen dieser Politik auf die Arbeitsmarktintegration von Frauen und das Geschlechterverhältnis.
- Die Arbeit analysiert die institutionellen Rahmenbedingungen der Kinderbetreuung in beiden Ländern.
- Sie untersucht die Rolle des Wohlfahrtsstaates als geschlechterstrukturierende Institution.
- Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der Kinderbetreuungspolitik auf die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern.
- Sie analysiert die Auswirkungen der Politik auf das Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Geschlechtern.
- Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Kinderbetreuung in der Gestaltung des Verhältnisses von Frauen zum Wohlfahrtsstaat.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Kinderbetreuung und ihrer Bedeutung für die Arbeitsmarktintegration von Frauen und das Geschlechterverhältnis ein. Sie stellt die Problemstellung der Arbeit dar und formuliert die These und die zentralen Fragestellungen.
Das zweite Kapitel beschreibt die Methode und die verwendeten Begriffe der Arbeit.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem theoretischen Zugang der Arbeit. Es werden verschiedene Ansätze zur Analyse des Verhältnisses von Staat, Markt und Familie im Kontext der Kinderbetreuung vorgestellt, insbesondere die feministische Wohlfahrtsstaatsforschung und die Defamilialisierungstheorie.
Das vierte Kapitel präsentiert Kennzahlen zur Arbeitsmarktintegration von Frauen in Österreich und Dänemark. Es werden die Erwerbsquoten, die Teilzeitbeschäftigung, die Arbeitslosigkeit und die Unterschiede im Erwerbsverhalten von Frauen und Männern mit Kindern analysiert.
Das fünfte Kapitel untersucht die sozialstaatlichen Prinzipien und Regelungen in Österreich und Dänemark. Es werden die unterschiedlichen Sicherungssysteme, die Familienpolitik und die Steuerregelungen verglichen.
Das sechste Kapitel befasst sich mit den Freistellungsregelungen zur Kinderbetreuung in beiden Ländern. Es werden die Mutterschutzregelungen, die Elternkarenzregelungen, die Vaterschaftsurlaubsregelungen und die Pflegefreistellungsregelungen verglichen.
Das siebte Kapitel analysiert die öffentlichen Leistungen für die Kinderbetreuung in Österreich und Dänemark. Es werden die Geldleistungen und die Dienstleistungen verglichen und deren Auswirkungen auf die Individualisierung und Familialisierung der Kinderbetreuung untersucht.
Schlüsselwörter
Frauenerwerbstätigkeit, Kinderbetreuung, Kinderbetreuungspolitik, Wohlfahrtsstaat, Geschlechterverhältnis, Arbeitsteilung, Defamilialisierung, Österreich, Dänemark, Vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung, Feministische Wohlfahrtsstaatsforschung, Arbeitsmarktintegration, Sozialpolitik, Familienpolitik, Mutterschutz, Elternkarenz, Vaterschaftsurlaub, Erziehungsgeld, Familienbeihilfe, Kinderbeihilfe, Betreuungseinrichtungen.
- Quote paper
- Mag. Annemarie Schiffbänker (Author), 2000, Frauenerwerbstätigkeit - Kinderbetreuungspolitik - Geschlechterverhältnis: Österreich und Dänemark im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/116178