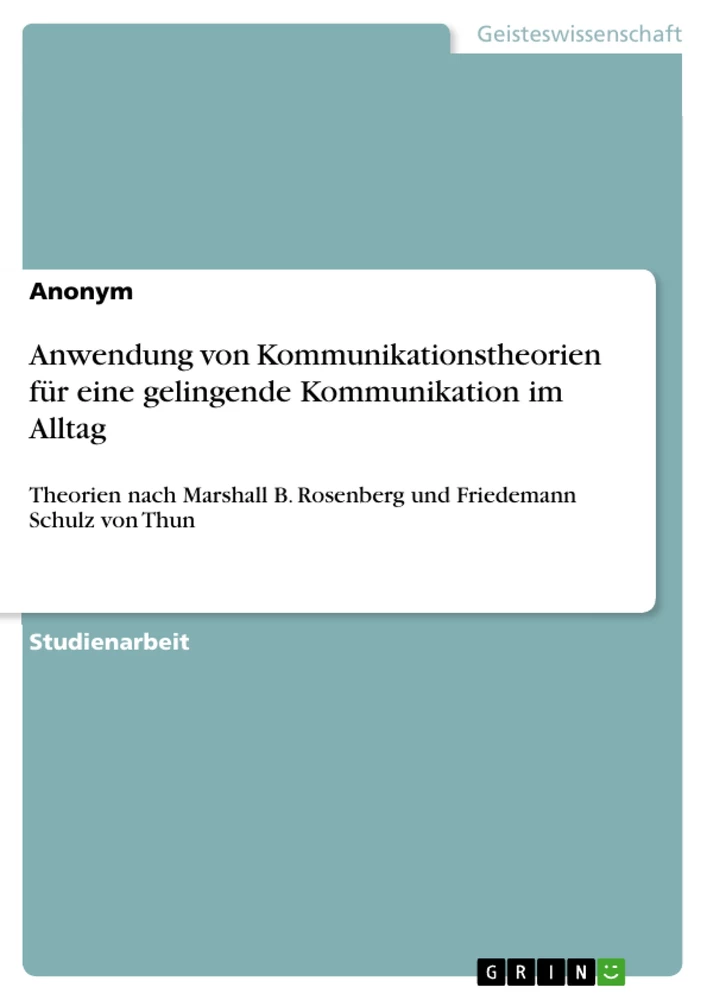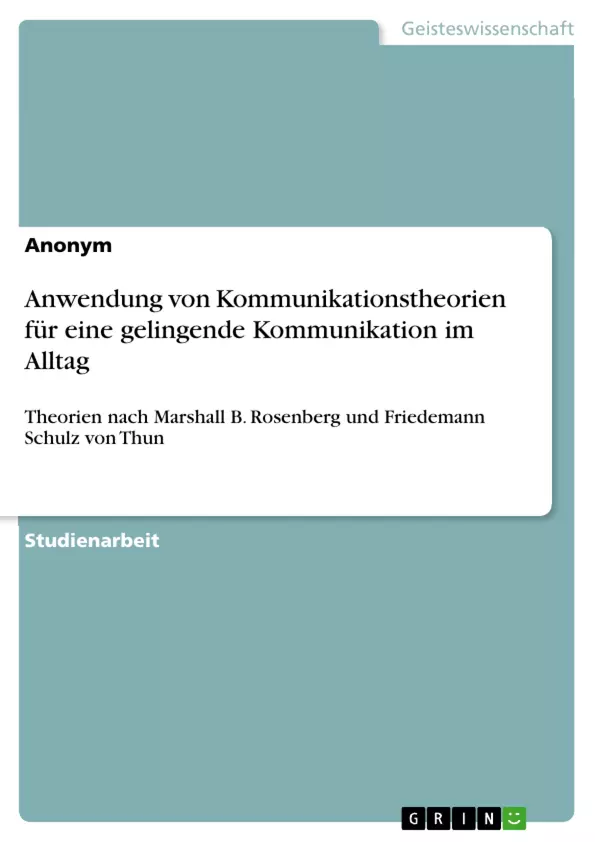Um mich intensiver mit dem Thema der Kommunikation zu beschäftigen, habe ich mich auf die Suche nach passenden Theorien für die vorliegende Hausarbeit gemacht. Demzufolge bin ich auf die Konzepte von Marshall B. Rosenberg "Gewaltfreie Kommunikation" und Friedemann Schulz von Thun "Kommunikationsquadrat" gestoßen und werde diese in meiner Arbeit erläutern. Danach werde ich beide Theorien miteinander vergleichen und mögliche Kritik dazu ausüben. Um die Wirksamkeit der Theorien bei der Anwendung näher zu untersuchen, versuche ich diese in meinem Alltag anzuwenden und werde meine Ergebnisse dazu in dieser Arbeit niederschreiben. Zuletzt werde ich verdeutlichen, inwiefern ich vom Umgang mit den Theorien im Verlauf dieser Arbeit geprägt wurde und werde diese mit einer zusammenfassenden Reflexion und einer Stellungnahme abschließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation
- Marshall B. Rosenberg und seine Idee
- Das Handlungskonzept
- Ziele des Handlungskonzeptes
- Das Kommunikationsquadrat
- Vergleich zum Handlungskonzept nach Rosenberg
- Kritik an beiden Modellen
- Beispiele aus dem Lebensalltag
- Beispiel 1
- Beispiel 2
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, die Konzepte der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg und des Kommunikationsquadrats nach Friedemann Schulz von Thun im Kontext des alltäglichen Lebens zu analysieren und zu bewerten. Dabei wird die Anwendung der Theorien im eigenen Lebensalltag erprobt und reflektiert.
- Die Bedeutung von effektiver Kommunikation im Alltag
- Die Konzepte der Gewaltfreien Kommunikation und des Kommunikationsquadrats
- Vergleich und kritische Analyse beider Modelle
- Anwendung der Theorien in persönlichen Erfahrungen
- Reflexion und Bewertung der Erkenntnisse
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung von reibungsloser Kommunikation im Alltag heraus und führt die beiden Kerntheorien der Hausarbeit, die Gewaltfreie Kommunikation und das Kommunikationsquadrat, ein. Der Autor erläutert seine persönliche Motivation, sich mit dem Thema Kommunikation zu befassen und beleuchtet dabei den Einfluss seiner religiösen und kulturellen Prägung.
- Das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation: Dieses Kapitel widmet sich dem Konzept der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg. Es beschreibt Rosenbergs Lebensgeschichte und seine Motivation, sich mit dem Thema Einfühlsamkeit und Gewaltfreiheit in der Kommunikation zu beschäftigen. Der Fokus liegt auf den Kernprinzipien der GFK und der vier Bereiche: Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten.
- Das Handlungskonzept: Der zweite Abschnitt des Kapitels geht detaillierter auf das Handlungskonzept der GFK ein. Dabei werden die einzelnen Komponenten des Modells erklärt und Beispiele für die praktische Anwendung gegeben.
- Ziele des Handlungskonzeptes: Die Ziele der GFK, wie z.B. das Schaffen von Vertrauen und Freude in der Kommunikation, werden in diesem Abschnitt beleuchtet.
- Das Kommunikationsquadrat: Dieses Kapitel widmet sich dem Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun, das ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Verständnis von Kommunikation liefert.
- Vergleich zum Handlungskonzept nach Rosenberg: In diesem Kapitel erfolgt ein Vergleich der GFK mit dem Kommunikationsquadrat. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Modelle herausgearbeitet und mögliche Kritikpunkte an beiden Theorien diskutiert.
- Beispiele aus dem Lebensalltag: Dieses Kapitel enthält praktische Beispiele aus dem Alltag, die verdeutlichen, wie die Theorien in der Praxis angewendet werden können.
Schlüsselwörter
Die Hauptuntersuchungsgegenstände dieser Hausarbeit sind die Gewaltfreie Kommunikation, das Kommunikationsquadrat, Einfühlsamkeit, Bedürfnisse, Konflikte und die Anwendung von Kommunikationstheorien im Alltag.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation (GFK)?
Nach Marshall B. Rosenberg besteht die GFK aus: 1. Beobachtung (ohne Bewertung), 2. Gefühle benennen, 3. Bedürfnisse formulieren und 4. eine konkrete Bitte äußern.
Wie funktioniert das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun?
Das Modell besagt, dass jede Nachricht vier Seiten hat: Sachinhalt, Selbstkundgabe, Beziehung und Appell. Missverständnisse entstehen oft, wenn Sender und Empfänger auf unterschiedlichen "Ohren" kommunizieren.
Was ist das Ziel der Gewaltfreien Kommunikation?
Ziel ist es, eine Verbindung auf Herzensebene herzustellen, Konflikte friedlich zu lösen und sicherzustellen, dass die Bedürfnisse aller Beteiligten gehört und respektiert werden.
Gibt es Kritik an den Modellen von Rosenberg und Schulz von Thun?
Ja, die Arbeit vergleicht beide Modelle und diskutiert Kritikpunkte, wie etwa die Schwierigkeit der Anwendung in emotional hochbelasteten Situationen oder kulturelle Unterschiede in der Kommunikation.
Wie lassen sich diese Theorien im Alltag anwenden?
Die Hausarbeit enthält praktische Beispiele, in denen der Autor versucht, durch bewusste Anwendung der Konzepte Missverständnisse im täglichen Leben zu vermeiden und reflektiert die Ergebnisse.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Anwendung von Kommunikationstheorien für eine gelingende Kommunikation im Alltag, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1160772