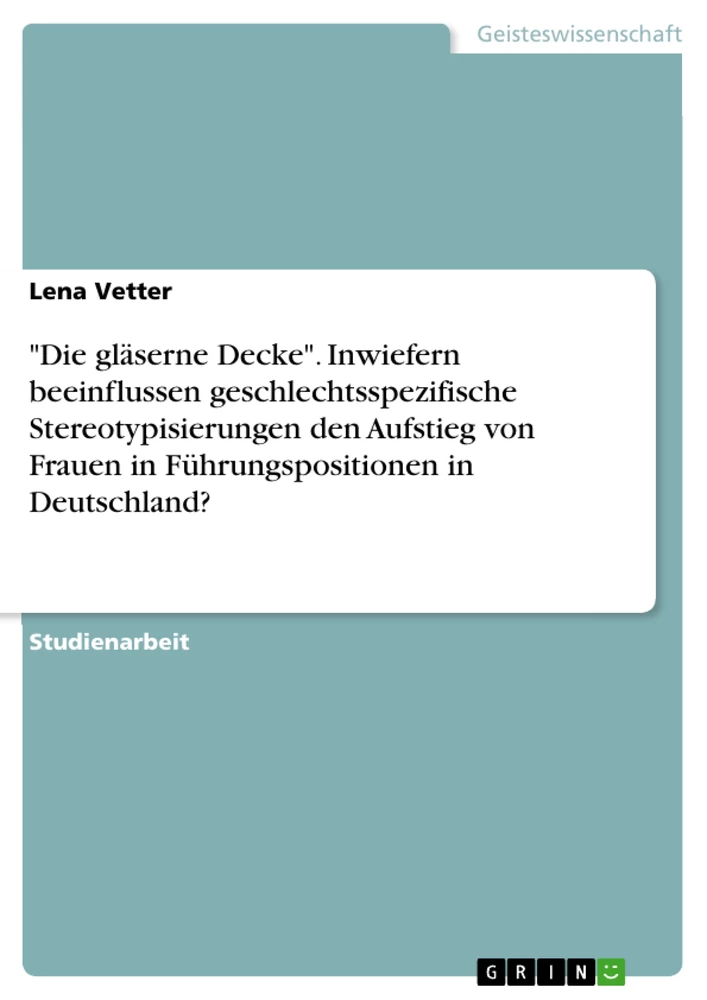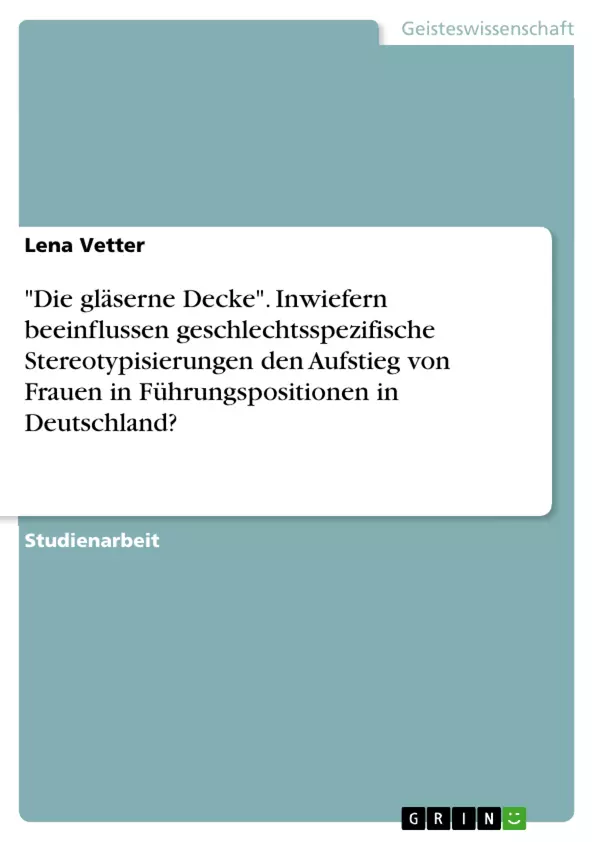Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage: „Die gläserne Decke" – Inwiefern beeinflussen geschlechtsspezifische Stereotypisierungen den Aufstieg von Frauen in Führungspositionen in Deutschland?“
Der Aufbau der Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Nach dieser Einleitung wird im zweiten Kapitel die Ausgangslage für Frauen im Zusammenhang mit Führungspositionen erläutert. Zum besseren Verständnis der Thematik werden zunächst in einem Unterkapitel die wichtigsten Führungsbegriffe definiert und erläutert. Dem folgt ein Teil, in dem die derzeitige quantitative Aufstiegsungleichheit für Frauen dargestellt wird. Daraus abgeleitet wird auf das Phänomen der „gläsernen Decke“ eingegangen.
Zur Erklärung der geschlechtsspezifischen Unterschiede in Bezug auf die Berufs- und Aufstiegschancen dient die geschlechtsspezifische Stereotypisierungen. Sie wird im dritten Kapitel thematisiert und gilt in Bezug auf die Führungspositionen als theoretischer Hintergrund dieser Arbeit. Zusätzlich zur geschlechtsspezifischen Stereotypisierungen im Führungskontext wird auf die Theorie der sozialen Rolle eingegangen.
Aus den vorgestellten Theorien und Studien werden Hypothesen abgeleitet, die im vierten Teil der Arbeit mithilfe einer eigens konzipierten, geschlossenen Onlineumfrage mit kategorischen Antwortmöglichkeiten empirisch untersucht werden. Den fünften und letzten Teil der Arbeit bildet ein Fazit.
Allgemein bekannt ist die sogenannte „gläserne Decke“ als Begründung dafür, warum Frauen es vor allem in Bezug auf hohe Führungspositionen schwerer haben als Männer. Diese „Decke“ verhindere durch unternehmensspezifische Barrieren und allgemeinen Vorurteilen gegenüber den weiblichen Erwerbstätigen die weitere Karriere nur aufgrund ihres Geschlechts. Es lässt sich somit vermuten, dass bestimmte geschlechtsspezifische Zuschreibungen wirken, die Frauen einen beruflichen Aufstieg erschweren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Ausgangslage
- 2.1 Definitionen von Führungsbegriffen
- 2.2 Quantitative Bestimmung der Aufstiegsungleichheit
- 2.3 Die gläserne Decke
- 3 Theoretischer Hintergrund
- 3.1 Definition von Stereotypisierung
- 3.2 Theorie der sozialen Rolle
- 3.3 Geschlechtsspezifische Stereotypisierung im Führungskontext
- 4 Empirischer Teil: Umfrage zu geschlechtsspezifischer Stereotypisierung von Frauen in Führungspositionen
- 4.1 Versuchsaufbau
- 4.2 Deskriptive Datenauswertung
- 4.3 Interpretation und Hypothesenüberprüfung
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, inwiefern geschlechtsspezifische Stereotypisierungen den Aufstieg von Frauen in Führungspositionen in Deutschland beeinflussen – das Phänomen der „gläsernen Decke“. Die Zielsetzung ist es, die Ausgangslage für Frauen in Führungspositionen zu beleuchten, relevante Theorien zur geschlechtsspezifischen Stereotypisierung zu präsentieren und diese durch eine empirische Untersuchung zu überprüfen.
- Definition und Auswirkungen der „gläsernen Decke“
- Geschlechtsspezifische Stereotypisierung und ihre Rolle im Führungskontext
- Theorie der sozialen Rolle und ihre Relevanz für den Aufstieg von Frauen
- Quantitative Darstellung der Aufstiegsungleichheit von Frauen
- Empirische Überprüfung der Hypothesen mittels Online-Umfrage
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des geringen Frauenanteils in Führungspositionen in Deutschland ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss geschlechtsspezifischer Stereotypisierungen auf den beruflichen Aufstieg von Frauen. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit, welcher sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil gliedert, und skizziert die Methodik der Untersuchung.
2 Ausgangslage: Dieses Kapitel beleuchtet die historische und gesellschaftliche Ausgangslage für Frauen im Kontext von Führungspositionen. Es werden zunächst zentrale Führungsbegriffe definiert und die quantitative Aufstiegsungleichheit von Frauen dargestellt. Der Begriff der „gläsernen Decke“ wird eingeführt und als ein Hindernis für den beruflichen Aufstieg von Frauen beschrieben, das durch unternehmensspezifische Barrieren und Vorurteile bedingt ist. Die historische Benachteiligung von Frauen und die damit verbundene Verknüpfung von Führungspositionen mit der männlichen Rolle werden herausgestellt.
Schlüsselwörter
Gläserne Decke, geschlechtsspezifische Stereotypisierung, Führungspositionen, Frauenquote, Aufstiegsungleichheit, soziale Rolle, Empirische Untersuchung, Online-Umfrage, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Geschlechtsspezifische Stereotypisierung und der Aufstieg von Frauen in Führungspositionen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss geschlechtsspezifischer Stereotypisierungen auf den Aufstieg von Frauen in Führungspositionen in Deutschland, insbesondere das Phänomen der „gläsernen Decke“. Sie beleuchtet die Ausgangslage für Frauen in Führungspositionen, präsentiert relevante Theorien und überprüft diese empirisch.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Definition und Auswirkungen der „gläsernen Decke“, geschlechtsspezifische Stereotypisierung im Führungskontext, die Theorie der sozialen Rolle und ihre Relevanz für den Aufstieg von Frauen, die quantitative Darstellung der Aufstiegsungleichheit von Frauen und die empirische Überprüfung von Hypothesen mittels einer Online-Umfrage.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die Ausgangslage, einen theoretischen Hintergrund, einen empirischen Teil (Umfrage), und ein Fazit. Der theoretische Teil behandelt Definitionen von Führungsbegriffen, die quantitative Bestimmung der Aufstiegsungleichheit, die „gläserne Decke“, Stereotypisierung, die Theorie der sozialen Rolle und geschlechtsspezifische Stereotypisierung im Führungskontext. Der empirische Teil beschreibt den Versuchsaufbau, die deskriptive Datenauswertung und die Interpretation mit Hypothesenüberprüfung.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Untersuchung in Form einer Online-Umfrage zur geschlechtsspezifischen Stereotypisierung von Frauen in Führungspositionen. Die Ergebnisse werden deskriptiv ausgewertet und zur Hypothesenüberprüfung verwendet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Gläserne Decke, geschlechtsspezifische Stereotypisierung, Führungspositionen, Frauenquote, Aufstiegsungleichheit, soziale Rolle, Empirische Untersuchung, Online-Umfrage, Deutschland.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern beeinflussen geschlechtsspezifische Stereotypisierungen den Aufstieg von Frauen in Führungspositionen in Deutschland?
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die Ausgangslage für Frauen in Führungspositionen zu beleuchten, relevante Theorien zur geschlechtsspezifischen Stereotypisierung zu präsentieren und diese durch eine empirische Untersuchung zu überprüfen.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 (Ausgangslage) beleuchtet die historische und gesellschaftliche Ausgangslage für Frauen in Führungspositionen, definiert Führungsbegriffe und beschreibt die „gläserne Decke“. Kapitel 3 (Theoretischer Hintergrund) behandelt Theorien zur Stereotypisierung und zur sozialen Rolle. Kapitel 4 (Empirischer Teil) beschreibt die Umfrage und deren Auswertung. Kapitel 5 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
- Arbeit zitieren
- Lena Vetter (Autor:in), 2019, "Die gläserne Decke". Inwiefern beeinflussen geschlechtsspezifische Stereotypisierungen den Aufstieg von Frauen in Führungspositionen in Deutschland?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1160052