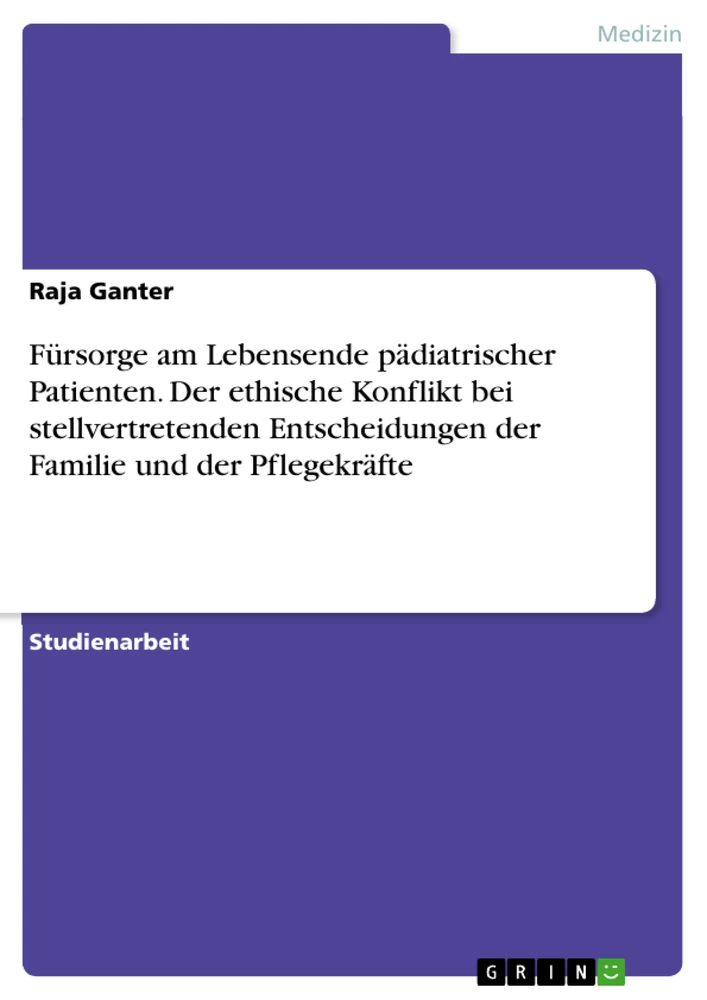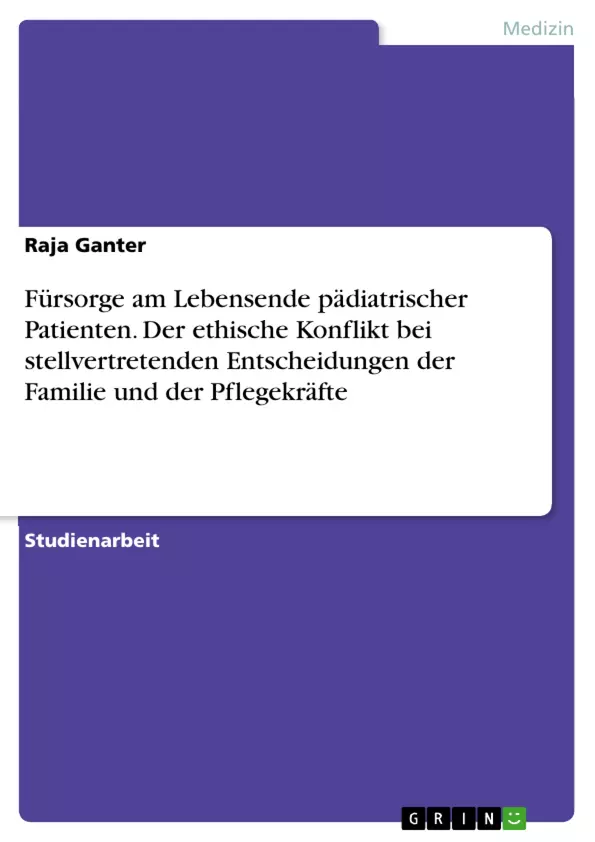Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem ethischen Konflikt der Fürsorge bei stellvertretenden Entscheidungen am Lebensende pädiatrischer Patienten.
Bis heute noch gehört der Tod und das Sterben zu einem tabuisierten Thema in der Kinderkrankenpflege. Der Gedanke dahinter ist, dass Kinder dadurch geschützt werden, wenn sie nicht mit dem Thema Tod konfrontiert werden, da sie meist keine Vorstellung davon haben. Erfahrungen vieler Ärzte/Ärztinnen zeigen, dass für die erkrankten Kinder diese Situation sehr belastend sein kann.
Dieser Irrtum, der bis heute Alltag in vielen Kliniken ist, wirkt sich nicht selten stark auf die Kommunikation mit sterbenskranken Kindern aus.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Relevanz des Themas mit exemplarischem Fallbeispiel
1.2 Fragestellung und Zielsetzung
1.3 Verwendete Literatur und Aufbau der Arbeit
2. Einführung in die Pflegeethik
2.1 Philosophische Ethik und Pflegeethik
2.2 Werte, Normen und Prinzipien
2.3 Utilitarismus
2.4 Deontologie
3. Der zentrale pflegeethische Konflikt im exemplarischen Fallbeispiel
3.1 Handlungsleitende Werte und Prinzipien im Fallbeispiel
3.2 Deontologische und Utilitaristische Betrachtung des Konflikts im Fallbeispiel
4. Fazit und Ausblick
Literarturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Raja Ganter (Autor:in), 2020, Fürsorge am Lebensende pädiatrischer Patienten. Der ethische Konflikt bei stellvertretenden Entscheidungen der Familie und der Pflegekräfte, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1159226