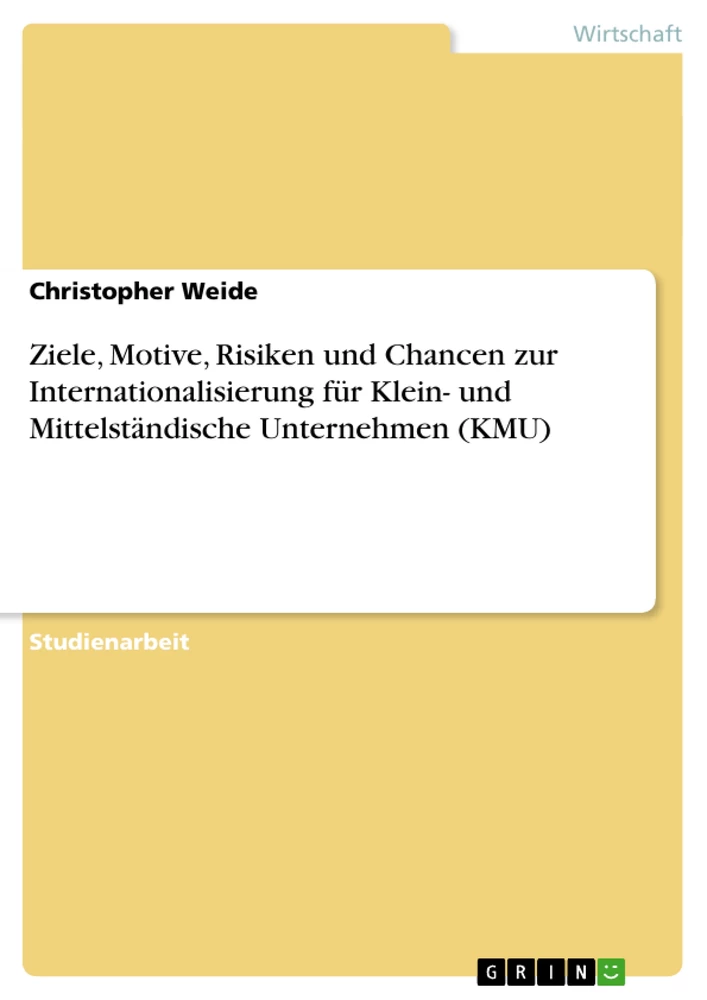Die Internationalisierung der einzelnen Geschäftsbereiche klein- und mittelständischer Unternehmen ist eine der wichtigsten Aufgaben, vor die sich diese Unternehmungen heutzutage gestellt sehen. Das betrifft nicht nur Unternehmungen in Deutschland, sondern umfasst Unternehmungen weltweit.
Speziell Unternehmen deren Kernmärkte im Inland gesättigt sind, sehen sich gezwungen, neue Absatzmärkte zu erschließen. Ergänzend kann man sagen, dass in den letzten Jahren der Welthandel stetig stärker expandiert als die Weltproduktion.
Die allgemeine Deregulierung im Welthandel, die Harmonisierung von Standards sowie die Erweiterung des europäischen Binnenmarktes stellen neue Herausforderungen an die Wettbewerbsfähigkeit von Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU). Es ist also auch für KMU von besonderer Bedeutung ihre Wertschöpfungskette durch eine Internationalisierung des Unternehmens zu verbessern, die Marktstrategien auszubauen und langfristig anzulegen. Zur Erschließung neuer Absatzmärkte und zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit existieren unterschiedliche Internationalisierungsformen. Die Unternehmen müssen die für sie geeignete Form selbst finden; dabei spielt die Größe und Organisationsstruktur eine entscheidende Rolle. Eine Möglichkeit diesen Herausforderungen zu begegnen bietet das „Joint-Venture“ den deutschen KMU.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mittelstand steht vor neuen Herausforderungen und Möglichkeiten
- Internationalisierung der KMU
- Gründe und Ziele der Internationalisierung
- Chancen und Motive der Internationalisierung
- Risiken und Hemmnisse der Internationalisierung für KMU
- Der ideale Standort
- Standort Osteuropa
- Standort China
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Internationalisierung von Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU) und analysiert die damit verbundenen Ziele, Motive, Risiken und Chancen. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, denen sich KMU im Zuge der Globalisierung stellen müssen, und untersucht die verschiedenen Internationalisierungsformen, die ihnen zur Verfügung stehen. Dabei werden insbesondere die Chancen und Risiken der Internationalisierung in Osteuropa und China betrachtet.
- Herausforderungen der Globalisierung für KMU
- Ziele und Motive der Internationalisierung
- Risiken und Hemmnisse der Internationalisierung
- Standortfaktoren für die Internationalisierung
- Chancen und Perspektiven der Internationalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Internationalisierung von KMU ein und erläutert die Bedeutung dieses Themas im Kontext der Globalisierung. Sie stellt die Herausforderungen dar, denen sich KMU im Zuge der Globalisierung stellen müssen, und zeigt die Notwendigkeit auf, neue Absatzmärkte zu erschließen.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten, denen sich der Mittelstand im Zuge der Globalisierung gegenübersieht. Es werden die wichtigsten Entwicklungen, wie Deregulierung, Globalisierung, Generationswechsel und Finanzierungsengpässe, analysiert und ihre Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von KMU dargestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Internationalisierung von KMU. Es werden die Gründe und Ziele der Internationalisierung, die Chancen und Motive sowie die Risiken und Hemmnisse für KMU beleuchtet.
Das vierte Kapitel analysiert den idealen Standort für die Internationalisierung von KMU. Es werden die Standortfaktoren von Osteuropa und China im Detail betrachtet und die Chancen und Risiken für KMU in diesen Regionen dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Internationalisierung von Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU), die Globalisierung, die Herausforderungen und Möglichkeiten des Mittelstands, die Ziele und Motive der Internationalisierung, die Risiken und Hemmnisse der Internationalisierung, die Standortfaktoren für die Internationalisierung, die Chancen und Perspektiven der Internationalisierung, Osteuropa, China, Joint-Venture.
Häufig gestellte Fragen
Warum müssen Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) internationalisieren?
Gründe sind gesättigte Inlandsmärkte, die Erschließung neuer Absatzpotenziale, die Verbesserung der Wertschöpfungskette und der Erhalt der weltweiten Wettbewerbsfähigkeit.
Welche Risiken birgt der Schritt ins Ausland für KMU?
Zu den Risiken gehören politische Instabilität, Währungsschwankungen, rechtliche Hürden, kulturelle Unterschiede und finanzielle Engpässe bei der Marktbearbeitung.
Was ist ein Joint-Venture?
Ein Joint-Venture ist ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem lokalen Partner, das KMU hilft, Risiken zu teilen und vom lokalen Markt-Know-how zu profitieren.
Warum sind Osteuropa und China attraktive Standorte?
Osteuropa bietet geografische Nähe und EU-Standards, während China durch seine enorme Marktgröße und dynamische wirtschaftliche Entwicklung besticht.
Welche Rolle spielt die Unternehmensgröße bei der Internationalisierung?
Die Größe bestimmt die verfügbaren Ressourcen und die Organisationsstruktur, was wiederum die Wahl der Internationalisierungsform (Export, Lizenzierung oder Direktinvestition) beeinflusst.
- Quote paper
- Christopher Weide (Author), 2006, Ziele, Motive, Risiken und Chancen zur Internationalisierung für Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/115440