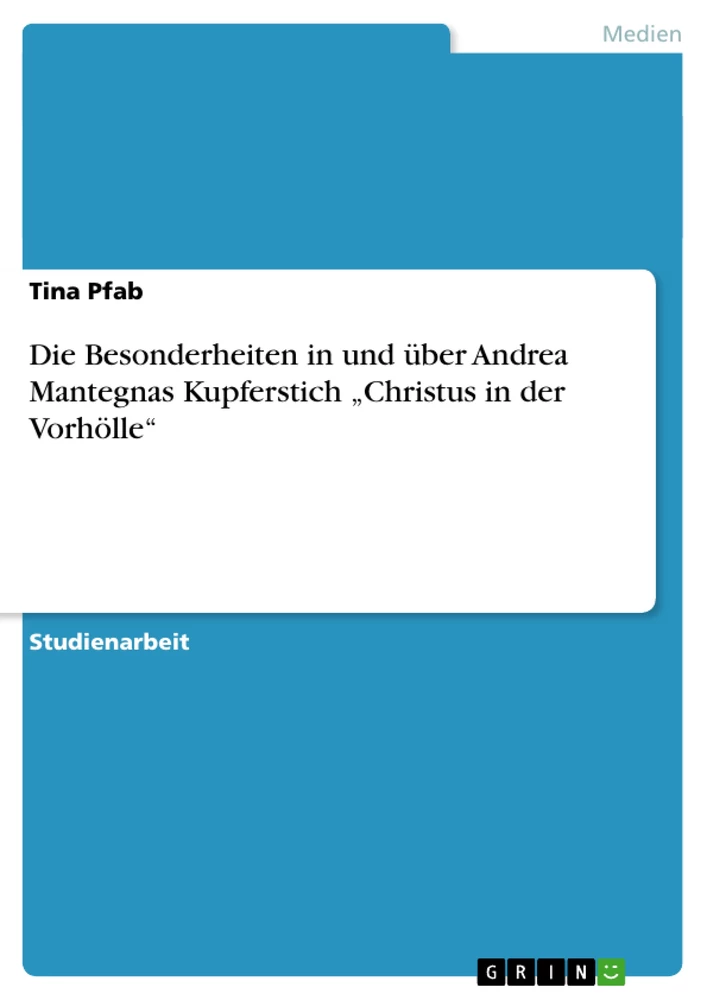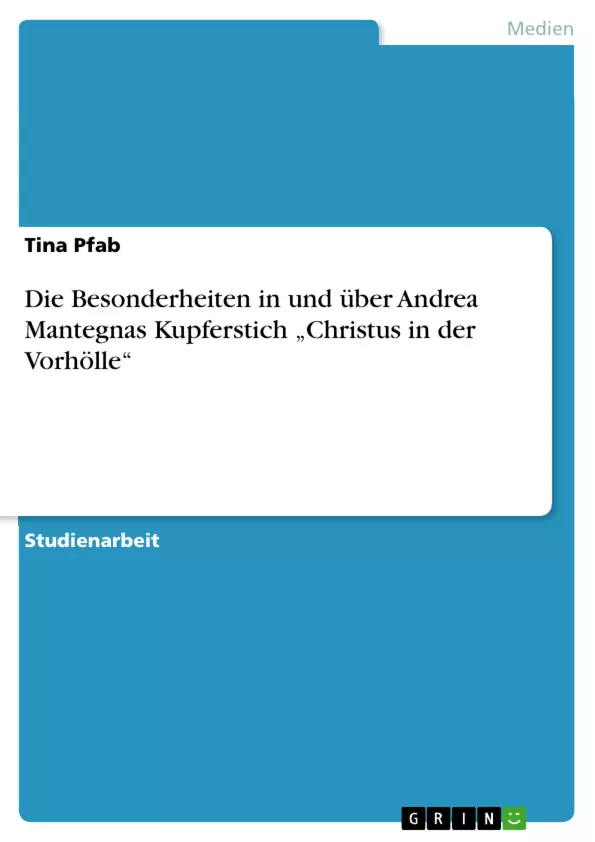Die vorliegende Arbeit betrachtet den Kupferstich „Christus in der Vorhölle“ von Andrea Mantegna (1431–1506) ,Kupferstich in brauner Druckfarbe, 42,9 x 33,6 cm, London, British Museum , Leihgabe an Berlin, Staatliche Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett, Inv.-Nr. 840-21 . In der Literatur ist der Kupferstich unter „Datierung unbekannt“ verzeichnet, aus einer anderen Quelle geht jedoch hervor, dass der Kupferstich im Zeitraum 1460/70 entstanden sein soll .
Das Bildthema kommt nicht in der Bibel vor, sondern findet im apokryphen Evangelium Inhalt, was allerdings nicht die einzige Besonderheit des Stichs ist. Mantegna soll für den Kupferstich von einem Bild von Jacopo Bellini angeregt worden sein , jedoch war das Bild J. Bellinis in der Literatur nicht zu finden, aber ein Verweis auf ein, an J. Bellini angelehntes Bild von Giovanni Bellini . Die Darstellungen der Figuren in beiden Werke weisen Ähnlichkeiten auf, allerdings auch beachtliche Unterschiede. Desweiteren gibt es drei weitere Werke Mantegnas mit religiösen Inhalt und zeitlicher Abfolge einer biblischen Szenerie, die dem Neuen Testament entstammen. Es ergibt sich die Frage nach einem Bildzyklus. Interessant ist auch die Fragestellung, ob das Werk überhaupt Mantegna zuzuschreiben ist. Es gibt abweichende Standpunkte darüber , welche in dieser Arbeit Inhalt finden werden. Aufgrund dass „Die Argumente für eine Zuschreibung des Stichs an Mantegna überwiegen.“ , wird in dieser Hausarbeit davon ausgegangen, dass besagter Kupferstich Mantegna zuzuschreiben ist. Über einen Entstehungsprozess des Kupferstiches „Christus in der Vorhölle“ sind keine näheren Informationen zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Besonderheiten IN und ÜBER Mantegnas Kupferstich „Christus in der Vorhölle“
- 2.1 Eigenheiten im Bild
- 2.1.1 Die Bildbeschreibung
- 2.1.2 Das Deutungsspektrum und die Einbettung der Szene im apokryphen Evangelium
- 2.2 Besonderheiten über den Stich und in dessen Darstellung
- 2.2.1 Das Bildthema und die angebliche Anregung durch Jacopo Bellini
- 2.2.2 Bildvergleich mit Bellinis Werk sowie dem Albrecht Dürers, die selbiges Bildthema darstellen
- 2.3 Divergente Meinungen über Zu- und Abschreibungen des Stichs an Andrea Mantegna
- 2.4 Kann der Kupferstich für einen Zyklus gedacht gewesen sein? Eine Pro- und Contradarstellung
- 2.1 Eigenheiten im Bild
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Andrea Mantegnas Kupferstich „Christus in der Vorhölle“. Ziel ist es, die Besonderheiten des Bildes, sowohl in Bezug auf seine ikonografische Darstellung als auch seine Einordnung in den Kontext der Kunstgeschichte, zu analysieren. Die Zuschreibung des Werkes an Mantegna wird kritisch beleuchtet.
- Ikonografische Analyse des Kupferstichs „Christus in der Vorhölle“
- Vergleich mit ähnlichen Werken von Jacopo und Giovanni Bellini sowie Albrecht Dürer
- Diskussion der Frage nach einem möglichen Bildzyklus
- Bewertung der Argumente für und gegen die Zuschreibung des Werkes an Mantegna
- Einordnung des Werkes in den Kontext des apokryphen Evangeliums
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kupferstich „Christus in der Vorhölle“ von Andrea Mantegna vor und skizziert die Forschungsfragen der Arbeit. Sie benennt die Herausforderungen bei der Datierung und Zuschreibung des Werkes und kündigt die bevorstehende detaillierte Bildanalyse und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Interpretationsansätzen an. Die Einleitung betont die Notwendigkeit, die ikonografischen Besonderheiten des Stichs zu untersuchen und seine mögliche Einbettung in einen größeren Zyklus zu diskutieren.
2. Die Besonderheiten IN und ÜBER Andrea Mantegnas Kupferstich „Christus in der Vorhölle“: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und widmet sich einer eingehenden Analyse von Mantegnas Kupferstich. Es beginnt mit einer detaillierten Beschreibung der Bildkomposition, der Figuren und ihrer Darstellung, inklusive der Besonderheiten des Höllentores. Anschließend wird das Bildthema im Kontext des apokryphen Nikodemus-Evangeliums interpretiert, wobei die Bedeutung der einzelnen Elemente im Bild im Lichte der biblischen und ikonografischen Traditionen erläutert wird. Ein Vergleich mit ähnlichen Werken anderer Künstler, insbesondere Jacopo Bellini und Albrecht Dürer, dient dazu, die Einzigartigkeit von Mantegnas Werk hervorzuheben und seine stilistischen Besonderheiten zu beleuchten. Das Kapitel untersucht kritisch die divergierenden Meinungen bezüglich der Authentizität des Werkes und erörtert die Frage, ob der Kupferstich Teil eines größeren Zyklus gewesen sein könnte.
Schlüsselwörter
Andrea Mantegna, Kupferstich, „Christus in der Vorhölle“, Nikodemus-Evangelium, Apokryphe Evangelien, Ikonographie, Bildanalyse, Jacopo Bellini, Albrecht Dürer, Bildzyklus, Authentizität, Kunst um 1500.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu „Andrea Mantegnas Kupferstich „Christus in der Vorhölle““
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert den Kupferstich „Christus in der Vorhölle“, der Andrea Mantegna zugeschrieben wird. Im Mittelpunkt steht die detaillierte Untersuchung der ikonografischen Besonderheiten des Bildes, seine Einordnung in die Kunstgeschichte und die kritische Auseinandersetzung mit der Zuschreibung an Mantegna.
Welche Aspekte werden im Detail behandelt?
Die Arbeit umfasst eine detaillierte Bildbeschreibung, die Interpretation des Bildthemas im Kontext des apokryphen Nikodemus-Evangeliums, einen Vergleich mit ähnlichen Werken von Jacopo Bellini und Albrecht Dürer, eine Diskussion über die Authentizität des Werkes und die Frage nach einer möglichen Zugehörigkeit zu einem größeren Bildzyklus.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: 1. Einleitung, 2. Die Besonderheiten IN und ÜBER Mantegnas Kupferstich „Christus in der Vorhölle“ (mit Unterkapiteln zur Bildbeschreibung, Deutung im Kontext des apokryphen Evangeliums, Vergleich mit Werken anderer Künstler, Diskussion der Zuschreibung und der Frage nach einem möglichen Zyklus) und 3. Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Besonderheiten von Mantegnas Kupferstich „Christus in der Vorhölle“ zu analysieren, sowohl in Bezug auf seine ikonografische Darstellung als auch seine Einordnung in den Kontext der Kunstgeschichte. Die kritische Prüfung der Zuschreibung des Werkes an Mantegna ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die relevantesten Schlüsselwörter sind: Andrea Mantegna, Kupferstich, „Christus in der Vorhölle“, Nikodemus-Evangelium, Apokryphe Evangelien, Ikonographie, Bildanalyse, Jacopo Bellini, Albrecht Dürer, Bildzyklus, Authentizität, Kunst um 1500.
Wie wird der Kupferstich in die Kunstgeschichte eingeordnet?
Die Arbeit vergleicht den Kupferstich mit ähnlichen Werken von Jacopo Bellini und Albrecht Dürer, um die Einzigartigkeit und die stilistischen Besonderheiten von Mantegnas Werk zu beleuchten und seine Position innerhalb der Kunstgeschichte des späten 15. Jahrhunderts zu bestimmen.
Wird die Authentizität des Werkes diskutiert?
Ja, die Arbeit befasst sich kritisch mit den divergierenden Meinungen bezüglich der Authentizität des Kupferstichs und analysiert die Argumente für und gegen die Zuschreibung an Andrea Mantegna.
Spielt das apokryphe Evangelium eine Rolle in der Analyse?
Ja, die Interpretation des Bildthemas im Kontext des apokryphen Nikodemus-Evangeliums ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit. Die Bedeutung der einzelnen Bildelemente wird im Lichte der biblischen und ikonografischen Traditionen erläutert.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Punkte und Ergebnisse jedes Kapitels prägnant zusammenfasst.
Wird die Frage nach einem möglichen Bildzyklus behandelt?
Ja, die Arbeit untersucht die Frage, ob der Kupferstich Teil eines größeren Zyklus gewesen sein könnte. Es werden Pro- und Contra-Argumente dargestellt.
- Quote paper
- Tina Pfab (Author), 2007, Die Besonderheiten in und über Andrea Mantegnas Kupferstich „Christus in der Vorhölle“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/115358