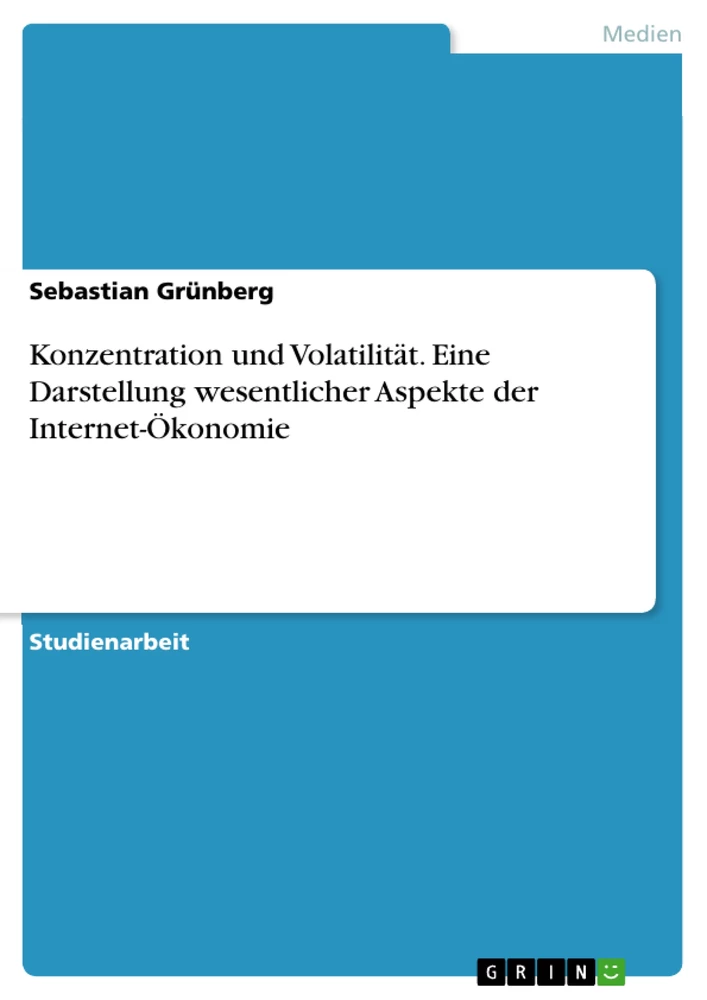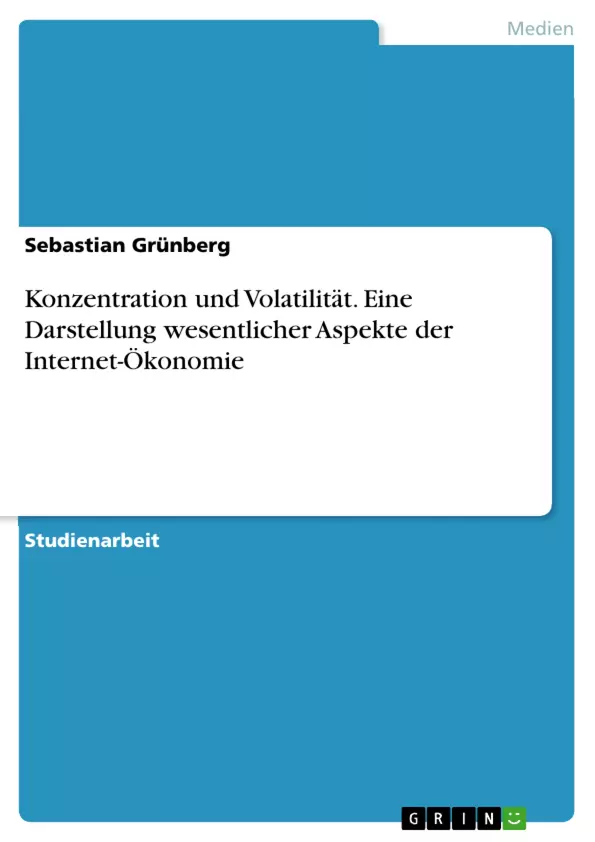Welche Eigenschaften der Internet-Ökonomie führen zu der beobachtbaren starken Marktkonzentration? Um diese Fragestellung zu beantworten, wird diese Arbeit in zwei Abschnitte unterteilt: Im ersten Abschnitt werden zunächst die zentralen Begriffe – digitale Güter und (digitale) Märkte und Plattformen – aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive definiert und zueinander in Beziehung gesetzt. Es werden die besonderen Eigenschaften digitaler Güter und Märkte und die hieraus resultierenden Tendenzen zur Marktkonzentration dargestellt. Zum Abschluss des ersten Abschnitts werden anhand der beschriebenen Charakteristika die beiden gegenläufigen Tendenzen der Internet-Ökonomie – Konzentration und Volatilität – beschrieben.
Die im ersten Abschnitt thematisierten Inhalte werden im zweiten Abschnitt in Form der ‚Plattformlogik‘ systematisiert und in einer Typologie der Internet-Ökonomie zusammengefasst. In einem abschließenden Resümee werden die Argumente aus beiden Teilen thesenförmig im Hinblick auf die Fragestellung dieser Arbeit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Digitale Güter
- (Digitale) Märkte und Plattformen
- "Winner-takes-it-all"-Phänomen
- Kritische Masse Phänomen
- Konzentration und Volatilität
- Konzentration
- Volatilität
- Plattformlogik
- Lösung etablierter Kopplungen
- Die Ordnung digitaler Märkte
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Eigenschaften der Internet-Ökonomie zu der beobachtbaren starken Marktkonzentration führen. Sie untersucht die zentralen Begriffe digitale Güter und (digitale) Märkte und Plattformen aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive. Ziel ist es, die besonderen Eigenschaften digitaler Güter und Märkte sowie die daraus resultierenden Tendenzen zur Marktkonzentration darzustellen.
- Die besonderen Eigenschaften digitaler Güter und ihre Auswirkungen auf die Internet-Ökonomie.
- Die Dynamik von (digitalen) Märkten und Plattformen und das "Winner-takes-it-all"-Phänomen.
- Die Rolle von Konzentration und Volatilität in der Internet-Ökonomie.
- Die Plattformlogik und ihre Bedeutung für die Ordnung digitaler Märkte.
- Die Relevanz der Internet-Ökonomie für gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet den Einfluss moderner Informations- und Kommunikationstechnologien auf Gesellschaft und Wirtschaft. Es stellt die Frage, ob die Internet-Ökonomie durch Dezentralisierung, Demokratisierung und Kooperation oder eher durch Konzentration, Kontrolle und Macht geprägt ist. Das zweite Kapitel definiert die zentralen Begriffe "digitale Güter" und "(digitale) Märkte und Plattformen" und analysiert deren besondere Eigenschaften. Es werden die "Winner-takes-it-all"- und "Kritische Masse"-Phänomene sowie die Tendenzen zur Marktkonzentration betrachtet. Im dritten Kapitel wird die Plattformlogik als Systematisierungsrahmen für die Internet-Ökonomie vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Internet-Ökonomie und beleuchtet dabei insbesondere die Themen Digitale Güter, Märkte und Plattformen, Konzentration, Volatilität, Plattformlogik und "Winner-takes-it-all"-Phänomen.
- Quote paper
- Sebastian Grünberg (Author), 2021, Konzentration und Volatilität. Eine Darstellung wesentlicher Aspekte der Internet-Ökonomie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1146794