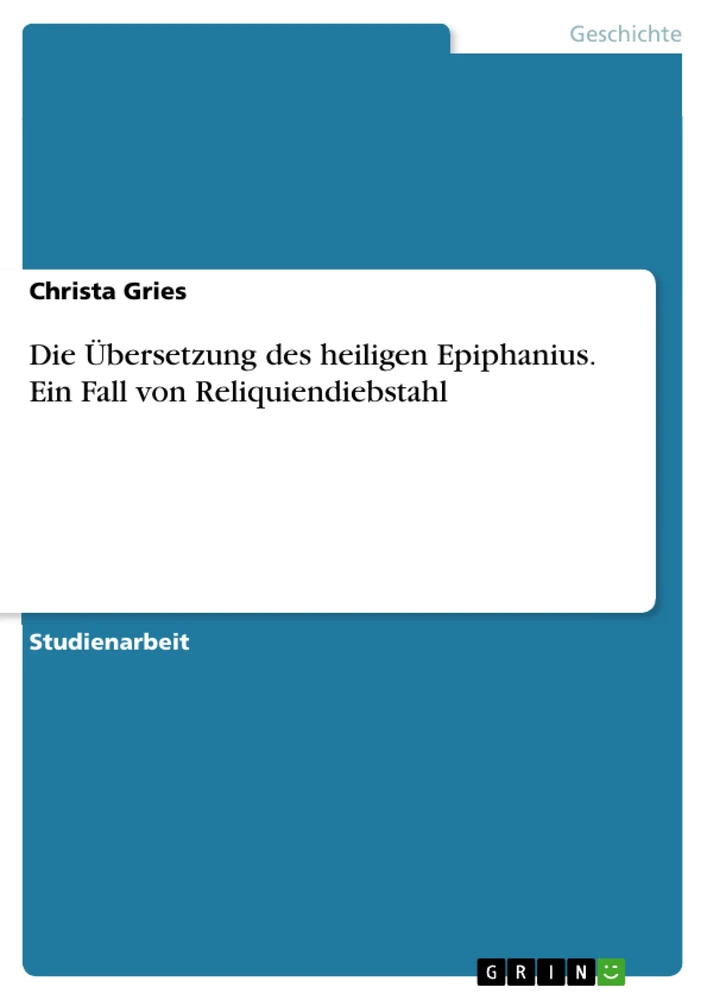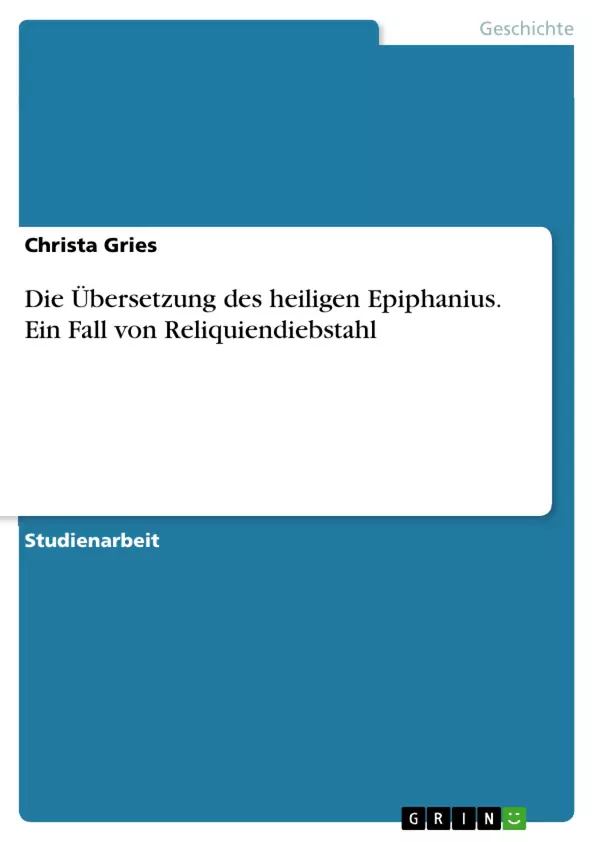Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Problemen der Hagiografie und untersucht des heiligen Epiphanius im Rahmen des historischen Kontexts auf ihre Glaubwürdigkeit. Dabei steht die folgende Frage im Mittelpunkt der Analyse: Wie hoch ist danach der Wahrheitsgehalt der "translatio sancti Epiphanii" einzuschätzen und welcher glaubwürdige Kern könnte sich hinter der Geschichte verbergen?
Mit seinem zweiten Italienzug von 961 bis 965 bereitete Otto I. die Szenerie für die Geschichte. Nach der Kaiserkrönung am 2.2.962 befand er sich mit seinem Heer im gerade von der erneuten Usurpation Berengars II. befreiten Pavia. In seinem Gefolge befanden sich fast ausschließlich Reichsbischöfe und Äbte, die aufgrund des "servitium regis" am Feldzug teilnehmen und berittene Krieger zur Verfügung stellen mussten. Während der Kaiser mit der Belagerung des im Gebirge verschanzten Feindes beschäftigt war, hatten die Geistlichen in seinem Tross Gelegenheit zur Reliquienbeschaffung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellen, Forschungsliteratur und Vorgehensweise
- WEITERE QUELLEN
- FORSCHUNGSLITERATUR
- VORGEHENSWEISE
- Der historische Kontext
- DIE TÄTER: DAS BISTUM HILDESHEIM, BISCHOF OTHWIN UND THANGWARD
- DIE OPFER: DAS BISTUM PAVIA UND DER HEILIGE EPIPHANIUS
- DER RELIQUIENJÄGER: OTTO DER GROßE
- ÜBERLIEFERUNG, AUTOR UND MÖGLICHE CAUSA SCRIBENDI
- Untersuchung der Quelle auf den Wahrheitsgehalt
- PHASE 1: PLAN, ZEICHEN, FEHLSCHLÄGE, ERFOLG
- PHASE 2: ÜBERFÜHRUNG, GEFAHREN, REISEWUNDER
- PHASE 3: TRIUMPHALE ANKUNFT, GRABLEGE UND BESTÄTIGUNGSWUNDER
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Translatio sancti Epiphanii, eine Quelle, die den Raub der Reliquien des heiligen Epiphanius aus Pavia nach Hildesheim beschreibt. Ziel ist es, den Wahrheitsgehalt dieser Quelle zu überprüfen und den historischen Kontext des Ereignisses zu beleuchten.
- Die Beschaffung von Heiligenreliquien im 10. Jahrhundert
- Die Rolle von Bischof Othwin und Kaiser Otto I.
- Die Analyse der Translatio sancti Epiphanii als historische Quelle
- Die Bedeutung von Reliquien für die Herrschaftsausübung
- Der Vergleich mit anderen Fällen von Reliquienraub im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Wahrheitsgehalt der Translatio sancti Epiphanii (TSE) in Bezug auf den angeblichen Diebstahl der Reliquien des heiligen Epiphanius. Sie präsentiert das Reliquiar des heiligen Epiphanius im Hildesheimer Dom und skizziert den Forschungsstand, wobei die Diskrepanz zwischen der TSE und anderen Quellen hervorgehoben wird. Die Einleitung legt den Fokus auf die kontroverse Natur des Ereignisses und die unterschiedlichen Interpretationen seiner Legitimität.
1. Quellen, Forschungsliteratur und Vorgehensweise: Dieses Kapitel beschreibt die verwendeten Quellen, darunter die TSE, die Annalen Hildesheims und weitere Chroniken. Es analysiert die Forschungsliteratur zum Thema Reliquienraub und -translation im Mittelalter und erläutert die methodische Vorgehensweise der Arbeit, insbesondere die kritische Auseinandersetzung mit der TSE und der Einordnung des Ereignisses in den historischen Kontext.
2. Der historische Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Hintergrund des Ereignisses. Es beschreibt die Akteure: das Bistum Hildesheim mit Bischof Othwin und Thangward, das Bistum Pavia als Opfer und Kaiser Otto I. als möglichen Auftraggeber oder zumindest Nutznießer. Es analysiert die Machtverhältnisse und die Bedeutung von Reliquien im Kontext der ottonischen Herrschaft. Die Untersuchung der Überlieferung, des Autors der TSE und der möglichen Gründe für die Niederschrift der Quelle bildet einen weiteren Schwerpunkt.
3. Untersuchung der Quelle auf den Wahrheitsgehalt: Das Kapitel analysiert die TSE nach den von Geary entwickelten hagiographischen Topoi, gliedert die Erzählung in drei Phasen (Planung, Überführung, Ankunft) und untersucht die dargestellten Ereignisse auf ihre Glaubwürdigkeit. Es werden Widersprüche und Ungereimtheiten in der Quelle aufgezeigt und mit anderen Quellen verglichen. Die Behauptung eines vollständigen Diebstahls des Leichnams wird kritisch hinterfragt und anhand von Gegenbelegen widerlegt.
Schlüsselwörter
Heiligenreliquien, Reliquienraub, Translatio sancti Epiphanii, Bischof Othwin, Kaiser Otto I., Bistum Hildesheim, Bistum Pavia, Mittelalter, hagiographische Topoi, Quellenkritik, Herrschaftsausübung.
Häufig gestellte Fragen zur Translatio sancti Epiphanii
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Translatio sancti Epiphanii, eine Quelle, die den Raub der Reliquien des heiligen Epiphanius aus Pavia nach Hildesheim beschreibt. Das zentrale Anliegen ist die Überprüfung des Wahrheitsgehalts dieser Quelle und die Einordnung des Ereignisses in seinen historischen Kontext.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Quellen, darunter die Translatio sancti Epiphanii selbst, die Annalen Hildesheims und weitere Chroniken. Die Forschungsliteratur zum Thema Reliquienraub und -translation im Mittelalter wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit wendet eine kritische Quellenanalyse an, wobei die Translatio sancti Epiphanii im Detail untersucht und mit anderen Quellen verglichen wird. Das Ereignis wird in seinen historischen Kontext eingeordnet, um den Wahrheitsgehalt der Darstellung zu beurteilen.
Wer sind die wichtigsten Akteure?
Die wichtigsten Akteure sind das Bistum Hildesheim mit Bischof Othwin und Thangward, das Bistum Pavia als Opfer des Reliquienraubs, und Kaiser Otto I., dessen Rolle als möglicher Auftraggeber oder Nutznießer untersucht wird.
Welche Aspekte des historischen Kontextes werden beleuchtet?
Der historische Kontext umfasst die Beschaffung von Heiligenreliquien im 10. Jahrhundert, die Rolle von Bischof Othwin und Kaiser Otto I., die Machtverhältnisse und die Bedeutung von Reliquien für die ottonische Herrschaft.
Wie wird der Wahrheitsgehalt der Quelle untersucht?
Die Analyse der Translatio sancti Epiphanii erfolgt anhand von Geary's hagiographischen Topoi. Die Erzählung wird in drei Phasen (Planung, Überführung, Ankunft) gegliedert, und die dargestellten Ereignisse werden auf ihre Glaubwürdigkeit hin überprüft. Widersprüche und Ungereimtheiten werden aufgezeigt und mit anderen Quellen verglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Heiligenreliquien, Reliquienraub, Translatio sancti Epiphanii, Bischof Othwin, Kaiser Otto I., Bistum Hildesheim, Bistum Pavia, Mittelalter, hagiographische Topoi, Quellenkritik, Herrschaftsausübung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Quellen, der Forschungsliteratur und der Vorgehensweise, ein Kapitel zum historischen Kontext, ein Kapitel zur Untersuchung des Wahrheitsgehalts der Quelle und ein Fazit.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist im bereitgestellten Text nicht explizit zusammengefasst, aber es lässt sich ableiten, dass die Arbeit eine kritische Auseinandersetzung mit dem Wahrheitsgehalt der Translatio sancti Epiphanii liefert und das Ereignis im Kontext der ottonischen Herrschaft und des Reliquienkults des Mittelalters einordnet.)
Wo finde ich die vollständige Arbeit?
(Diese Information fehlt im bereitgestellten Text.)
- Quote paper
- Christa Gries (Author), 2021, Die Übersetzung des heiligen Epiphanius. Ein Fall von Reliquiendiebstahl, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1145875