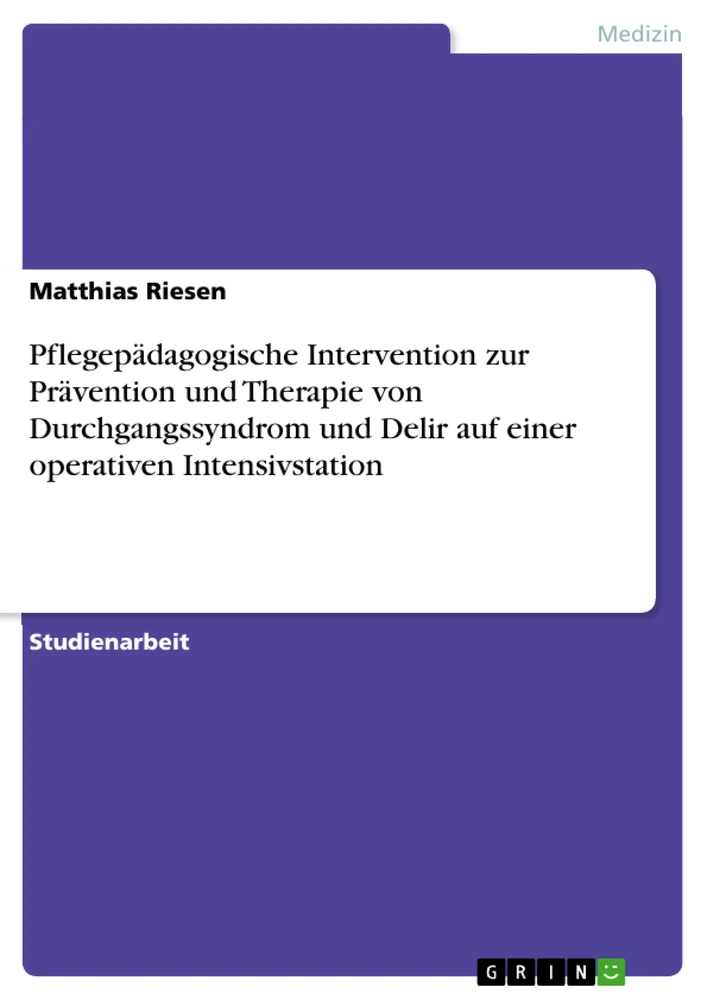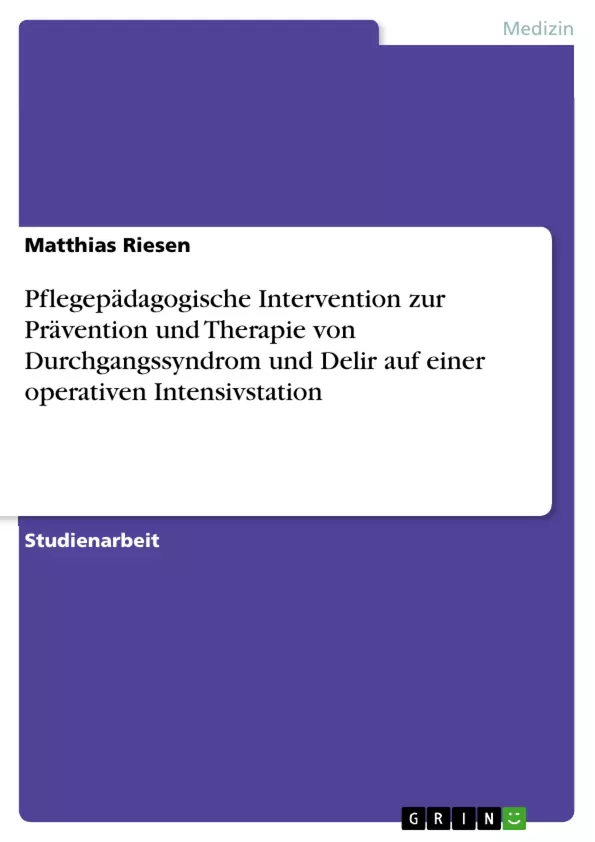In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit pflegepädagogische Handlungen auf das Erleben und Verhalten von Patienten im Durchgangssyndrom oder Delir auf einer operativen Intensivstation Einfluss nehmen können. Falls dies der Fall ist, wird zu prüfen sein, ob diesem Einfluss auch ein präventiver Charakter obliegt. Dieses setzt voraus, dass grundsätzlich ein erzieherischer Anspruch der Krankenpflege gegenüber dem Patienten besteht. Auch dieser Frage soll nachgegangen werden.
Darüber hinaus soll eine Hilfe für all diejenigen gegeben werden, die mit der Pflege und Betreuung von akut deliranten Patienten im Intensivbereich beauftragt sind, um ein umfassenderes Verständnis für die Situation dieser Patienten zu erlangen. Dazu sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, den Umgang mit diesen Patienten, im Interesse der Kranken und auch im Interesse der Pflegenden, produktiver zu gestalten.
Es wird davon ausgegangen, dass bei der Entstehung des Durchgangssyndroms ein multifaktorieller Ursachenkomplex vorliegt. Da das Pflegepersonal intensivsten Kontakt zum Patienten hat, könnten sich Möglichkeiten ergeben, auf Ursachen direkt oder indirekt Einfluss zu nehmen. Es wird erwartet, dass gerade bei der Abwendung eines drohenden Durchgangssyndroms eine professionell durchgeführte pflegepädagogische Intervention von großer Bedeutung ist.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Gang der Untersuchung
- 3. Medizinische Aspekte des Durchgangssyndroms und Delir
- 3.1 Definition und Abgrenzung
- 3.2 Symptomatik des Durchgangssyndroms
- 3.3 Ursachen für die Entstehung von Durchgangssyndromen
- 3.4 Therapie des Durchgangssyndroms
- 4. Intensivmedizin- und Pflege aus Patientensicht
- 4.1 Persönliche Situation
- 4.2 Psychisch belastende Faktoren
- 4.3 Individuelle Wahrnehmung und Emotionen
- 5. Pflegerische Aspekte des Durchgangssyndroms
- 5.1 Zustandsbild und Verlauf eines akut verwirrten Patienten
- 5.2 Pflegerische Probleme mit akut verwirrten Patienten
- 5.3 Komplikationen von Durchgangssyndromen und Delirien
- 6. Erziehung und Krankenpflege
- 6.1 Definition von Erziehung im berufspädagogischen Kontext
- 6.2 Gemeinsamkeiten von Erziehung und Krankenpflege
- 6.3 Potenzen von Erziehung in der Krankenpflege
- 6.4 Pädagogisches Arbeitsfeld des Pflegepersonals bezogen auf das Durchgangssyndrom
- 6.5 Legitimation eines Erziehungsanspruchs
- 6.6 Autonomie von Pflege
- 7. Pflegepädagogische Maßnahmen zur Prävention und Therapie des Durchgangssyndroms
- 7.1 Allgemeines
- 7.2 Pflegerische Diagnose
- 7.3 Basale Stimulation als Präventivmaßnahme und Therapie
- 7.4 Die klientenzentrierte Gesprächsführung
- 7.5 Validation im Umgang mit akut verwirrten Patienten
- 8. Zusammenfassung, abschließende Wertung und Ausblick auf weiterführende Fragestellungen
- 8.1 Zusammenfassung
- 8.2 Abschließende Wertung
- 8.3 Ausblick auf weiterführende Fragestellungen
- 9. Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss pflegepädagogischer Interventionen auf Patienten mit Durchgangssyndrom und Delir auf einer operativen Intensivstation. Ziel ist es, den präventiven Charakter solcher Interventionen zu beleuchten und Handlungsempfehlungen für die Pflegepraxis zu entwickeln. Die Arbeit befasst sich mit der Frage nach einem berechtigten erzieherischen Anspruch der Krankenpflege und analysiert Möglichkeiten, den Umgang mit akut deliranten Patienten zu verbessern.
- Der Einfluss pflegepädagogischer Maßnahmen auf das Erleben und Verhalten von Patienten mit Durchgangssyndrom und Delir.
- Der präventive Charakter pflegepädagogischer Interventionen.
- Die Legitimation eines erzieherischen Anspruchs der Krankenpflege.
- Die Verbesserung des Umgangs mit akut deliranten Patienten auf Intensivstationen.
- Die Analyse der individuellen Wahrnehmung und Emotionen von Patienten auf der Intensivstation.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Motivation des Autors, sich mit dem Durchgangssyndrom auf operativen Intensivstationen auseinanderzusetzen. Es wird die Forschungsfrage formuliert, die den Einfluss pflegepädagogischer Interventionen auf das Erleben und Verhalten betroffener Patienten sowie den präventiven Charakter dieser Interventionen untersucht. Darüber hinaus wird die Notwendigkeit eines erzieherischen Anspruchs der Krankenpflege thematisiert und das Ziel einer verbesserten Patientenversorgung im Fokus der Arbeit genannt.
3. Medizinische Aspekte des Durchgangssyndroms und Delir: Dieses Kapitel definiert und grenzt die Begriffe Durchgangssyndrom und Delir voneinander ab. Es werden die medizinischen Ursachen, Symptome und Therapiemaßnahmen dieser Zustände umfassend dargestellt. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des medizinischen Hintergrundes, der als Grundlage für das Verständnis der pflegepädagogischen Aspekte dient. Die Darstellung der Symptomatik liefert wichtige Informationen für die spätere Analyse der pflegerischen Herausforderungen.
4. Intensivmedizin- und Pflege aus Patientensicht: Dieses Kapitel beleuchtet die subjektive Erfahrung von Patienten auf einer operativen Intensivstation. Es werden Faktoren beschrieben, die sich positiv oder negativ auf die Psyche der Patienten auswirken können, um ein umfassenderes Verständnis ihrer Situation zu schaffen. Die Perspektive des Patienten wird hier in den Mittelpunkt gerückt, um den Kontext der pflegepädagogischen Interventionen zu verdeutlichen und die Notwendigkeit einer patientenzentrierten Pflege zu betonen.
5. Pflegerische Aspekte des Durchgangssyndroms: Dieses Kapitel beschreibt das Zustandsbild und den Verlauf eines akut verwirrten Patienten. Es werden die pflegerischen Probleme im Umgang mit diesen Patienten aus verschiedenen Perspektiven detailliert analysiert und mögliche Komplikationen von Durchgangssyndromen und Delirien erläutert. Das Kapitel stellt die Herausforderungen heraus, mit denen das Pflegepersonal konfrontiert ist und bildet eine Basis für die Diskussion der pflegepädagogischen Interventionen.
6. Erziehung und Krankenpflege: Dieses Kapitel untersucht die Frage nach einem berechtigten erzieherischen Anspruch der Krankenpflege. Es analysiert Gemeinsamkeiten von Erziehung und Krankenpflege sowie Potenziale, die eine Legitimation eines solchen Anspruchs darstellen. Es wird das pädagogische Arbeitsfeld des Pflegepersonals im Kontext des Durchgangssyndroms beleuchtet und die Autonomie der Pflege in diesem Kontext thematisiert. Dieses Kapitel bildet die theoretische Grundlage für die Diskussion der pflegepädagogischen Maßnahmen im folgenden Kapitel.
7. Pflegepädagogische Maßnahmen zur Prävention und Therapie des Durchgangssyndroms: Dieses Kapitel stellt verschiedene pflegepädagogische Maßnahmen zur Prävention und Therapie des Durchgangssyndroms vor. Es beschreibt allgemeine Strategien, die Bedeutung der pflegerischen Diagnose und stellt konkrete Methoden wie basale Stimulation, klientenzentrierte Gesprächsführung und Validation im Umgang mit akut verwirrten Patienten vor. Dieses Kapitel liefert praktische Handlungsempfehlungen für das Pflegepersonal.
Schlüsselwörter
Durchgangssyndrom, Delir, operative Intensivstation, Pflegepädagogik, präventive Intervention, therapeutische Intervention, Klientenzentrierung, Basale Stimulation, Validation, Erziehung in der Krankenpflege, Patientenperspektive, pflegerische Probleme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Pflegepädagogische Interventionen bei Durchgangssyndrom und Delir auf der operativen Intensivstation
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss pflegepädagogischer Interventionen auf Patienten mit Durchgangssyndrom und Delir auf einer operativen Intensivstation. Im Fokus steht der präventive Charakter solcher Interventionen und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Pflegepraxis. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Frage nach der Legitimation eines erzieherischen Anspruchs in der Krankenpflege und die Verbesserung des Umgangs mit akut deliranten Patienten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: den Einfluss pflegepädagogischer Maßnahmen auf das Erleben und Verhalten betroffener Patienten; den präventiven Charakter dieser Interventionen; die Legitimation eines erzieherischen Anspruchs der Krankenpflege; die Verbesserung des Umgangs mit akut deliranten Patienten auf Intensivstationen; und die Analyse der individuellen Wahrnehmung und Emotionen von Patienten auf der Intensivstation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in verschiedene Kapitel: Einleitung, Gang der Untersuchung, medizinische Aspekte des Durchgangssyndroms und Delirs, Intensivmedizin und Pflege aus Patientensicht, pflegerische Aspekte des Durchgangssyndroms, Erziehung und Krankenpflege, pflegepädagogische Maßnahmen zur Prävention und Therapie, Zusammenfassung, abschließende Wertung und Ausblick, sowie Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit der Definition und Abgrenzung der Begriffe bis hin zu konkreten Handlungsempfehlungen.
Welche medizinischen Aspekte des Durchgangssyndroms und Delirs werden beleuchtet?
Das Kapitel zu den medizinischen Aspekten definiert und grenzt Durchgangssyndrom und Delir ab. Es beschreibt die Ursachen, Symptome und Therapiemaßnahmen dieser Zustände. Der Fokus liegt auf dem medizinischen Hintergrundwissen, das für das Verständnis der pflegepädagogischen Aspekte unerlässlich ist.
Wie wird die Patientensicht berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die subjektive Erfahrung von Patienten auf der Intensivstation. Sie beschreibt Faktoren, die die Psyche der Patienten beeinflussen, um ein umfassendes Verständnis ihrer Situation zu ermöglichen. Die Patientenperspektive dient zur Verdeutlichung des Kontexts der pflegepädagogischen Interventionen und betont die Notwendigkeit einer patientenzentrierten Pflege.
Welche pflegerischen Aspekte werden behandelt?
Der pflegerische Aspekt umfasst das Zustandsbild und den Verlauf akut verwirrter Patienten, die damit verbundenen pflegerischen Probleme und mögliche Komplikationen. Es werden die Herausforderungen für das Pflegepersonal dargestellt, die als Grundlage für die Diskussion der pflegepädagogischen Interventionen dienen.
Wie wird die Frage nach einem erzieherischen Anspruch der Krankenpflege behandelt?
Die Arbeit untersucht die Legitimation eines erzieherischen Anspruchs in der Krankenpflege. Sie analysiert Gemeinsamkeiten von Erziehung und Krankenpflege, deren Potenziale und das pädagogische Arbeitsfeld des Pflegepersonals im Kontext des Durchgangssyndroms. Die Autonomie der Pflege wird in diesem Zusammenhang ebenfalls thematisiert.
Welche pflegepädagogischen Maßnahmen werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene pflegepädagogische Maßnahmen zur Prävention und Therapie des Durchgangssyndroms. Dies umfasst allgemeine Strategien, die Bedeutung der pflegerischen Diagnose und konkrete Methoden wie basale Stimulation, klientenzentrierte Gesprächsführung und Validation.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Durchgangssyndrom, Delir, operative Intensivstation, Pflegepädagogik, präventive Intervention, therapeutische Intervention, Klientenzentrierung, Basale Stimulation, Validation, Erziehung in der Krankenpflege, Patientenperspektive und pflegerische Probleme.
Welche Schlussfolgerungen und Ausblicke werden gegeben?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen, bewertet diese und gibt einen Ausblick auf weiterführende Fragestellungen. Sie liefert somit einen Beitrag zum Verständnis und zur Verbesserung der Versorgung von Patienten mit Durchgangssyndrom und Delir auf Intensivstationen.
- Quote paper
- Matthias Riesen (Author), 2000, Pflegepädagogische Intervention zur Prävention und Therapie von Durchgangssyndrom und Delir auf einer operativen Intensivstation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1144055