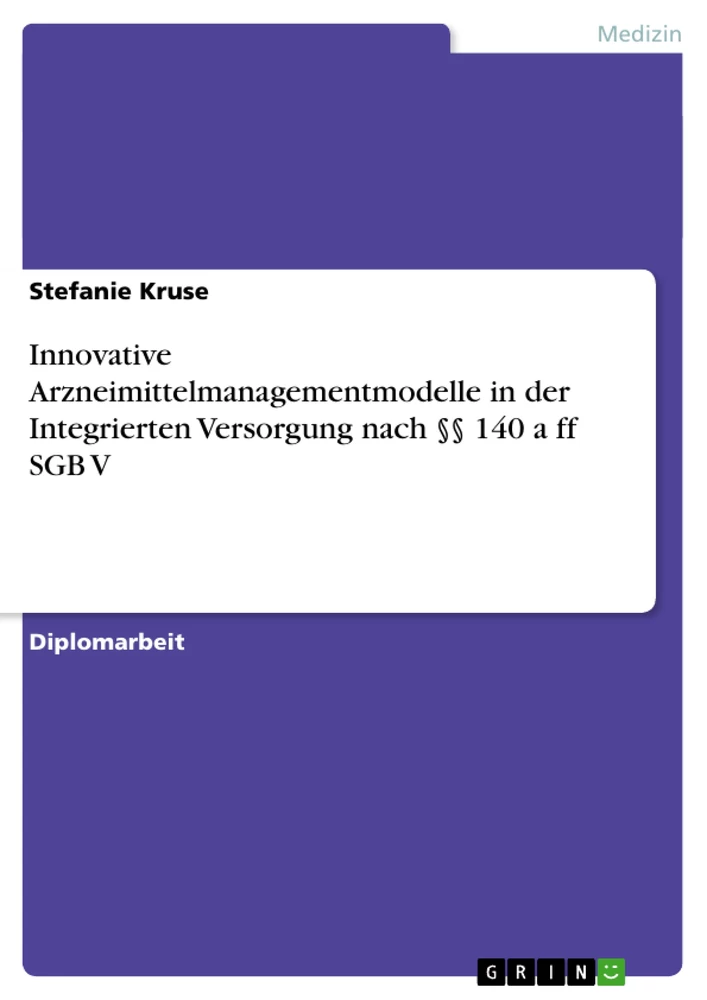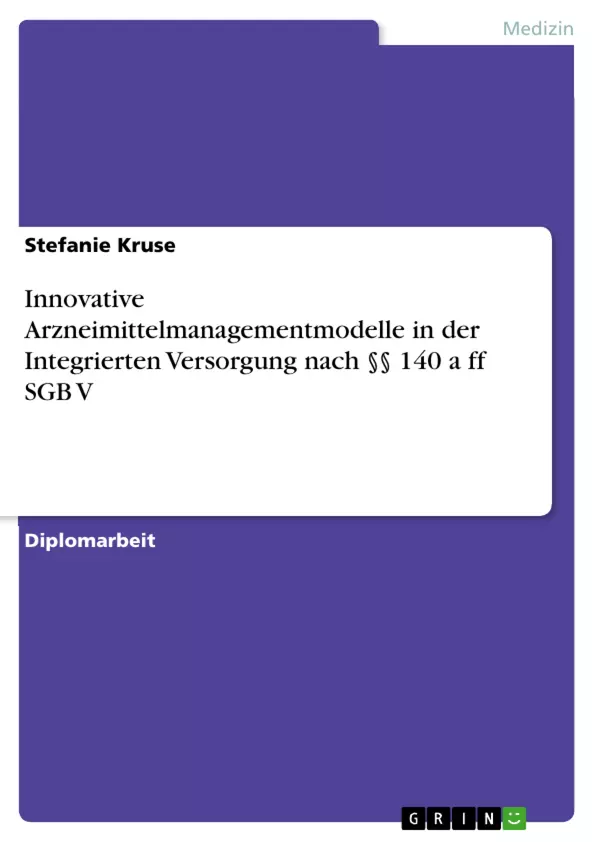Die Diplomarbeit „Innovative Arzneimittelmanagementmodelle in der Integrierten Versorgung nach §§ 140 a ff SGB V“ beschreibt die neu entstandene Situation im deutschen Gesundheitswesen nach Verabschiedung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetztes) zum 1. Januar 2004 und konzentriert sich daraufhin besonders auf die „Integrierten Versorgung“ sowie die Möglichkeiten der pharmazeutischen Industrie durch neuartige Arzneimittelmanagementmodelle an dieser speziellen Versorgungsform teilzunehmen. Das Anliegen, die Arzneimittelversorgung inDeutschland im Rahmen dieser neuen Gesetzeslage zu optimieren, steht hier im Mittelpunkt der Überlegungen. Dabei stellt sich die pharmazeutische Industrie nicht länger nur als reiner Arzneimittel-Produzent und Distribuent dar, sondern kann als Anbieter von innovativen Versorgungskonzepten einen ganz neuen Beitrag zur Optimierung der Patientenversorgung in Deutschland leisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1.1 Aufbau und Zielsetzung dieser Diplomarbeit
- 1.2 Aktuelle Situation
- 1.3 GKV-Modernisierungsgesetz
- 1.3.1 Struktur, Ziele und Auswirkungen des GMG
- Integrierte Versorgung
- 2.1 Begriffserklärung Integrierte Versorgung
- 2.2 Anwendungsbereich
- 2.3 Gesetzesgrundlage SGB V „Integrierte Versorgung“
- 2.3.1 § 140 a „Integrierte Versorgung“
- 2.3.2 § 140 b „Verträge zu integrierten Versorgungsformen“
- 2.3.3 § 140 c „Vergütung“
- 2.3.4 § 140 d „Anschubfinanzierung, Bereinigung“
- 2.4 Möglichkeiten für pharmazeutische Unternehmen in der IV mitzuwirken
- 2.4.1 § 130 SGB V „Rabatt“
- 2.4.2 § 130 a SGB V „Rabatte der pharmazeutischen Unternehmen“
- Arzneimittelmarkt
- 3.1 Rechtsbereiche im Arzneimittelmarkt
- 3.2 Regulierungsformen des Arzneimittelmarktes
- 3.3 Preisbildung von Arzneimitteln
- 3.3.1 Herstellerzwangsrabatt (§ 130 a SGB V)
- 3.3.2 Arzneimittelfestbeträge (§ 35 SGB V)
- 3.3.3 Arzneimittelbudgets / Richtgrößen / Regress
- 3.3.4 Parallelimporte (§ 129 Abs. 1 Nr. 2 SGB V)
- 3.3.5 Zuzahlungen (§ 61 SGB V)
- 3.3.6 Aut Idem (§ 129 Abs. 1 Nr. 1 SGB V)
- 3.4 Erstattung von Arzneimitteln
- 3.5 Arzneimittelausgaben der GKV
- 3.5.1 Komponenten der Arzneimittelausgaben
- 3.5.2 Arzneimittelausgaben der GKV 2004
- 3.6 Veränderungen durch das GMG
- 3.6.1 Für den Patienten
- 3.6.2 Für die Industrie
- 3.6.3 Für Apotheken
- 3.6.4 Im Arzneimittelverordnungsprozess
- Arzneimittelmanagement-Modelle
- 4.1 Anforderungen an Arzneimittelmanagement-Modelle
- 4.2 Kriterien zur Umsetzung
- 4.3 Modelle
- 4.3.1 Kopfpauschale / Capitation
- 4.3.2 Arzneimittellisten
- 4.3.3 Rabattverträge
- 4.3.3.1 Chancen von Rabattverträgen
- 4.3.3.2 Risiken von Rabattverträgen
- 4.3.4 Add-On
- 4.3.5 Risk-Sharing
- 4.3.6 Komplexpauschale für eine komplette Behandlung innerhalb einer Indikation
- Praxisbeispiel - Intelligentes Arzneimittelmanagement anhand der Indikation Diabetes Mellitus
- 5.1 Diabetes Mellitus
- 5.1.1 Prävalenz Diabetes Mellitus
- 5.1.2 Ursachen des Diabetes Mellitus
- 5.1.3 Prä-Diabetes
- 5.1.4 Begleit- / Folgeerkrankungen
- 5.1.5 Früherkennung
- 5.1.6 Prävention
- 5.2 Exkurs DMP / RSA
- 5.2.1 Grundlagen
- 5.2.2 Verlauf der Gesetzgebung zu DMP
- 5.2.3 Dokumentation
- 5.2.4 DMP Diabetes Mellitus Typ II
- 5.2.5 Einschreibevoraussetzungen
- 5.2.6 Vorteile einer Verknüpfung von DMP und RSA
- 5.2.7 Nachteile einer Verknüpfung von DMP und RSA
- 5.2.8 Anforderungen an DMP
- 5.3 Gesundheitsökonomische Betrachtung von Kosten und Folgekosten
- 5.3.1 KoDiM-Studie
- 5.3.2 Kosten des Diabetes Mellitus Typ-2
- 5.3.3 Kosten der durch Diabetes verursachten Komplikationen
- 5.4 Prävention
- 5.5 Einsparpotentiale für Krankenkassen
- 5.6 Pilotprojekt Arzneimittelpauschale „Diabetes Basket“
- 5.6.1 Konzept / Hintergrund
- 5.6.2 Konzept-Ablauf
- 5.6.3 Paketinhalte
- 5.6.4 Daten und Fakten zur Pilotregion
- 5.6.5 Datenbank-Analyse IMS Disease-Analyser MediPlus®
- 5.6.6 Ergebnisse der Analyse
- 5.6.7 Screening von Risikopatienten
- 5.6.8 Definition Win-Win-Situation
- 5.6.9 Win-Win-Situation dieses Konzeptes
- 5.6.10 „Diabetes Basket“
- 5.6.11 Berechnung „Diabetes-Basket"
- Schlussbetrachtung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der neu entstandenen Situation im deutschen Gesundheitswesen nach Verabschiedung des GKV-Modernisierungsgesetzes zum 1. Januar 2004. Sie analysiert die „Integrierte Versorgung“ und die Möglichkeiten der pharmazeutischen Industrie, durch innovative Arzneimittelmanagementmodelle an dieser Versorgungsform teilzunehmen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Arzneimittelversorgung in Deutschland im Rahmen der neuen Gesetzeslage zu optimieren.
- Integrierte Versorgung als neue Versorgungsform
- Arzneimittelmanagementmodelle im Kontext der Integrierten Versorgung
- Möglichkeiten der pharmazeutischen Industrie, an der Integrierten Versorgung teilzunehmen
- Optimierung der Arzneimittelversorgung in Deutschland
- Gesundheitsökonomische Aspekte der Arzneimittelversorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den aktuellen Stand der Arzneimittelversorgung in Deutschland dar und erläutert die Ziele und Auswirkungen des GKV-Modernisierungsgesetzes. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Integrierten Versorgung, definiert den Begriff, beschreibt den Anwendungsbereich und analysiert die Gesetzesgrundlage im SGB V. Es werden die Möglichkeiten für pharmazeutische Unternehmen aufgezeigt, an der Integrierten Versorgung mitzuwirken. Das dritte Kapitel beleuchtet den Arzneimittelmarkt, analysiert die Rechtsbereiche und Regulierungsformen sowie die Preisbildung von Arzneimitteln. Es werden die Arzneimittelausgaben der GKV und die Veränderungen durch das GKV-Modernisierungsgesetz betrachtet. Das vierte Kapitel widmet sich den Arzneimittelmanagement-Modellen, definiert Anforderungen und Kriterien zur Umsetzung und stellt verschiedene Modelle vor, darunter Kopfpauschale, Arzneimittellisten, Rabattverträge, Add-On und Risk-Sharing. Das fünfte Kapitel präsentiert ein Praxisbeispiel für intelligentes Arzneimittelmanagement anhand der Indikation Diabetes Mellitus. Es werden die Prävalenz, Ursachen, Begleit- und Folgeerkrankungen sowie die Prävention von Diabetes Mellitus erläutert. Der Exkurs DMP/RSA beleuchtet die Grundlagen, den Verlauf der Gesetzgebung, die Dokumentation und die Anforderungen an Diabetes-Management-Programme. Die gesundheitsökonomische Betrachtung von Kosten und Folgekosten des Diabetes Mellitus wird anhand der KoDiM-Studie dargestellt. Das Kapitel schließt mit der Vorstellung eines Pilotprojekts zur Arzneimittelpauschale „Diabetes Basket“. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der Arzneimittelversorgung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Integrierte Versorgung, Arzneimittelmanagementmodelle, GKV-Modernisierungsgesetz, pharmazeutische Industrie, Arzneimittelversorgung, Gesundheitsökonomie, Diabetes Mellitus, DMP, RSA, Kosten und Folgekosten, Pilotprojekt, „Diabetes Basket“.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Ges. Ökon. Stefanie Kruse (Autor:in), 2006, Innovative Arzneimittelmanagementmodelle in der Integrierten Versorgung nach §§ 140 a ff SGB V, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/114139