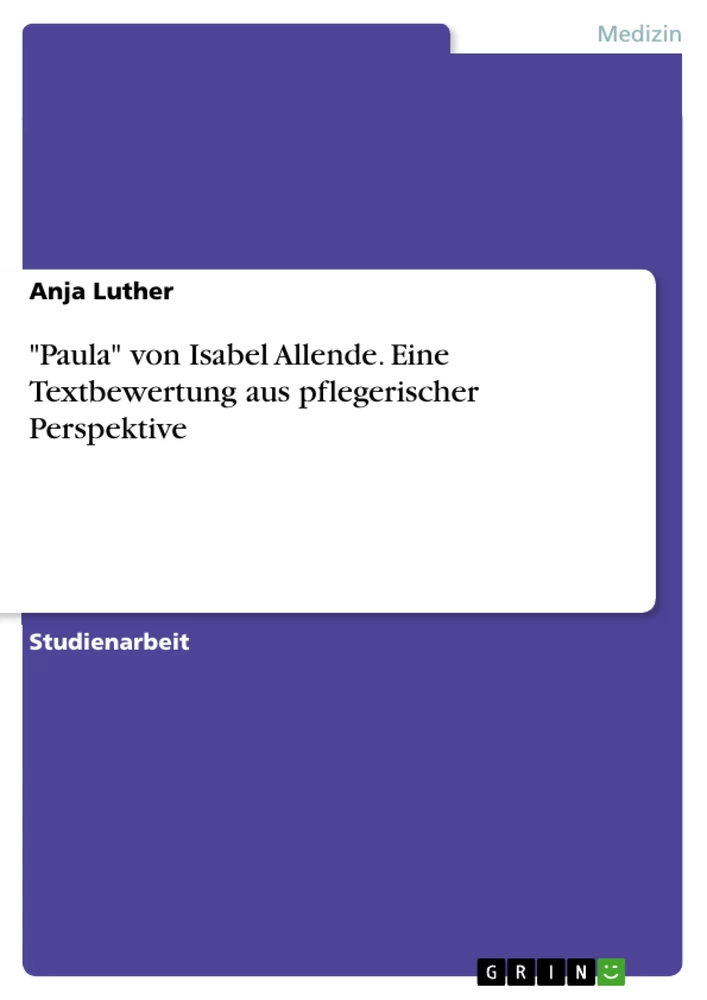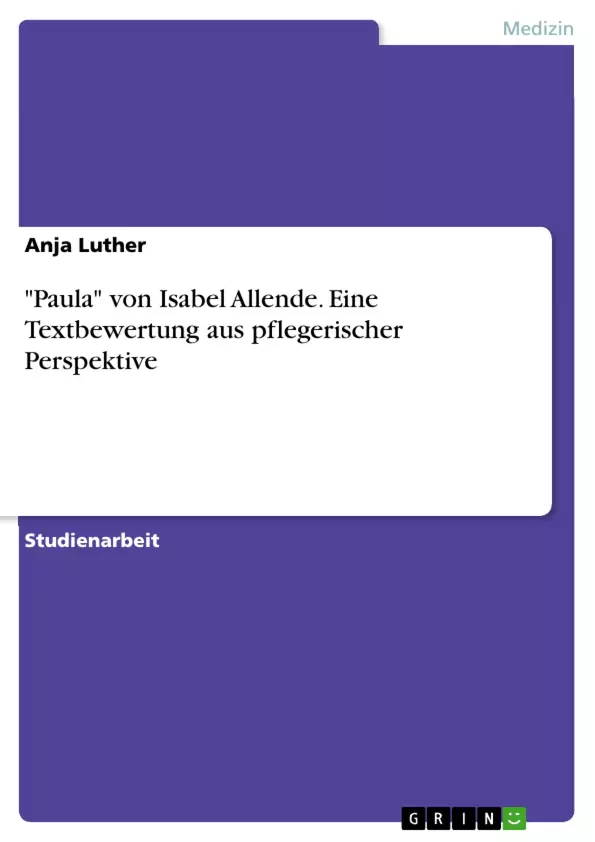Die Grenze zwischen Leben und Tod ist nicht nur medizinisch-pflegerisch nicht ganz so einfach zu ziehen. Oelke (2010b) schreibt in einem Zitat: „Wer im Gedächtnis seiner Freunde weiterlebt, der ist nicht tot“. Solche Vorstellungen sind mehr als ein Trost. Sie spiegeln ein Verständnis von Tod und Sterben. Die Autorin Allende geht mit einer ganz persönlichen Art und Weise mit dem Verlust ihrer Tochter um und schreibt die Geschichte für ihre Tochter „Paula“, die so in ihrer Erinnerung weiterlebt. Man kann daraus schlussfolgern, dass jeder Mensch sein eigenes subjektives Empfinden, Wahrnehmen und Beobachten zum Trauer- und Sterbeprozess hat. Dies lässt sich nicht auf jeden einzelnen Menschen übertragen. Für professionell Pflegende gilt jedoch, bei aller Fürsorge, eine reflektierende Haltung zum Thema Sterben, Tod und Trauer einzunehmen .
Diese Hausarbeit versucht kritisch und konstruktiv dieses sensible Thema zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die letzte Lebensphase
- Das Sterben
- Dimensionen des Sterbens
- Symptome in der Finalphase
- Passive Sterbehilfe als Form der Sterbebegleitung
- Riten und Bräuche aus religiöser Sicht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Textbewertung analysiert den Roman „Paula“ von Isabel Allende aus pflegerischer Perspektive, indem sie die letzte Lebensphase der Protagonistin Paula aus medizinischer und pflegerischer Sicht beleuchtet. Dabei wird die Autorin Allendes persönliche Erfahrung mit dem Sterben ihrer Tochter in den Kontext der Pflegewissenschaft und -praxis gestellt.
- Die verschiedenen Phasen der letzten Lebensphase
- Die Bedeutung der Sterbebegleitung
- Die ethischen und medizinischen Aspekte des Sterbens
- Der Umgang mit Trauer und Verlust
- Die Rolle der Familie und des sozialen Umfelds in der Sterbebegleitung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Textbewertung ein und stellt den Roman „Paula“ sowie dessen Entstehungsgeschichte vor. Sie skizziert die letzte Lebensphase von Paula und ihre Auswirkungen auf die Autorin.
Kapitel 2 behandelt die letzte Lebensphase aus medizinischer und pflegerischer Perspektive. Es werden verschiedene Phasen der letzten Lebensphase, wie die Rehabilitationsphase, die Terminalphase und die Finalphase, erläutert. Dabei werden die jeweiligen Charakteristika und Symptome dieser Phasen beschrieben.
Kapitel 2.1 befasst sich mit dem Sterben aus der Perspektive der Autorin. Sie schildert die Erfahrungen mit dem Sterben ihrer Tochter und ihre emotionalen Reaktionen auf die Situation.
Kapitel 2.2 widmet sich den Dimensionen des Sterbens. Es wird die Bedeutung des Sterbens als einen komplexen Prozess mit verschiedenen Dimensionen, wie der physischen, psychischen, sozialen und spirituellen Dimension, erläutert.
Kapitel 2.3 behandelt die Symptome in der Finalphase. Es werden die verschiedenen körperlichen und psychischen Symptome, die im Sterbeprozess auftreten können, besprochen.
Kapitel 3 befasst sich mit der passiven Sterbehilfe als Form der Sterbebegleitung. Es werden die ethischen und medizinischen Aspekte der passiven Sterbehilfe und ihre Rolle in der Sterbebegleitung beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich den Riten und Bräuchen aus religiöser Sicht. Es werden die verschiedenen Riten und Bräuche, die im Zusammenhang mit dem Sterben und der Trauer aus religiöser Sicht praktiziert werden, vorgestellt.
Das Kapitel "Fazit" fasst die Ergebnisse der Textbewertung zusammen und zieht Schlussfolgerungen. Es werden die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse des Romans "Paula" im Kontext der Pflegewissenschaft und -praxis präsentiert.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit den Themen Sterbebegleitung, letzte Lebensphase, Sterben, Tod, Trauer, Verlust, Pflege, Medizin, passive Sterbehilfe, Riten und Bräuche, Familie und soziales Umfeld.
- Arbeit zitieren
- Anja Luther (Autor:in), 2020, "Paula" von Isabel Allende. Eine Textbewertung aus pflegerischer Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1140840