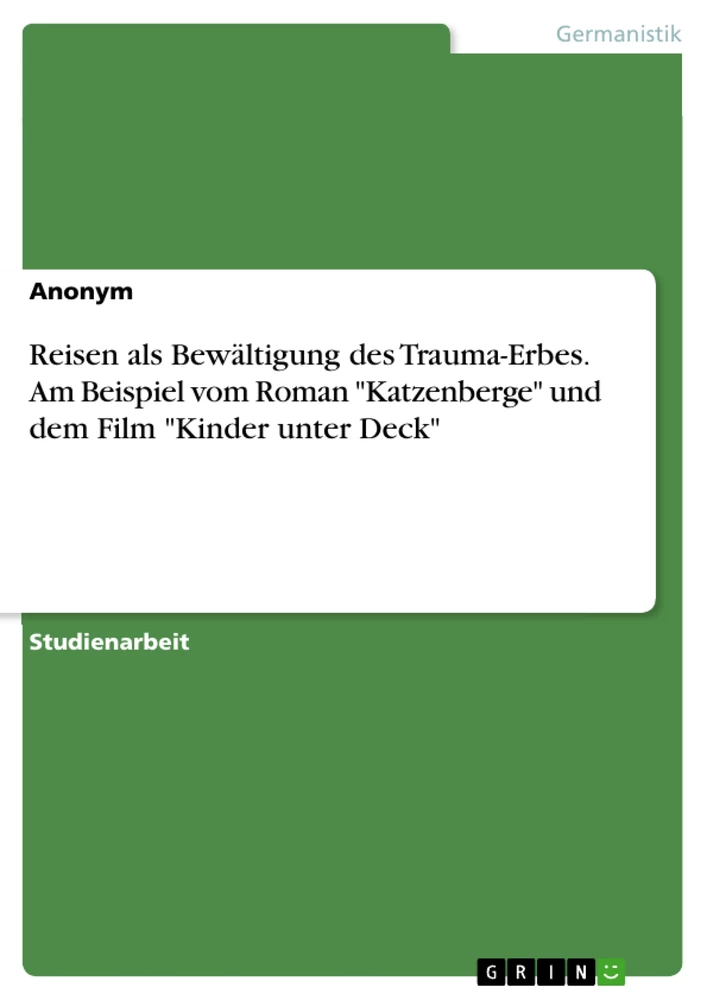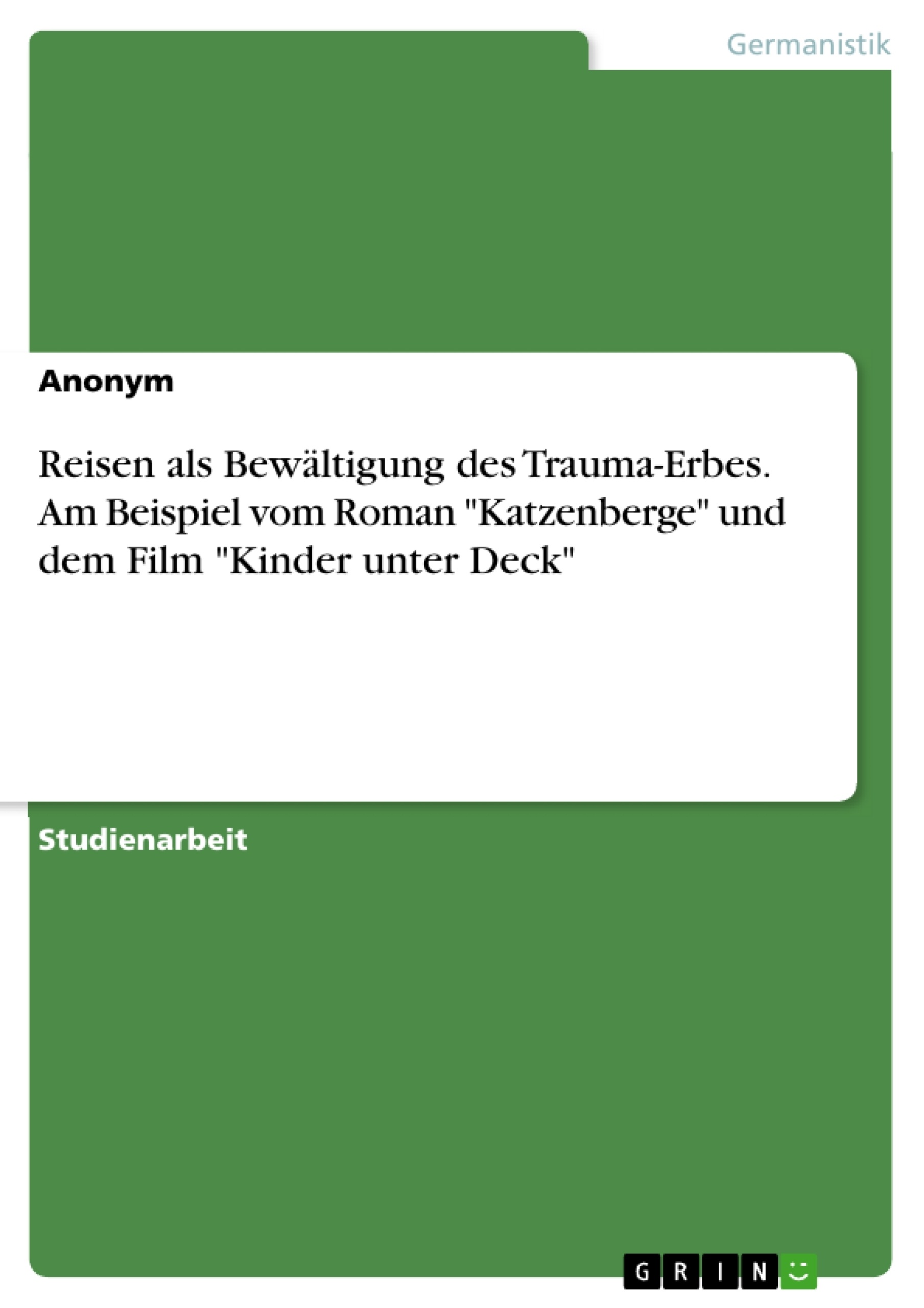In dieser Arbeit soll die transgenerationale Trauma-Weitergabe zunächst erklärt und in Bezug zu den Holocaust überlebenden gesetzt werden. Darauffolgend werden der Roman und der Film analysiert und in Bezug zum Trauma- Erben gesetzt werden. In beiden Erzählungen steht das Reisen zu den Ursprungsorten der Großeltern im Fokus und soll, unter dem Aspekt der Weitergabe von Traumata, als Ansatz zur Lösung dieser diskutiert werden.
Viele Menschen erleben Traumata durch die fürchterlichen Ereignisse, die der Krieg hervortrug. Doch als der Krieg vorbei war, blieb keine Zeit diese Traumata aufzuarbeiten. Während des Wiederaufbaus war kein Platz für seelische Schäden, es wurden vorrangig die offensichtlichen, materiellen Schäden behoben. Welche Folgen dies hat, ist nun erkennbar, denn die Traumata werden an die folgenden Generationen weitergegeben. Dies passiert unbewusst und wirkt sich teilweise drastisch auf die Persönlichkeitsentwicklung der Erben aus.
Die Zahl der Holocaustüberlebenden sinkt Jahr für Jahr und somit die Möglichkeit der direkten Aufarbeitung der Traumata. Letztendlich hinterlassen sie viele Fragen und ihre Kinder sehen sich gezwungen so weiterzuleben. Doch die dritte Generation scheint die ungelösten Fragen offen zu stellen und will die Geschichte aufarbeiten. In der folgenden Arbeit soll anhand eines Romans und eines Film genau dieser Aspekt analysiert und diskutiert werden. Es werden zweit Familien vorgestellt, deren Geschichten auf eine gewisse Weise sehr ähnlich, jedoch auch völlig unterschiedlich sind. Es zeigt den Mut der dritten Generation, die sich nicht vor der Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit dem Vergangenen scheuen und einem Ansatz, der zur Lösung solcher Traumata beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Trauma-Erbe
- Transgenerationale Trauma-Weitergabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert, wie das Trauma-Erbe des Zweiten Weltkriegs durch den Roman "Katzenberge" und den Film "Kinder unter Deck" veranschaulicht wird. Die Arbeit untersucht, wie die transgenerationale Trauma-Weitergabe, insbesondere im Kontext des Holocaust, in den beiden Erzählungen dargestellt wird.
- Transgenerationale Trauma-Weitergabe
- Die Auswirkungen des Holocaust auf nachfolgende Generationen
- Die Rolle von Reisen als Coping-Mechanismus
- Die Verarbeitung von Traumata durch die dritte Generation
- Die Bedeutung der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Textes dar und beleuchtet die Problematik der transgenerationalen Trauma-Weitergabe. Sie argumentiert, dass die Aufarbeitung von Traumata des Zweiten Weltkriegs, insbesondere des Holocaust, für die nachfolgenden Generationen von großer Bedeutung ist.
- Trauma-Erbe: Dieses Kapitel definiert den Begriff Trauma und erläutert, wie die Weitergabe von Traumata von einer Generation zur nächsten erfolgt. Es betrachtet verschiedene psychologische Modelle, die die transgenerationale Trauma-Weitergabe erklären.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Trauma, Transgenerationale Trauma-Weitergabe, Holocaust, Erinnerungskultur, Familienaufstellung, Coping-Mechanismen, Reisen, und Verarbeitung von Traumata.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Reisen als Bewältigung des Trauma-Erbes. Am Beispiel vom Roman "Katzenberge" und dem Film "Kinder unter Deck", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1139200