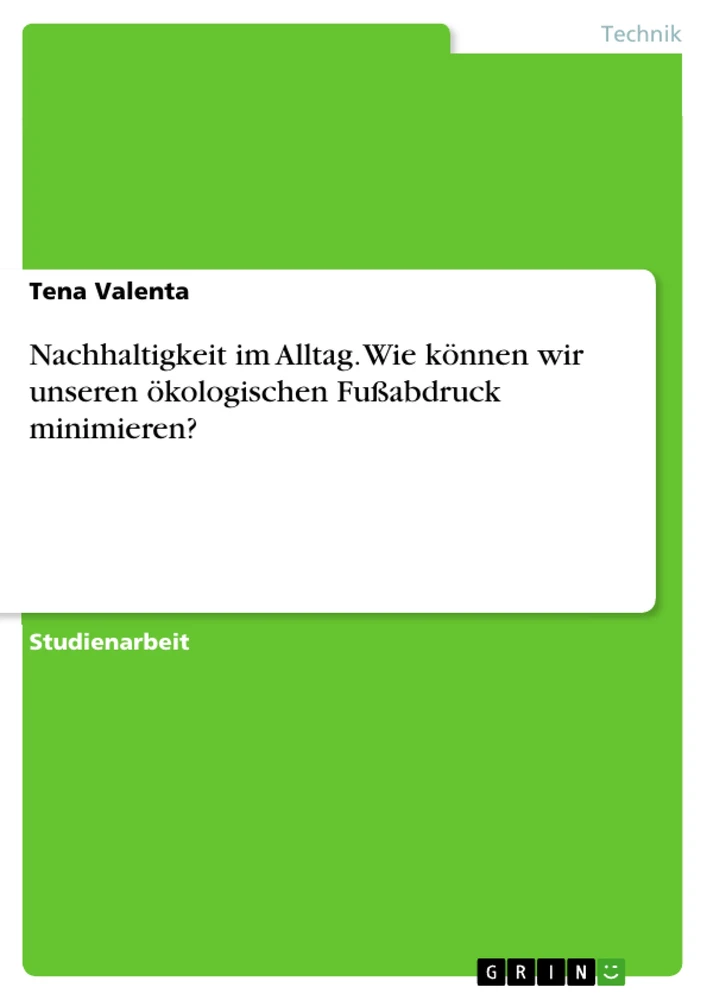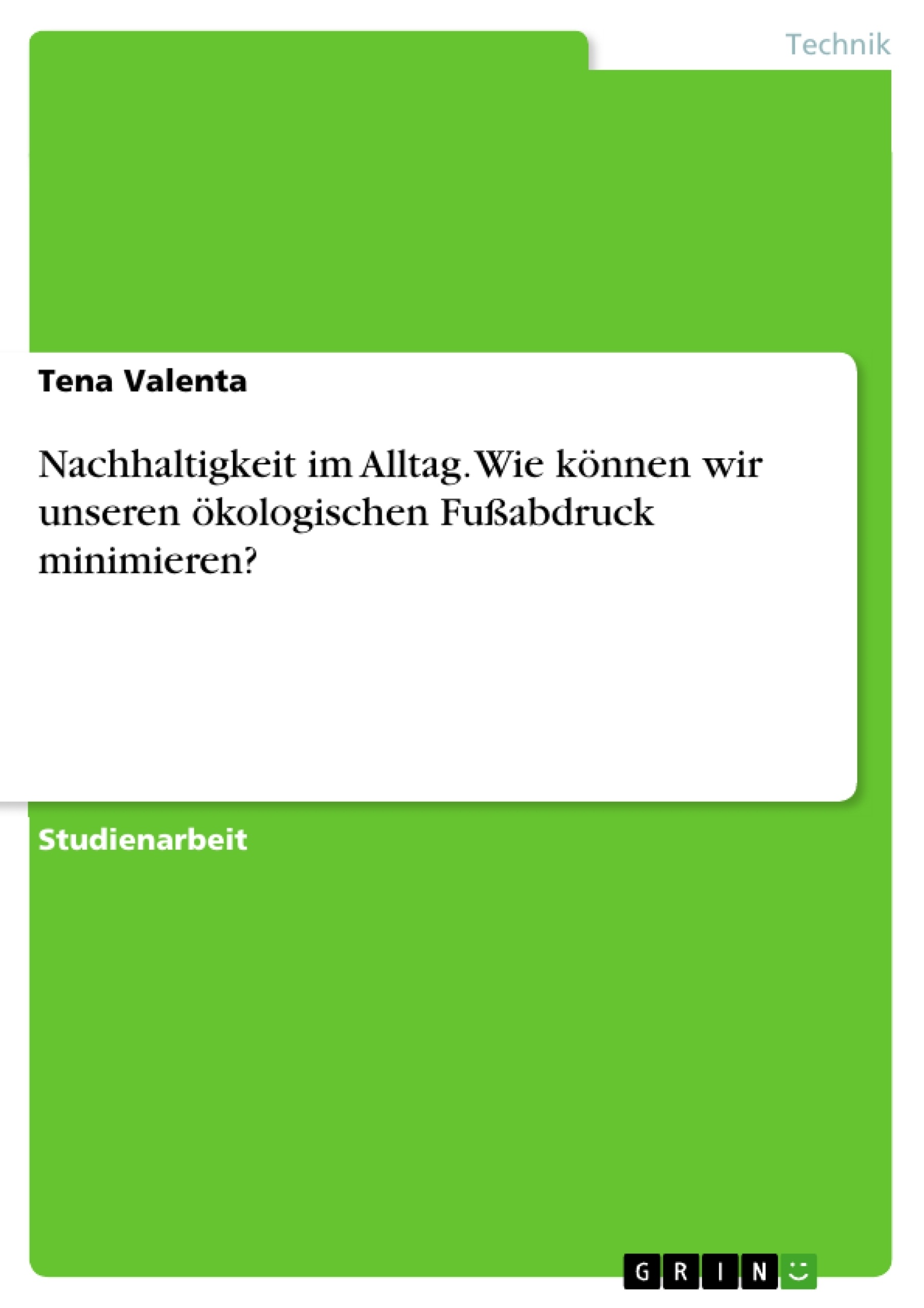Wir bekommen die Folgen des Klimawandels schon lange Zeit zu spüren. Da dies ein komplexes Thema ist, dass viel Fakten, Zahlen und geschichtlichen Hintergrund mit sich bringt, wird zunächst darauf eingegangen, was man unter Klimawandel überhaupt versteht und wie sich unser Klima in den letzten 50 Jahren verändert hat. Welche Folgen und Auswirkungen bestehen bereits?
Um dies nachvollziehen zu können, müssen wir verstehen, dass es zwei Arten der Umweltverschmutzung gibt: Luft- und Gewässerverschmutzung. Da genau diese zwei zu unseren Hauptressourcen gehören, werden sie in dieser Arbeit intensiv ausgearbeitet. Im dritten Kapitel wird die Luftverschmutzung aufgegriffen. Dabei nenne ich die Definition dieser und gehe zunächst auf die größten Treibhausgasemittenten ein: auf den Energie-, Transport-, Industrie und Landwirtschaftssektor.
Danach wird erläutert, worunter unsere Weltmeere leiden und was für einen Einfluss der Mensch auf die Verschmutzung hat. Durch welche Sektoren entsteht besondere Gefahr und sind es die alltäglichen Gewohnheiten des Menschen die dazu führen, dass unsere Ozeane so stark verschmutzt sind?
Dabei werden Fragen rund um die Themen Mikroplastik, Fisch- und Ölindustrie beantwortet. Nicht nur Ozeane an sich, sondern auch leben darin werden durch die Auswirkungen des Klimawandels beeinflusst. Inwiefern dies zusammenhängt, wird in diesem Kapitel erklärt. Kapitel 5 befasst sich mit der Frage, was für Möglichkeiten es gibt, den Ausschuss zu minimieren und den Klimawandel zu verlangsamen. Damit die Lösungsansätze so konkret wie möglich aufgefasst werden können, wird hier wieder zwischen Luft- und Gewässerverschmutzung unterschieden und genau auf die einzelnen Problemzonen dieser eingegangen. Was bringt die Zukunft mit sich? Ist für alles, was passieren soll, schon zu spät? Oder gibt es etwas, was wir noch stoppen oder verlangsamen können? Das letzte Kapitel ist darauf ausgelegt, diese Fragen zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Einleitung
- 2 Klimawandel seit 1970
- 2.1 Klimawandel seit 1970
- 3 Luftverschmutzung
- 3.1 Luftverschmutzung
- 4 „Ozean-Killer“
- 4.1 „Ozean-Killer“
- 5 Verbesserungsvorschläge
- 5.1 Verbesserungsvorschläge
- 6 Fazit
- 6.1 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck minimieren können und nachhaltiger leben können. Dabei wird die Definition von Umweltverschmutzung beleuchtet, die Folgen des Klimawandels erläutert, sowie die verschiedenen Arten der Umweltverschmutzung, insbesondere Luft- und Gewässerverschmutzung, näher betrachtet.
- Definition von Umweltverschmutzung
- Folgen des Klimawandels seit 1970
- Luftverschmutzung und ihre Ursachen
- Gewässerverschmutzung, insbesondere die Auswirkungen auf die Ozeane
- Mögliche Lösungsansätze zur Minimierung des ökologischen Fußabdrucks
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit zur Minimierung des ökologischen Fußabdrucks vor. Sie definiert Umweltverschmutzung und zeigt die Notwendigkeit, die Folgen des Klimawandels zu verstehen.
2 Klimawandel seit 1970
Dieses Kapitel behandelt den Klimawandel und seine Auswirkungen. Es erläutert die Temperaturerhöhung der Erdoberfläche und der Luft, sowie den Anstieg des Meeresspiegels.
3 Luftverschmutzung
Das Kapitel befasst sich mit der Luftverschmutzung und ihren Ursachen. Es benennt die größten Treibhausgasemittenten wie Energieerzeugung, Transport, Industrie und Landwirtschaft.
4 „Ozean-Killer“
Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Gewässerverschmutzung, insbesondere die Auswirkungen auf die Ozeane. Es beleuchtet die Folgen von Mikroplastik, der Fisch- und Ölindustrie und die Bedrohung der Meereslebewesen.
- Quote paper
- Tena Valenta (Author), 2021, Nachhaltigkeit im Alltag. Wie können wir unseren ökologischen Fußabdruck minimieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1139185