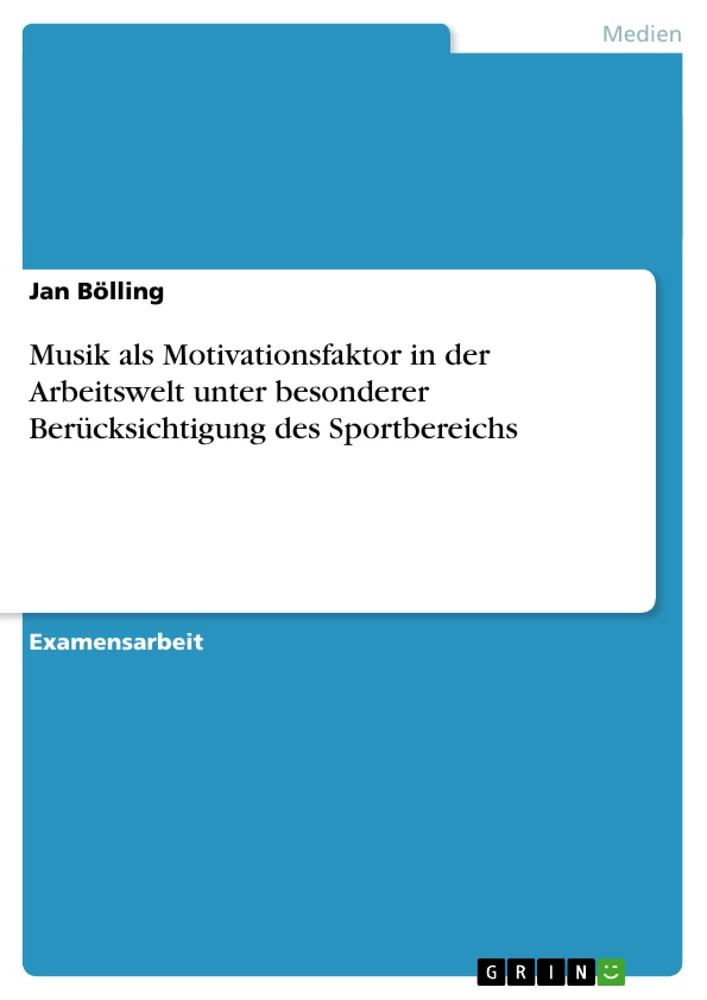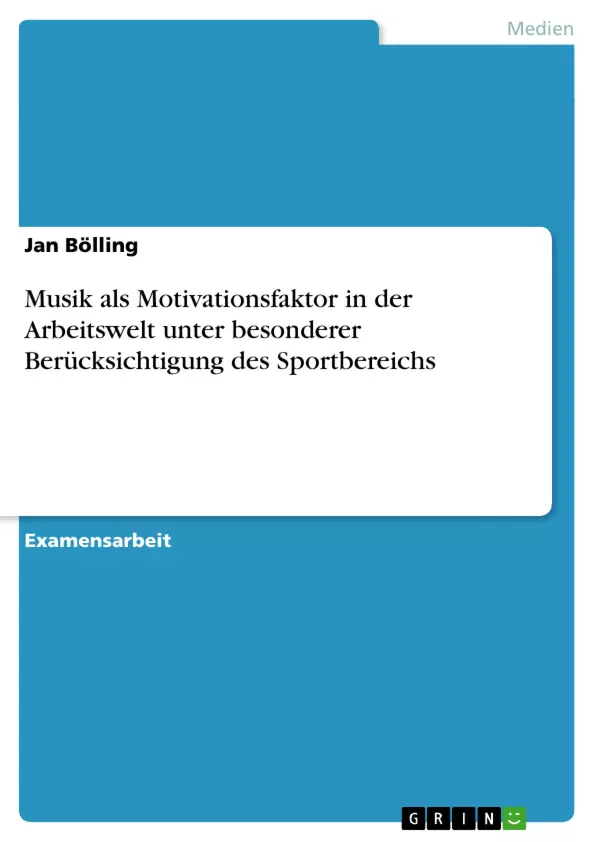Liebe/r Interessent/in. Diese Arbeit wurde mit der Hilfe von Universitäten in Großbritanien und den USA fertiggestellt. Die Auswertung der empirischen Untersuchungen erfolgte aus den AKTUELLSTEN (2006-2008) Studien, welche, zum Teil noch unveröffentlicht, dem Autor von namhaften Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt wurden. Forschungsgebiete: Musikforschung, Neurologie, Sportwissenschaft/-medizin, Arbeitslehre. Ungleich zu anderen Examensarbeiten wurde die vorliegende Arbeit von unabhängigen Prüfern mit der Note sehr gut (1,0)bewertet.
...Diese subjektiven Beobachtungen führten mich zu der Frage, ob sich eine Motivations- und daraus resultierende Leistungssteigerung durch den Einsatz von Musik wissenschaftlich belegen lässt. Seit jeher scheint der Mensch von Musik fasziniert zu sein. Vor allem seit es technische Reproduktionsmöglichkeiten zulassen, ist sie nicht nur ein ständiger Begleiter bei Alltagstätigkeiten sondern auch immer häufiger in Arbeitsbetrieben. Diese Omnipräsenz führt zu der Frage, ob Musik in der Lage ist, Arbeitstätigkeiten angenehmer zu gestalten und ob sie darüber hinaus sogar, durch eine motivationale Wirkung auf den arbeitenden Menschen, Leistungssteigerungen bewirken kann. Führt man diese Überlegungen zu Ende, könnte sich dies zum einen positiv auf die Arbeitszufriedenheit und -moral der Belegschaft auswirken, zum anderen könnte auch die ökonomische Seite davon profitieren. Ein Musikeinsatz im Sportbereich würde ebenfalls eine interessante Perspektive darstellen. Lässt sich schon durch einen ungezielten Musikeinsatz bei Kindern und Jugendlichen eine große emotionale Wirkung feststellen, was vermag dann ein gezielter Einsatz im Bezug auf die Motivation und Leistungsfähigkeit von Hochleistungssportlern bewirken?
Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Bereiche Arbeit und Sport aufgrund ihrer vielen Gemeinsamkeiten unter ähnlichen Gesichtspunkten und Fragestellungen behandelt werden.
Zum einen soll untersucht werden, ob eine motivationale Wirkung von Musik möglich und auf welche Prozesse dies zurück zu führen ist.
...Grundlage zu Theorien von Ursprung, Entstehungsgeschichte und Herkunft von Musik bieten. Darauf aufbauend soll eine Analyse der Musikwahrnehmung nach psychologischer und neurophysiologischer Betrachtungsweise erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Musik
- Begriffsbestimmung Musik
- Überlegungen zu Ursprung, Entstehungsgeschichte und Herkunft von Musik
- Musikperzeption nach psychologischer und neurophysiologischer Betrachtungsweise
- Wie entstehen Geräusche im Kopf und wie werden sie nach neurophysiologischer Betrachtung wahrgenommen und in Musik verwandelt?
- Das menschliche Ohr- wie es funktioniert und was es zu leisten imstande ist
- Schwierigkeiten im Bereich der Neurologie
- Wege der Musik durch das Gehirn
- Wirkungsweise von Musik
- Abhängigkeit der Musikwirkung von außermusikalischen Faktoren
- Emotionsauslöser Musik
- Zusammenfassung des Kapitels
- Musik als motivationaler Faktor in der Arbeitswelt
- Einleitung
- Begriffsbestimmung Arbeit
- Historischer Einblick in die Arbeitsmusik: Arbeitsgesänge in Einzel- und Gruppenarbeit mit und ohne instrumentale Unterstützung
- Veränderung der Arbeitswelt durch den Fortschritt der Werkzeugtechnik
- Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen in Bezug auf die Wirkung funktioneller Hintergrundmusik bei der Arbeit
- Einsatz von Hintergrundmusik kommerzieller Unternehmen
- Lässt sich durch funktionelle Hintergrundmusik eine Leistungssteigerung erzielen?
- Nachlassende Wirkung der funktionellen Hintergrundmusik im Arbeitsbereich
- Die Wirkung von Musik im Wandel: Der Einfluss der Habituation auf die Musikwahrnehmung und -wirkung
- Einsatz funktioneller Hintergrundmusik in Kaufhäusern
- Funktionelle Hintergrundmusik in der Werbung
- Funktionelle Hintergrundmusik in Bildungsfilmen
- Selbstselektierte versus fremdselektierte Musik
- Studie zum Musikeinsatz in englischen Büroeinrichtungen
- Zusammenfassung des Kapitels
- Musik als motivationaler Faktor im Sportbereich
- Einleitung
- Begriffsbestimmung Sport: Ist Sport Arbeit?
- Differenzierung von Amateur- und Leistungssportlern
- Höchstleistungen im Leistungssport
- Sport als Arbeit: Was ist die Motivationsquelle für das Erreichen von Höchstleistungen?
- Trainingsprozesse im Leistungssport
- Einsatz von Musik zur Bildung von Automatismen: Rhythmus als Hilfsmittel in der Lernoptimierung von Trainingsprozessen
- Einleitung
- Begriffsbestimmung Rhythmus
- Das sensomotorische System
- Vorstellung einer musikalisch-rhythmischen Lehrmethode zu motivationsfördernden und lernoptimierenden Zwecken
- Wissenschaftliche Erkenntnisse bezüglich des Einsatzes von Rhythmus/Musik im Sportbereich
- Umsetzung der musikalisch-rhythmischen Lehrmethode in die Praxis
- Der Einsatz von Musik am Beispiel des mentalen Trainings von Leistungssportlern im Bereich des Laufsports
- Einleitung
- Begriffsbestimmung mentales Training
- Der Einsatz des mentalen Trainings im Laufsport
- Der Einsatz von Musik im Laufsport zu leistungssteigernden Zwecken
- Einschränkung der Wirkungsweise von selbstselektierter Musik
- Zukunftstrends der Sportartikelindustrie im Laufsport
- Zusammenfassung des Kapitels
- Resümee und Ausblick
- Zukunftsperspektive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Musik als Motivationsfaktor in der Arbeitswelt, insbesondere im Sportbereich, fungieren kann. Die Arbeit untersucht die Wirkung von Musik auf die menschliche Wahrnehmung, das Erleben von Emotionen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Arbeitsleistung.
- Die Bedeutung von Musik in der menschlichen Wahrnehmung und ihre neurophysiologische Grundlage
- Die vielseitige Wirkung von Musik auf die Motivation und Leistung in verschiedenen Arbeitskontexten
- Der Einfluss von Musik auf die Entstehung von Automatismen im Sport und die Optimierung von Trainingsprozessen
- Die Rolle von Musik im mentalen Training von Leistungssportlern
- Die Bedeutung von selbstselektierter und fremdselektierter Musik im Arbeitskontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Ausgangspunkt der Forschung darstellt und die Relevanz des Themas unterstreicht. Das Kapitel „Musik“ befasst sich mit der Begriffsbestimmung von Musik, ihren Ursprüngen und ihrer Wirkungsweise auf die menschliche Wahrnehmung und das Erleben von Emotionen. Das Kapitel „Musik als motivationaler Faktor in der Arbeitswelt“ analysiert den historischen Einsatz von Musik in der Arbeit, die Auswirkungen von funktioneller Hintergrundmusik auf die Leistung und untersucht die Rolle von Musik in verschiedenen Arbeitsbereichen. Das Kapitel „Musik als motivationaler Faktor im Sportbereich“ betrachtet die Motivationsquelle für Höchstleistungen im Sport, den Einsatz von Musik in Trainingsprozessen und im mentalen Training von Leistungssportlern.
Schlüsselwörter
Musik, Motivation, Arbeitswelt, Sport, Leistungssteigerung, Emotionen, Wahrnehmung, Neurophysiologie, Training, Rhythmus, Mentales Training, Selbstselektierte Musik, Fremdselektierte Musik.
Häufig gestellte Fragen
Kann Musik die Arbeitsleistung tatsächlich steigern?
Ja, wissenschaftliche Studien belegen, dass Musik eine motivationale Wirkung hat, die Tätigkeiten angenehmer gestaltet und die Arbeitsmoral sowie ökonomische Ergebnisse verbessern kann.
Wie wirkt Musik im Sportbereich?
Musik hilft bei der Bildung von Automatismen, optimiert Trainingsprozesse durch Rhythmus und dient als Werkzeug im mentalen Training von Leistungssportlern.
Was ist der Unterschied zwischen selbst- und fremdselektierter Musik?
Selbstselektierte Musik (vom Nutzer gewählt) hat oft eine stärkere positive Wirkung, während fremdselektierte Hintergrundmusik (z. B. in Büros) je nach Kontext variieren kann.
Was versteht man unter funktioneller Hintergrundmusik?
Dies ist gezielt eingesetzte Musik in Kaufhäusern, Werbung oder Betrieben, um das Verhalten und die Stimmung der Menschen unbewusst zu beeinflussen.
Wie verarbeitet das Gehirn Musik?
Die Arbeit analysiert die Musikperzeption aus neurophysiologischer Sicht und beschreibt den Weg der Schallwellen durch das Ohr bis zur Verarbeitung im Gehirn.
- Quote paper
- Jan Bölling (Author), 2008, Musik als Motivationsfaktor in der Arbeitswelt unter besonderer Berücksichtigung des Sportbereichs, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/113864