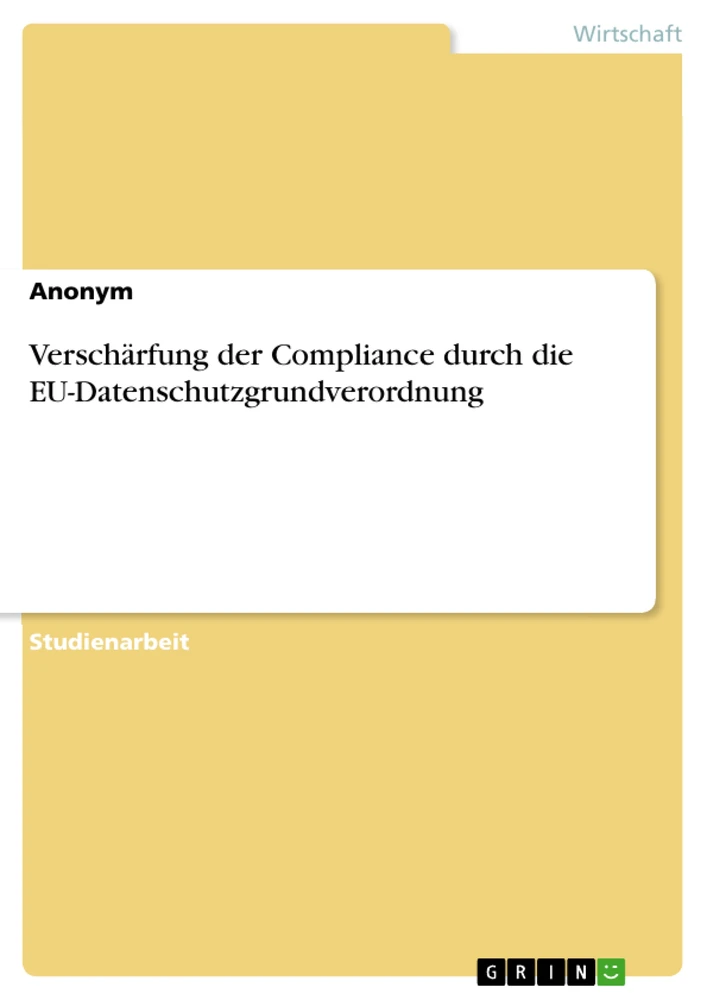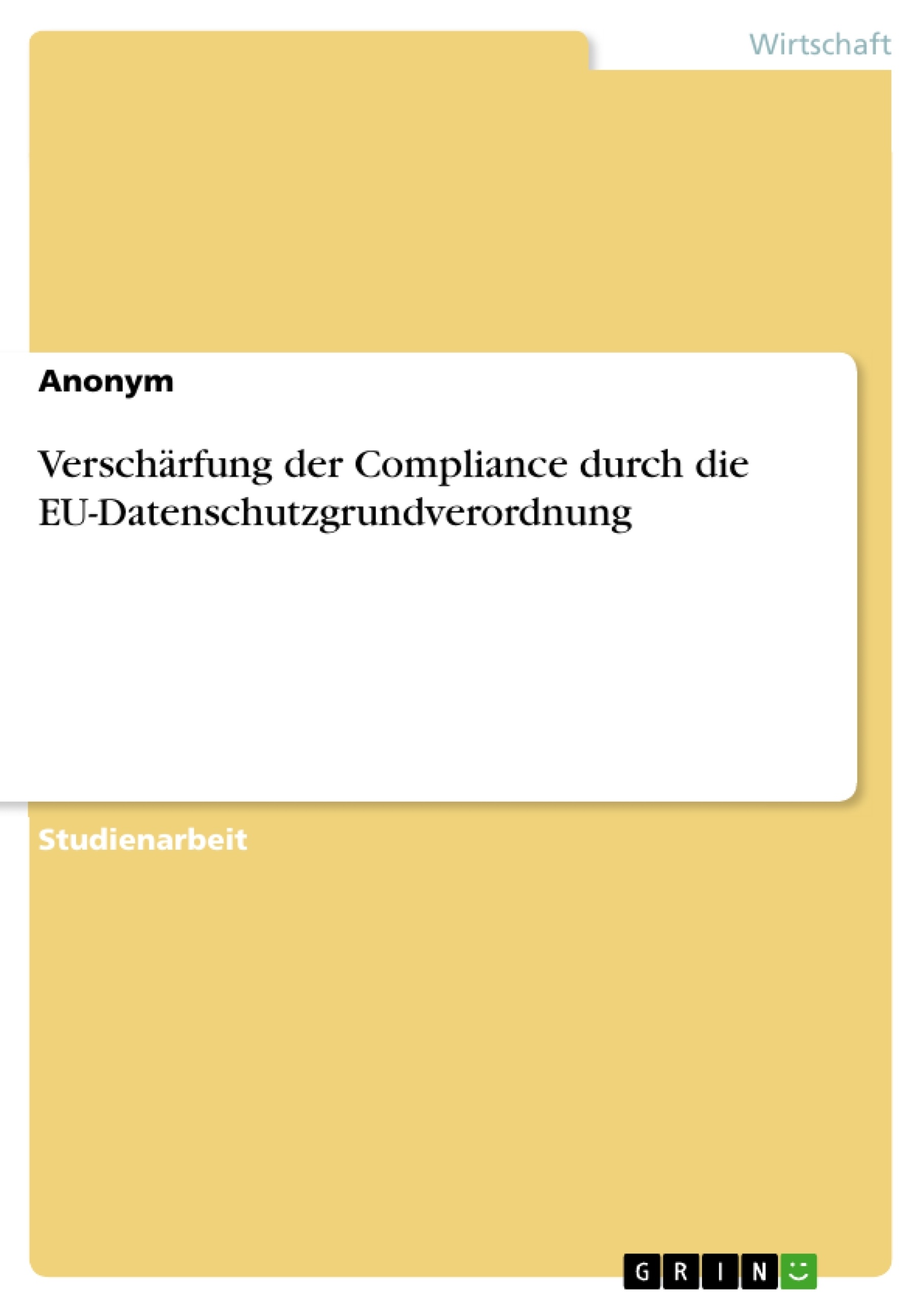Die Arbeit und die damit verbundenen Untersuchungen stützen sich primär auf die Fragestellung, inwieweit sich die Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) auf die Compliance in Unternehmen auswirkt. Mit Hilfe aktueller Medienberichte soll dazu zunächst die Relevanz des Themas aufgegriffen werden. Um weitergehend ein Verständnis für die Thematik zu erhalten, werden dazu sowohl Compliance als auch die EU- Datenschutzgrundverordnung näher definiert, wobei die Auffassung von Compliance abgegrenzt und die Einführung von unternehmensinterner Compliance hervorgehoben wird. Zudem werden die Hintergründe, Aufbau und Inhalt der DS-GVO konkretisiert.
Ausgehend vom konzeptionellen Rahmen der Arbeit wird die Unternehmens-Compliance im Datenschutz dargestellt, wobei auf die Gesetze des Bundesdatenschutzgesetzes alte Fassung (BDSG a.F.) verwiesen wird, um die unternehmensbezogene Situation vor der Einführung der Datenschutzgrundverordnung zu präzisieren. Den Kern der Arbeit bildet die Analyse der Compliance-relevanten Vorschriften, welche die Unternehmen als datenschutzrechtliche Pflichten gemäß den Gesetzen der ein-geführten DSGVO erfüllen müssen. Diesbezüglich werden ausgewählte Artikel der DSGVO auf Compliance-Relevanz hin überprüft, um die Verschärfungen, welche sich aus den wiedergegeben Artikeln des DSGVO ergeben, aufzuzeigen. Ergänzend ist die Abbildung der Herausforderungen, welche sich für die Datenschutz-Compliance innerhalb von Unternehmen ergeben, angestrebt, wobei diese anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht werden. Aufgrund der kontinuierlich wachsenden Prozesse im Rahmen des Datenschutzes, ist es abschließend möglich, eine Vielzahl von weiteren Präventionsmaßnahmen zu generieren, um zukünftige Verstöße im Bereich der Datenschutz-Compliance zu vermeiden.
Inhaltsverzeichnis
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- 1 EINLEITUNG
- 1.1 RELEVANZ DES THEMAS UND PROBLEMSTELLUNG
- 1.2 ZIELSETZUNG DER ARBEIT
- 2 BEGRIFFLICHE UND KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN
- 2.1 COMPLIANCE
- 2.1.1 Definition und Abgrenzung
- 2.1.2 Implementierung unternehmensinterner Compliance
- 2.2 EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG
- 2.2.1 Einführung der DS-GVO
- 2.2.2 Aufbau und Inhalte der Grundverordnung
- 3 UNTERNEHMENS-COMPLIANCE IM DATENSCHUTZ VOR DER EINFÜHRUNG DER EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG
- 4 COMPLIANCE-RELEVANTE MODIFIKATIONEN DURCH DIE DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG
- 4.1 GRUNDSÄTZE DER DATENVERARBEITUNG
- 4.2 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER
- 4.3 RECHTE DES BETROFFENEN
- 4.4 SANKTIONEN
- 5 HERAUSFORDERUNGEN DER COMPLIANCE IN VERBINDUNG MIT DER EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG
- 6 FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Auswirkung der Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) auf die Compliance in Unternehmen. Sie untersucht, welche Veränderungen die DS-GVO für die unternehmensinterne Compliance mit sich bringt und welche Herausforderungen sich daraus ergeben. Die Arbeit stützt sich dabei auf aktuelle Medienberichte und wissenschaftliche Literatur.
- Relevanz der DS-GVO für die Compliance
- Definition und Abgrenzung von Compliance sowie Implementierung unternehmensinterner Compliance
- Einführung, Aufbau und Inhalt der DS-GVO
- Compliance-relevante Modifikationen durch die DS-GVO, einschließlich Datenschutzgrundsätze, Datenschutzbeauftragtem, Rechten des Betroffenen und Sanktionen
- Herausforderungen der Compliance in Verbindung mit der DS-GVO
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Compliance im Kontext der DS-GVO dar und beleuchtet die Problematik des Datenschutzes, insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Corona-Pandemie. Zudem wird die Zielsetzung der Arbeit erläutert.
- Kapitel 2: Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen
Dieses Kapitel definiert und grenzt den Begriff "Compliance" ab. Es wird die Implementierung von unternehmensinterner Compliance sowie die Einführung, den Aufbau und den Inhalt der DS-GVO näher beleuchtet.
- Kapitel 3: Unternehmens-Compliance im Datenschutz vor der Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung
Dieses Kapitel beleuchtet die Situation der Unternehmens-Compliance im Datenschutz vor der Einführung der DS-GVO.
- Kapitel 4: Compliance-relevante Modifikationen durch die Datenschutzgrundverordnung
Dieses Kapitel analysiert die wesentlichen Änderungen, die die DS-GVO für die Compliance mit sich bringt. Es werden die Datenschutzgrundsätze, die Rolle des Datenschutzbeauftragten, die Rechte des Betroffenen und die Sanktionen im Detail betrachtet.
- Kapitel 5: Herausforderungen der Compliance in Verbindung mit der EU-Datenschutzgrundverordnung
Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, die Unternehmen im Zuge der Einhaltung der DS-GVO im Bereich der Compliance bewältigen müssen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Compliance, Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Datenschutz, Datenverarbeitung, Datenschutzbeauftragter, Rechte des Betroffenen, Sanktionen, Herausforderungen, Unternehmens-Compliance und digitale Lösungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich die DS-GVO auf die Unternehmens-Compliance aus?
Die DS-GVO verschärft die Anforderungen an den Datenschutz erheblich und zwingt Unternehmen dazu, ihre internen Prozesse und Compliance-Richtlinien strikt anzupassen.
Welche Rolle spielt der Datenschutzbeauftragte unter der DS-GVO?
Er ist eine zentrale Instanz für die Überwachung der Einhaltung von Datenschutzvorschriften und dient als Schnittstelle zwischen Unternehmen, Betroffenen und Aufsichtsbehörden.
Welche Sanktionen drohen bei Verstößen gegen die DS-GVO?
Bei Missachtung der Vorschriften können empfindliche Geldbußen verhängt werden, die deutlich über den Sanktionen des alten Bundesdatenschutzgesetzes liegen.
Was sind die wichtigsten Rechte der Betroffenen?
Dazu gehören unter anderem das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") und die Datenübertragbarkeit.
Wie hat sich die Situation vor und nach Einführung der DS-GVO verändert?
Vor der DS-GVO galt das BDSG a.F.; die neue Verordnung hat die Dokumentationspflichten und die Rechenschaftspflicht der Unternehmen massiv erhöht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Verschärfung der Compliance durch die EU-Datenschutzgrundverordnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1137473