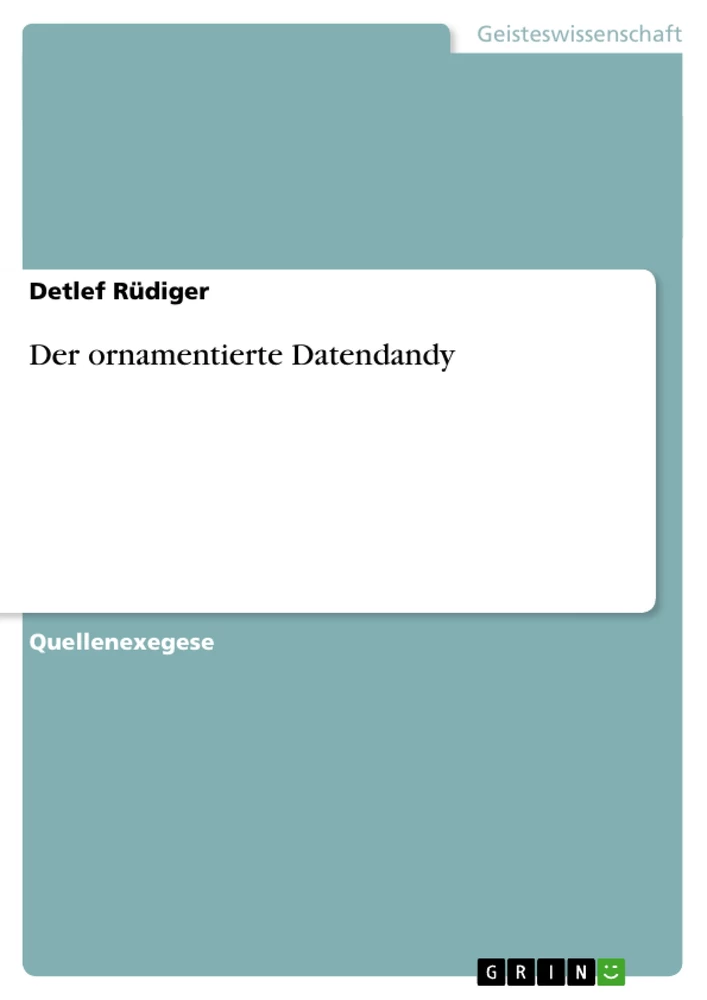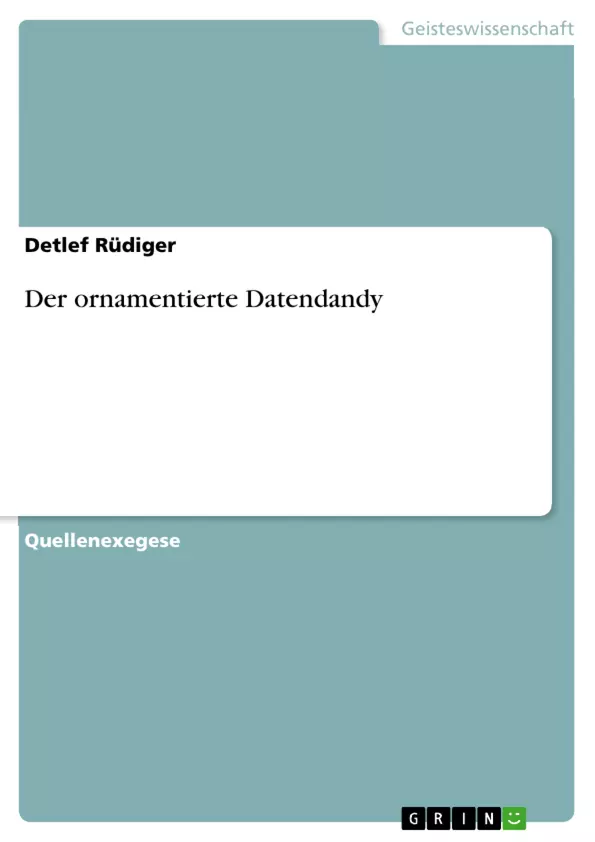Geert Lovinks "Der Daten-Dandy" in der "Zeitschrift für Semiotik", Band 16 Heft 1-2 (Tübingen 1994, S. 89-91) und das Kapitel "Selbstrezeption" im "Medien-Archiv" (Bensheim und Düsseldorf 1993, S. 269-273) der Agentur Bilwet werden hier mit Zitaten bzw. den Namen von Niklas Luhmann, Richard von Schaukal, Geert Lovink, Roger Willemsen, Barbara Vinken, Michael Thompson, Gerd Bergfleth, Walter Benjamin, Eberhard Roters, Cynthia Clare-Simonis, Edmond Roudnitska, Martin Conrads, Hakim Bey, Peter Sloterdijk, Friedrich Schlegel, Wolfgang Fritz Haug, Ursula Geitner, Irene Himburg-Krawehl, Alexander von Gleichen-Rußwurm, Dirk Käsler, Alexander Kluge, Rainald Goetz, Hubert Winkels, Friedrich Kittler, Dietmar Dath, Klaus Theweleit, Walter Reese-Schäfer, August Wilhelm Schlegel, Mark Terkessidis, Niels Werber, Jean Baudrillard, Florian Rötzer, Carl Heinrich Ludwig Pölitz, Klaus Günzel, Garlieb Helvig Merkel, Micha Brumlik, Friedrich Nietzsche, Agentur Bilwet (Basjan van Stam, Geert Lovink, Arjen Mulder, Ger Peeters, Lex Wouterloot), Stefan Breuer, Hauke Brunkhorst, Karl Lagerfeld, Sándor Ferenczi, Nicolaus Sombart, Wilhelm Fliess, Gilles Deleuze / Felix Guattari, Elsa Schiaparelli, Georg Simmel, Friedrich Nicolai, Readigers Digest (Detlef Rüdiger), Ernst Behler, Jochen Hörisch, Novalis, Jürgen Oelkers, Diedrich Diederichsen, Thomas Gottschalk, Rudolf Kassner, Theodor W. Adorno, Harald Schmidt, Lothar Gorris, Uschi Neuhauser, Christoph Becker, Konrad Wünsche, Willard Van Orman Quine, Johann Gottlieb Fichte, Dirk Baecker, Norbert Bolz, Christine Kaufmann, Michel Serres, Stefan Bollmann in Beziehung gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Der Daten-Dandy
- Der Daten-Dandy sammelt Informationen, um damit zu prahlen
- Die Frage ist:, Watro Wollte der Datentatzke das alles wissen?
- Im Zeitalter der multimedialen Masseninformation kann man keinen Unterschied mehr erkennen zwischen Ein- und Vielförmigkeit.
- Was die Straße der Metropole für den historischen, ist das Datennetz
- Was die anonyme Menge in den Straßen für den Passagen-Dandy war
- Das einzige im Netz, was die Eigenschaften einer Masse zeigt, ist die Information selbst
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Phänomen des "Daten-Dandys" im Kontext der digitalen Welt. Der Autor analysiert das Verhalten und die Motivation dieses neuen Typs des Dandys, der sich durch seine exzessive Datensammelei und seinen unaufhörlichen Informationskonsum auszeichnet.
- Der Daten-Dandy als Exponent des digitalen Überflusses
- Die unaufhörliche Datensammelei als Ausdruck von Langeweile und Provokation
- Der Daten-Dandy als ironische Figur im Zeitalter der digitalen Masseninformation
- Die ambivalenten Eigenschaften des Daten-Dandys: Glamour und Oberflächlichkeit
- Der Einfluss des Daten-Dandys auf die digitale Kultur und die "Temporären Gemeinsamen Nenner"
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Daten-Dandy sammelt Informationen, um damit zu prahlen, und nicht, um sie zu übertragen. Er ist sehr gut, vielleicht ein bißchen zu gut, oder sogar übertrieben gut informiert. Auf gezielte Fragen kommen ungewünschte Antworten. Er kommt immer mit etwas anderem. Dem Phänotyp des Daten-Dandys begegnet man mit dem gleichen Unbehagen wie seinem historischen Vorgänger, welcher Straße und Salon als Podium hatte. Die elegante Extravaganz, mit der das kleinste Detail dargeboten wird, irritiert die zielbewussten Mediennutzer. Der Daten-Dandy verspottet den maßvollen Konsum von Nachrichten, die dosierte Einnahme landläufiger Unterhaltung; Überfluß oder overload von spezialisiertem Wissen können ihn nicht aus der Ruhe bringen. Sein sorgfältig zusammengestelltes Informations-Portfolio läßt keine konstruktive Motivation erkennen. Er setzt so hoch wie möglich an, um so arbitrar wie möglich rubatzukommen.
- Die Frage ist:, Watro Wollte der Datentatzke das alles wissen?\" Warum ist der Dandy, in seinem Hang zu zweckloser Datensammelei, so wirkungssüchtig? Sein Zappeln kommt nicht aus Langeweile, sondern aus der wohlbegründeten Abneigung, systematisch auf der Höhe der laufenden Geschichten und neuesten Begebenheiten zu bleiben. Der Bildschirm ist der Spiegel, vor dem er seine Toilette macht. Das button/unbutton des textilen Dandyismus hat seinen Nachfolger in kanalsurfender on/off-Dekadenz gefunden. Umhüllt von feisten Fakten und unsinnigsten gadgets, dereguliert er die Ökonomie der Zeitmanager. Den größten Teil seiner Computerzeit verliert er an trickreiche Einrichtungen auf seiner Festplatte und an das Anbringen raffinierter Schaltungen zwischen tausendfältigem heterogenen Software-Nippes. Das Apple Powerbook als Zierat ist der Stolz manches Salondigitalisten. Dieser verhöhnt mit Aktualität, hype und Mode; es erscheint ein Ich, welches sein eigener Moderator ist.
- Im Zeitalter der multimedialen Masseninformation kann man keinen Unterschied mehr erkennen zwischen Ein- und Vielförmigkeit. Weder die große Übersicht noch das erklärende Detail können die Geistesverwirrung mildern. Vor diesem Hintergrund beweist der Daten-Dandy, was jeder schon weiß, nämlich, daß Information zwar allgegenwärtig, aber nicht ohne weiteres verfügbar ist. Bestimmte Fakten sind besonders schmückend, und für sie muß man eine feine Nasta entwickeln. Anders als beim klassischen Sammler, geht es dem besagten Dandy nicht um Vollständigkeit, sondern um die Anhäufung von soviel immateriellen ✗✓ namenten wie möglich. Während der japanische Whizkid, ein Wahlverwandter des Daten-Dandys namens Otaku, nach innen gekehrt ist und nie die Grenze seiner einsilbigen Kultiviertheit überschreitet, sucht der Daten-Dandy die extrovertierten newsgroups auf, um seine unproduktiven Beiträge zu jicieren. Was der Daten-Dandy wegdrapscht, um es anderswo zu präsentieren, ist latent wichtig, wäre nicht die Präsentation so indiskret. Seine launenhafte Spitzfindigkeit lenkt die Aufmerksamkeit von den täglichen Vorkommnissen ab. Die bon mots haben eine Genialitätsdauer von 30 Sekunden, danach verschwinden sie genau so plötzlich wieder vom Bildschirm. Unser Daten-Dandy ist ein Makler in Giga-ware, in dem Sinne, daß ihr Abfall sein Make-up ist, und ihr Fluidum seine Substanz.
- Was die Straße der Metropole für den historischen, ist das Datennetz für den elektronischen Dandy. Das Flanieren auf den Datenboulevards kann nicht verboten werden und verstopft die gesamte Bandbreite. Das allzu gebildete Gespräch während eines Rendezvous rührt einige unangebrachte und lästige Einzelheiten auf, mündet aber nie in Dissens. Das mutwillig verkehrte Navigieren und das elegante joy riding innerhalb anderer Leute Elektro-Umwelt hat zum Ziel, Bewunderung, Neid und Verwirrung, hervorzurufen, und steuert selbstbewußt auf einen gestylten Unbegriff zu. Man mißt die Schönheit seines virtuellen Auftritts an der moralischen Empörung und Lachlust der angeschlossenen Mitbürger. Es gehört zu den natürlichen Eigenschaften des Stutzers, den Schock des Künstlichen zu genießen. Darum fühlt er sich so zu Hause im Cyberspace mit all seinen Attributen. Lediglich das Riechwasser und die rosa Strümpfe sind hier ersetzt durch kostbare Intels, delikate Datenhandschuhe und rubinenbesetzte Datenbrillen, und es sitzen Sensoren an Augenbrauen und Nasenflügeln. Weg mit der bäurischen NASA-Ästhetik der Cybernauten! Wir haben das Stadium der Pioniere weit hinter uns gelassen, nun geht es um die Grazie der medialen Geste.
- Was die anonyme Menge in den Straßen für den Passagen-Dandy war: Spielfeld und Publikum zugleich, das sind die eingeloggten Benutzer des Netzes für den Daten-Dandy. Dieser sieht sich gezwungen, die anderen User als anonyme Masse zu gebrauchen, als amorphe Normalität, gegen die er sich durch gezielte Abweichung abgrenzt. Doch ist es eine Regel des Netzes, daß jeder dort jederzeit nur mit der étalage du moi beschäftigt ist. Der Daten-Dandy ist also nie mehr als einer unter vielen Verrückten im Veränderungskarneval des Informationswesens. Er wird sich darum nie als die soundsovielte Retro-Identität darstellen, als Überbleibsel einer der Moden des zwanzigsten Jahrhunderts, weil er nur als Non-Identität selbst die Regeln des Netzes beeinflussen kann. Was ist eigentlich Exklusivität im Zeitalter der Differenz? - Der Dandy ist nicht an stets geheimeren passwords interessiert, um in noch geschlossenere Datensalons einzudringen, er braucht virtuelle Orte für seine tragische Erscheinung. Daten-Dandyismus entsteht aus der Abkehr von der Gebanntheit durch eine virtuelle Subkultur. Zum Feindbild des Dandytums gehören die Freizeit-identitäten, die sich in der verborgenen Privatsphäre austoben. Er revoltiert gegen das Junggesellige dieser Maschinen. Als glamouröse Erwiderung lanciert der Daten-Dandy sogenannte Temporäre Gemeinsame Nenner (TGN), auf denen alle kulturellen und politischen Sekten sich wiederzufinden glauben. So verri er eine bemerkenswert große graue Masse anzuziehen für sein eigenes Spektakel. Der Daten-Dandy surft mit auf den Wellen dieser Temporären Gemeinsamen Nenner, und damit muß er sich zufrieden geben.
Schlüsselwörter
Daten-Dandy, digitale Kultur, Informationsüberfluss, virtuelle Subkultur, Temporäre Gemeinsame Nenner, Exklusivität, Informationsfeld, homoinformative Daten, Dandy-Daten.
- Quote paper
- Detlef Rüdiger (Author), 1994, Der ornamentierte Datendandy, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/113549