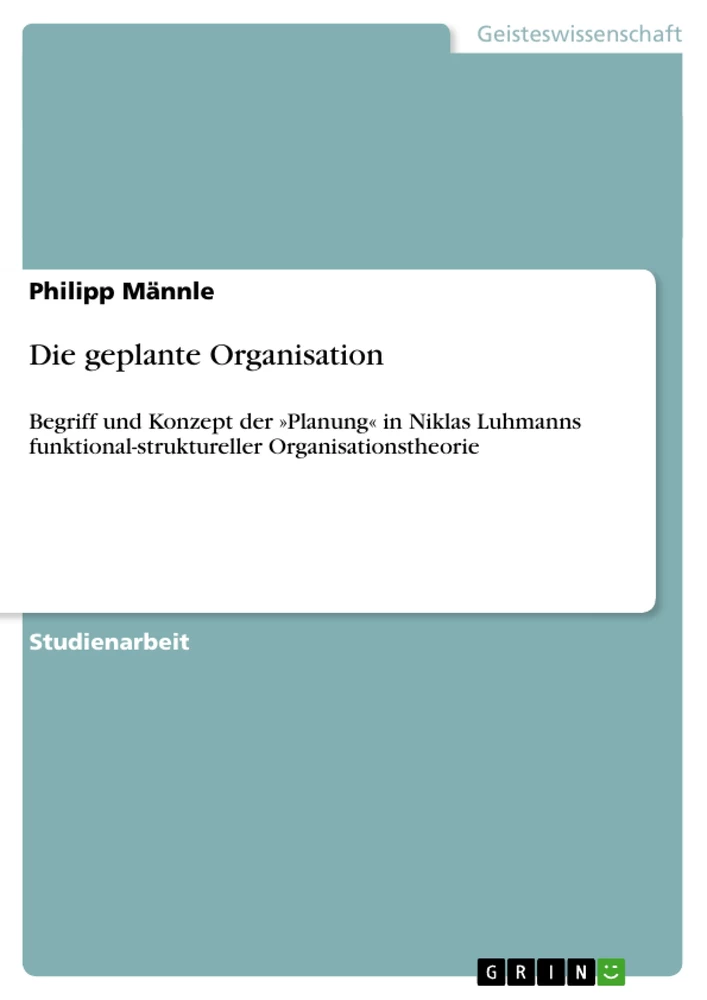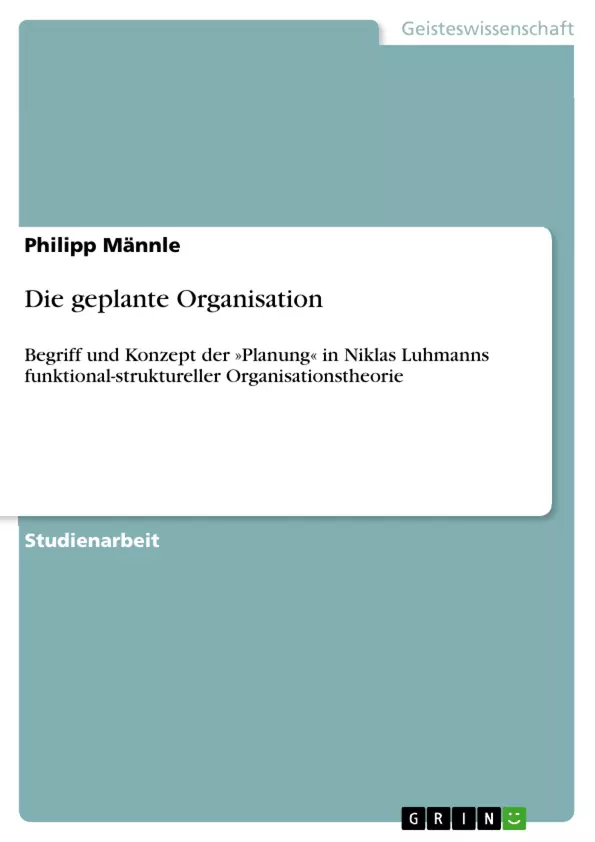»Das Verführerische der kausalen Betrachtungsweise ist, dass sie
einen dazu führt, zu sagen: ›Natürlich, – so musste es geschehen.‹
Während man denken sollte: so und auf viele andere Weise, kann es
geschehen sein« (Wittgenstein (1984) 501).
Scheinbar beiläufig stellt Ludwig Wittgenstein die Frage, ob die eigentlich so wohlvertraute Perspektive der Ursache/Wirkungs-Beziehungen angesichts eines grundsätzlichen Auch-anders-möglich-sein-Könnens (vgl. SoSy 47) überhaupt jene Geltungskraft beanspruchen kann, die man ihr gemeinhin zugesteht. Auf eine prägnante Formel gebracht könnte man das Eingangszitat daher auch wie folgt reformulieren: Kontingenz statt Kausalität?! Aber warum diese Frage? Handelt es sich dabei nicht um ein philosophisch-abstraktes Problem,
das im Kontext organisationstheoretischer Überlegungen wenig Relevanz besitzt? Auf den ersten Blick scheint dies so zu sein, doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass der Wittgensteinsche Zweifel auch ganz konkrete Implikationen hat – dort nämlich, wo Ursache/Wirkungs-Relationen nach üblicher Meinung quasi axiomatisch vorausgesetzt werden müssen, um überhaupt tätig werden zu können: bei der Planung von Organisationen.
Besinnt man sich nämlich der zentralen Bausteine der klassischen Organisationstheorie, findet man bspw. im Bürokratiemodell Max Webers, mit welchem dieser gewissermaßen den Idealtypus einer modernen, rationalen Organisationen skizziert hat, neben zahlreichen anderen konstitutiven Merkmalen auch: Berechenbarkeit (vgl. Weber (1921/1972) 128). Damit ist
gemeint, dass Organisationen gleichsam als Instrumente (vgl. PolP 93) nach dem Vorbild von Apparaten (vgl. Weber (1921/1972) 128) oder Maschinen (vgl. Weber (1919/1992) 59) aufgebaut sein und auf erklärbaren, nachvollziehbaren Ursache/Wirkungs-Beziehungen beruhen sollen.
Nur dann nämlich, wenn man das dementsprechende Konstruktionsprinzip der Trivialmaschine (vgl. Foerster (1993) 247) voraussetzen kann, hat es Sinn, Organisationen zu planen, also wissentlich und willentlich ziel- respektive zweckorientiert auszugestalten. Akzeptiert man stattdessen die Aussagen des Eingangszitates, kommt man nicht umhin, »Kausalzusammenhänge für äußerst komplex und für prinzipiell undurchsichtig zu halten« (ÖK 28) – und wenn man diese allgemeine Feststellung sodann auf den speziellen Fall der
organisationalen Planung bezieht, stellt sich die Frage, »ob Planung diejenigen Probleme löst, für die sie eingerichtet« (SozA3 425) wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Die geplante Organisation – Zur Einführung
- Kausalität, Kontingenz und das Problem der Planung
- (System-)Theoretische Arbeitsgrundlagen
- Allgemeine Systemtheorie
- Komplexität als (Ur-)Problem
- Systeme als Lösungen zum Komplexitätsproblem
- Typologie (sozialer) Systeme
- Soziale Systeme
- Kommunikation als Element und Ereignis
- Autopoiesis und Selbstreferenz
- Offenheit und Geschlossenheit
- Organisationen
- Unsicherheitsabsorption durch Entscheidung
- Struktur und Prozess
- Mitgliedschaft in Organisationen
- (System-)Theoretische Arbeitsgrundlagen - Fazit
- Allgemeine Systemtheorie
- Planung als Entscheiden über Entscheidungen
- Planung als Entscheidungsorientierung
- Entscheidungsprämissen und Organisationsstrukturen
- Programme, Organisation und Personal
- Konditional- und Zweckprogramme
- Die Organisation der Organisation
- Personalstruktur und Persönlichkeit
- Planung als Entscheidung über Entscheidungen - Fazit
- Warum Planung?
- Planung und Autopoiesis
- Rekursivität als basale Selbstreferenz
- Anschlussfähigkeit durch Planung
- Autopoiesis der Organisation
- Planung und Geschlossenheit
- Reflexivität als prozessuale Selbstreferenz
- Selbststrukturierung durch Planung
- Schließung der Organisation
- Planung und Offenheit
- Reflexion und System-Umwelt-Differenz
- Irritierbarkeit durch Planung und Programmierung
- Öffnung der Organisation
- Warum Planung? - Fazit
- Die geplante Organisation - Conclusio
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Planungsbegriff in Niklas Luhmanns funktional-struktureller Organisationstheorie. Sie analysiert, wie Planung in einem System selbstreferentieller Organisationen funktioniert und welche Rolle sie für die Autopoiesis und die Geschlossenheit von Organisationen spielt.
- Kausalität und Kontingenz in der Organisationstheorie
- Die Rolle der Planung in der funktional-strukturellen Systemtheorie
- Autopoiesis und Selbstreferenz von Organisationen
- Die Bedeutung von Planung für die Geschlossenheit und Offenheit von Organisationen
- Die Grenzen und Möglichkeiten der Planung in komplexen Systemen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel II beleuchtet das Problem der Planung im Kontext der klassischen Organisationstheorie. Es wird gezeigt, dass die traditionelle Vorstellung von Organisationen als Maschinen, die auf Ursache/Wirkungs-Beziehungen beruhen, mit dem Konzept der Kontingenz in Konflikt steht.
Kapitel III stellt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es werden die wichtigsten Elemente der allgemeinen Systemtheorie, der Theorie sozialer Systeme und der funktional-strukturellen Organisationstheorie vorgestellt.
Kapitel IV spezifiziert Niklas Luhmanns Planungsbegriff. Es wird gezeigt, dass Planung in der Luhmannschen Theorie als Entscheidung über Entscheidungen verstanden wird, die auf der Grundlage von Programmen und Strukturen erfolgt.
Kapitel V untersucht die Notwendigkeit von Planung in selbstreferentiellen Organisationen. Es wird argumentiert, dass Planung sowohl für die Autopoiesis als auch für die Geschlossenheit von Organisationen unerlässlich ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die geplante Organisation, Planung, Niklas Luhmann, funktional-strukturelle Systemtheorie, Autopoiesis, Selbstreferenz, Geschlossenheit, Offenheit, Kontingenz, Kausalität, Organisationstheorie, Entscheidung, Programme, Strukturen, Komplexität.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Niklas Luhmann den Begriff „Planung“?
In der Luhmannschen Systemtheorie wird Planung als „Entscheiden über Entscheidungen“ verstanden. Sie dient dazu, zukünftige Entscheidungsspielräume durch Programme und Strukturen einzuengen oder vorzubereiten.
Was ist das Problem mit Kausalität in der Organisationstheorie?
Klassische Theorien sehen Organisationen oft als triviale Maschinen (Ursache-Wirkung). Luhmann betont hingegen die Kontingenz – dass Dinge auch anders möglich sind –, was Planung in komplexen Systemen erschwert.
Welche Rolle spielt die Autopoiesis für Organisationen?
Autopoiesis bedeutet Selbsterzeugung. Organisationen produzieren sich durch ihre eigenen Entscheidungen immer wieder neu und grenzen sich so von ihrer Umwelt ab.
Wie hängen Planung und Unsicherheitsabsorption zusammen?
Organisationen absorbieren Unsicherheit, indem sie Entscheidungen treffen. Planung strukturiert diesen Prozess, um trotz komplexer Umwelten handlungsfähig zu bleiben.
Was sind Konditional- und Zweckprogramme?
Konditionalprogramme legen fest, was unter bestimmten Bedingungen zu tun ist (Wenn-Dann). Zweckprogramme definieren Ziele, lassen aber den Weg zur Zielerreichung offen.
- Quote paper
- Dipl.Verw.wiss.; M.A. Philipp Männle (Author), 2006, Die geplante Organisation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/113535