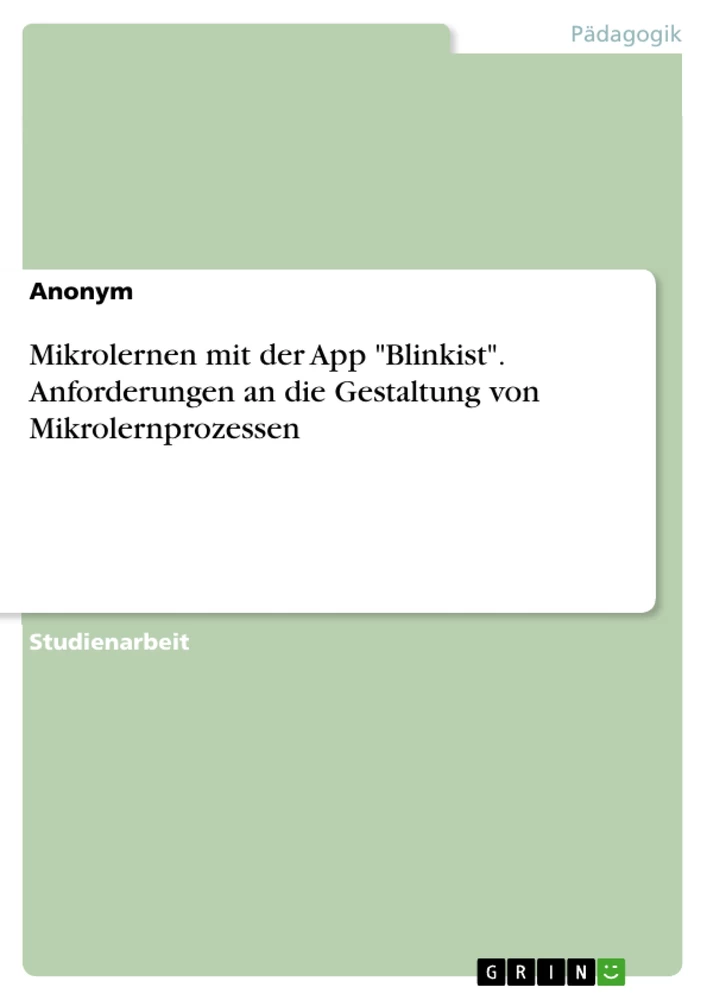Diese Arbeit beschäftigt sich mit Mikrolernen und beleuchtet die App "Blinkist". Dabei werden folgende Fragen gestellt: Wie umfänglich kann das Lernen in kurzer Zeit und mit kleinen Einheiten sein? Welche Potentiale knüpfen sich an das Konzept des Mikrolernens und welche Grenzen gehen damit einher? Wie sollten Mikrolernprozesse gestaltet sein, um ein effektives Lernen zu ermöglichen?
Um diese Fragen zu beantworten, soll zunächst das Konzept des Mikrolernens hinsichtlich seiner geschichtlichen Aspekte, seiner Definition(en) und Merkmale, sowie in Bezug auf die mit ihm verbundenen Potentiale und Grenzen einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Anschließend werden Anforderungen an die Gestaltung von Mikrolernprozessen erwogen. Im dritten Kapitel soll schließlich die App "Blinkist" eingehender in ihrer Nutzungsmöglichkeit als Mikrolernanwendung untersucht werden: Das Angebot der App und ihr Aufbau werden erläutert, es wird nachvollzogen, welche typischen Merkmale des Mikrolernens sie aufweist und zuletzt wird ein exemplarischer Blink, also eine von "Blinkist" erstellte Buchzusammenfassung, analysiert, wobei die Gestaltung des Lernprozesses bzw. der einzelnen Lerneinheiten im Fokus stehen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Mikrolernen
- 1.1 Geschichtliche Aspekte
- 1.2 Definition(en), Dimensionen und Abgrenzung
- 1.3 Potentiale und Grenzen
- 2 Didaktiken des Mikrolernens: Anforderungen an die Gestaltung von Mikrolernprozessen
- 2.1 Mikrolerneinheiten: Anforderungen und didaktische Gestaltung
- 2.2 Technologische Anforderungen
- 3 Blinkist: Informelles lernen in kleinen Einheiten per App
- 3.1 Angebot und Aufbau der App
- 3.2 Blinkist als Mikrolernanwendung
- 3.3 Blink-Analyse: Gestaltung der Lerneinheiten und des Lernprozesses
- 3.3.1 Zu analysierender Blink
- 3.3.2 Gestaltung der Lerneinheiten und des Lernprozesses
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept des Mikrolernens, insbesondere seine Potentiale und Grenzen im Kontext digitaler Medien und der Wissensgesellschaft. Sie analysiert die Anforderungen an die Gestaltung effektiver Mikrolernprozesse und beleuchtet die App Blinkist als Anwendungsbeispiel.
- Geschichtliche Entwicklung des Mikrolernens
- Definition und Dimensionen des Mikrolernens
- Potentiale und Grenzen des Mikrolernens
- Didaktische Gestaltung von Mikrolerneinheiten
- Analyse von Blinkist als Mikrolernanwendung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Mikrolernens ein und stellt die App Blinkist als ein Beispiel für diese Lernform vor. Sie verortet Mikrolernen im Kontext der Wissensgesellschaft und des lebenslangen Lernens, das durch die rasche Entwicklung technologischer Innovationen und die damit verbundene kurze Halbwertszeit von Wissen notwendig geworden ist. Die Einleitung skizziert die Forschungsfragen der Arbeit und den Aufbau der folgenden Kapitel.
1 Mikrolernen: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Kernkonzept der Arbeit: Mikrolernen. Es beginnt mit einem historischen Exkurs (Kapitel 1.1), der zeigt, dass das Prinzip des Lernens in kleinen Schritten eine lange Tradition hat, die bis in das Mittelalter zurückreicht. Anschließend werden verschiedene Definitionen und Dimensionen des Mikrolernens vorgestellt (Kapitel 1.2), wobei die Vielfalt der Konzepte und Anwendungen betont wird. Schließlich werden die Potentiale und Grenzen des Mikrolernens im Vergleich diskutiert (Kapitel 1.3), wobei die Vorteile der kurzen Lerneinheiten und die Herausforderungen bei der Gestaltung effektiver Lernprozesse beleuchtet werden.
2 Didaktiken des Mikrolernens: Anforderungen an die Gestaltung von Mikrolernprozessen: Dieses Kapitel widmet sich den didaktischen Anforderungen an die Gestaltung von Mikrolernprozessen. Es beleuchtet, wie Mikrolerneinheiten gestaltet sein müssen, um effektives Lernen zu ermöglichen (Kapitel 2.1), und berücksichtigt dabei die spezifischen Herausforderungen der kurzen Lernzeit und des kleinen Inhaltsumfangs. Weiterhin werden die technologischen Anforderungen an Mikrolernanwendungen diskutiert (Kapitel 2.2), die für die erfolgreiche Umsetzung des Konzepts unerlässlich sind. Hierbei wird die Rolle der Technologie nicht nur als Trägermedium, sondern auch als aktives Gestaltungselement von Lernprozessen betont.
3 Blinkist: Informelles lernen in kleinen Einheiten per App: In diesem Kapitel wird die App Blinkist als Beispiel für eine Mikrolernanwendung analysiert. Es beschreibt zunächst das Angebot und den Aufbau der App (Kapitel 3.1), um die Funktionsweise und die zugrundeliegende Philosophie zu verstehen. Anschließend wird untersucht, inwiefern Blinkist die typischen Merkmale des Mikrolernens aufweist (Kapitel 3.2). Schließlich wird eine exemplarische Buchzusammenfassung ("Blink") analysiert, um die Gestaltung der Lerneinheiten und des Lernprozesses zu evaluieren (Kapitel 3.3). Die Analyse konzentriert sich darauf, wie Blinkist die Prinzipien des Mikrolernens umsetzt und welche didaktischen Strategien zum Einsatz kommen.
Schlüsselwörter
Mikrolernen, digitale Medien, Wissensgesellschaft, lebenslanges Lernen, didaktische Gestaltung, Mikrolerneinheiten, Blinkist, App, informelles Lernen, Potentiale, Grenzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mikrolernen und Blinkist
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Konzept des Mikrolernens, seine Potentiale und Grenzen, insbesondere im Kontext digitaler Medien und der Wissensgesellschaft. Ein besonderer Fokus liegt auf der didaktischen Gestaltung effektiver Mikrolernprozesse und der Analyse der App Blinkist als Anwendungsbeispiel.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die geschichtliche Entwicklung des Mikrolernens, Definitionen und Dimensionen, Potentiale und Grenzen, die didaktische Gestaltung von Mikrolerneinheiten und eine detaillierte Analyse von Blinkist als Mikrolernanwendung. Es wird untersucht, wie Blinkist die Prinzipien des Mikrolernens umsetzt und welche didaktischen Strategien zum Einsatz kommen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Fazit. Kapitel 1 behandelt das Kernkonzept "Mikrolernen" mit historischen Aspekten, Definitionen, Dimensionen und einer Diskussion der Potentiale und Grenzen. Kapitel 2 konzentriert sich auf die didaktischen Anforderungen an die Gestaltung von Mikrolernprozessen und die technologischen Voraussetzungen. Kapitel 3 analysiert die App Blinkist, ihren Aufbau, ihre Funktion als Mikrolernanwendung und die Gestaltung ihrer Lerneinheiten.
Was ist Blinkist und wie wird es in der Arbeit untersucht?
Blinkist ist eine App, die Buchzusammenfassungen ("Blinks") in kurzen, leicht verdaulichen Einheiten anbietet. Die Arbeit analysiert Blinkist als Beispiel für eine Mikrolernanwendung. Es wird untersucht, ob und wie Blinkist die Prinzipien des Mikrolernens erfüllt und welche didaktischen Strategien in der Gestaltung der Lerneinheiten verwendet werden. Eine exemplarische Blink-Analyse ist Bestandteil der Untersuchung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Konzept des Mikrolernens umfassend zu beleuchten und seine Eignung im Kontext der modernen Wissensgesellschaft zu evaluieren. Die Analyse von Blinkist dient als Fallstudie, um die praktischen Implikationen und Herausforderungen des Mikrolernens zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Mikrolernen, digitale Medien, Wissensgesellschaft, lebenslanges Lernen, didaktische Gestaltung, Mikrolerneinheiten, Blinkist, App, informelles Lernen, Potentiale, Grenzen.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet detaillierte Zusammenfassungen der Einleitung und der drei Hauptkapitel. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfragen vor. Die Kapitelzusammenfassungen geben einen Überblick über die Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Mikrolernen mit der App "Blinkist". Anforderungen an die Gestaltung von Mikrolernprozessen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1134730