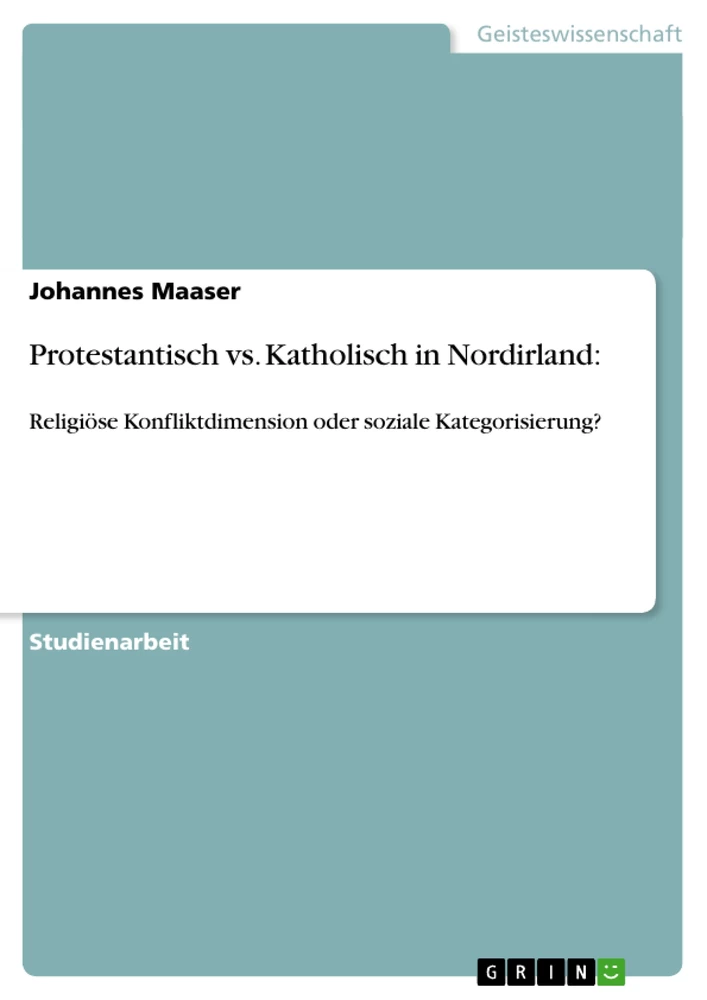„Die Semantik der Moderne setzt vor allem ein kulturell hochspezifisches Temporalschema voraus. Dieses platziert sich gegen die Vorstellung einer grundsätzlichen Konstanz und Wiederholung der Struktur der Humanwelt in der Zeit ebenso wie gegen Modelle zyklischer Geschichte. Es differenziert vielmehr – darin ein christlich-jüdisches Zeitmodell säkularisierend – eindeutig zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, interpretiert die Vergangenheit im Lichte des Gegenwärtigen und Zukünftigen, als dessen Vorstufe es erscheint, und lädt diese unterschiedlichen Zeitperioden mit spezifischen historischen Bedeutungen auf.“ (Bonacker/Reckwitz, 2007. S.8) So lässt sich Erklären, dass eine Konfessionszugehörigkeit vormals Ausdruck ei-ner spezifischen persönlichen und kollektiven Religiosität gewesen sein kann und im Kontext der heutigen gesellschaftlichen Konstellation – durch die Transformation von (sprachlichen) Bedeutungen bzw. (Wert)Inhalten – zu einem primordialen, quasi-natürlichen Merkmal geworden ist, das sich nicht mehr überwiegend durch die Identifikation mit religiösen Überzeugungen und Weltbildern, sondern vermehrt durch Bezugnahme auf ethnische Parameter artikuliert. Im Sinne dieser Leitthese habe ich in dieser Arbeit der Auseinandersetzung mit der sozialen Situation in Nordirland (Kapitel IV.) einen theoretischen Teil vorangestellt, in welchem ich die Konzeption von Identitäten (Kapitel II.), sowie die damit verknüpften Folgen der (sprachlichen) Konstruktion einer Bedrohung (Kapitel III.) skizzieren werde. Abschließend soll ein knapper Ausblick auf die mögliche Beschaffenheit einer erfolgreichen Konfliktregelung gewagt werden (Kapitel V.).
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Identität und Differenz: Konstruktion und Funktion ethnisch definierter Identitäten
- II.I Kriterien von Identitäten
- II.II Grenzziehung und Distinktion
- II.III Innen-Außen-Grenzen: Die Erzählung vom Selbst
- II.IV Funktion der Identität
- III. „Securitization“: Der Mechanismus des Sicherheitsdiskurses
- III.I Die Konstruktion des bedrohlichen Anderen
- III.II „The word security is the act...“: Der Sicherheitssprechakt
- IV. Religion als Marker sozialer Identitäten
- IV.I Die Soziale Bruchlinie der Konfessionen
- IV.II „Sag, wie hältst du´s mit der Religion...?“
- V. Ausblick: Die Institutionalisierung des Konflikts - Chance zur Konstruktion einer neuen Nordirischen Identität?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht ausgewählte Aspekte des Nordirlandkonflikts unter dem Blickwinkel eines ethnisch motivierten Konflikts. Ziel ist es, Ansatzpunkte für eine Interpretation einzelner Aspekte unter gewissen theoretischen Vorüberlegungen zu entwickeln, wobei eine kulturwissenschaftliche und postmodern geprägte Perspektive eingenommen wird. Die Arbeit verzichtet auf eine detaillierte Darstellung der Ereignisse, sondern konzentriert sich auf die Interpretation bestimmter Aspekte.
- Konstruktion und Funktion ethnisch definierter Identitäten
- Der Mechanismus des Sicherheitsdiskurses und die Konstruktion des bedrohlichen Anderen
- Religion als Marker sozialer Identitäten und ihre Rolle im Nordirlandkonflikt
- Die Bedeutung von Grenzziehung und Distinktion für die Entstehung und Aufrechterhaltung ethnischer Gruppen
- Möglichkeiten der Konfliktregelung und Konstruktion einer neuen nordirischen Identität
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt den Nordirlandkonflikt als einen Identitätskonflikt vor, der nicht primär religiös motiviert ist, sondern in dem die konfessionelle Zugehörigkeit durch weitere soziologische Kriterien aufgewertet und problematisiert wird. Die Arbeit fokussiert auf die Interpretation einzelner Aspekte des Konflikts unter einer kulturwissenschaftlichen und postmodernen Perspektive, basierend auf der These, dass die Semantik der Moderne ein spezifisches Temporalschema voraussetzt, das die Vergangenheit im Lichte der Gegenwart und Zukunft interpretiert. Dies erklärt, wie Konfessionszugehörigkeit von einem Ausdruck persönlicher Religiosität zu einem primordialen Merkmal geworden ist, das sich vermehrt durch ethnische Parameter artikuliert.
II. Identität und Differenz: Konstruktion und Funktion ethnisch definierter Identitäten: Dieses Kapitel befasst sich mit dem zentralen Inhalt ethnisch motivierter Konflikte, der meist in der angestrebten Herauslösung von Gruppen aus der Zugehörigkeit zu einem Nationalstaat besteht. Es wird der Begriff der „ethnischen Identität“ aus postmodern-kulturwissenschaftlicher Sicht erläutert, wobei die Definition ethnischer Gruppen nach Anthony Smith und Michael E. Brown diskutiert wird. Die Bedeutung von Kriterien wie gemeinsamem Namen, Abstammung, Geschichte, Kultur und Territorium wird beleuchtet, ebenso wie die Rolle der Grenzziehung und Distinktion nach Frederik Barth. Identitäten manifestieren sich durch negative Abgrenzung, die durch Selbstwahrnehmung und Fremdzuschreibung entsteht.
Schlüsselwörter
Nordirlandkonflikt, ethnische Identität, Identitätskonflikt, Sicherheitsdiskurs, Securitization, Religion, Konfession, Grenzziehung, Distinktion, Postmoderne, Kulturwissenschaft, Identitätskonstruktion, kollektive Identität.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Der Nordirlandkonflikt als Identitätskonflikt
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert den Nordirlandkonflikt unter dem Aspekt eines ethnisch motivierten Konflikts. Er konzentriert sich auf die Interpretation bestimmter Aspekte des Konflikts, anstatt eine detaillierte Darstellung der Ereignisse zu liefern. Die Perspektive ist kulturwissenschaftlich und postmodern geprägt.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die Konstruktion und Funktion ethnisch definierter Identitäten, der Mechanismus des Sicherheitsdiskurses und die Konstruktion des „bedrohlichen Anderen“, Religion als Marker sozialer Identitäten und ihre Rolle im Nordirlandkonflikt, die Bedeutung von Grenzziehung und Distinktion für die Entstehung und Aufrechterhaltung ethnischer Gruppen sowie Möglichkeiten der Konfliktregelung und die Konstruktion einer neuen nordirischen Identität.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Der Text verwendet eine kulturwissenschaftliche und postmodern geprägte Perspektive. Es werden theoretische Überlegungen zu ethnischer Identität (nach Anthony Smith und Michael E. Brown), Grenzziehung und Distinktion (nach Frederik Barth) sowie zum Sicherheitsdiskurs („Securitization“) einbezogen. Die These, dass die Semantik der Moderne ein spezifisches Temporalschema voraussetzt, spielt ebenfalls eine Rolle.
Wie wird der Nordirlandkonflikt im Text dargestellt?
Der Nordirlandkonflikt wird als Identitätskonflikt dargestellt, der nicht primär religiös motiviert ist, sondern in dem die konfessionelle Zugehörigkeit durch weitere soziologische Kriterien aufgewertet und problematisiert wird. Die konfessionelle Zugehörigkeit wird als Ausdruck persönlicher Religiosität gesehen, der sich vermehrt durch ethnische Parameter artikuliert.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel I (Einleitung) stellt den Konflikt vor. Kapitel II („Identität und Differenz“) befasst sich mit der Konstruktion und Funktion ethnischer Identitäten. Kapitel III („Securitization“) analysiert den Sicherheitsdiskurs. Kapitel IV („Religion als Marker“) untersucht die Rolle der Religion im Konflikt. Kapitel V (Ausblick) diskutiert Möglichkeiten einer neuen nordirischen Identität.
Welche Schlüsselwörter sind für den Text relevant?
Schlüsselwörter sind: Nordirlandkonflikt, ethnische Identität, Identitätskonflikt, Sicherheitsdiskurs, Securitization, Religion, Konfession, Grenzziehung, Distinktion, Postmoderne, Kulturwissenschaft, Identitätskonstruktion, kollektive Identität.
Was ist das Ziel des Textes?
Ziel des Textes ist es, Ansatzpunkte für eine Interpretation einzelner Aspekte des Nordirlandkonflikts unter gewissen theoretischen Vorüberlegungen zu entwickeln und somit einen Beitrag zum Verständnis des Konflikts aus einer kulturwissenschaftlichen und postmodernen Perspektive zu leisten.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Johannes Maaser (Autor:in), 2008, Protestantisch vs. Katholisch in Nordirland:, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/113439