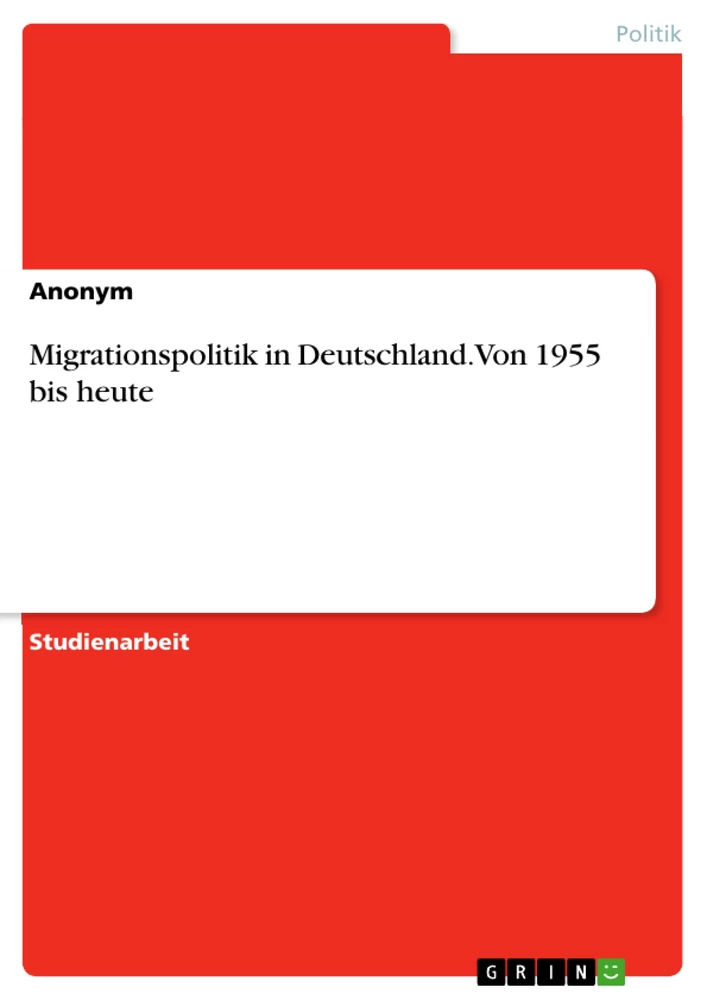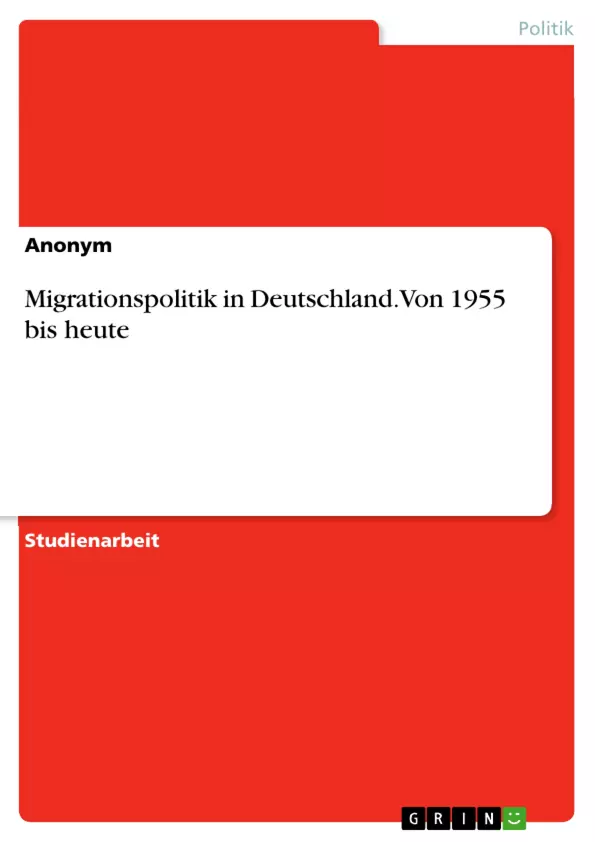Mit dieser Arbeit versuche ich zu zeigen, dass Deutschland mit der Unterzeichnung der ersten Anwerbeabkommen eine Entwicklung zu einem Einwanderungsland durchläuft. Am Ende beantworte ich die These, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist und dabei wird im Verlauf der Arbeit dem Leser eine Perspektive geboten, inwieweit politische Entscheidungen diese Entwicklung beeinflusst haben können.
Die Migration in Deutschland lässt sich in vier Phasen unterteilen. Von 1955 bis 1973 spricht man von der Gastarbeiterphase. Diese Zeitspanne, die auch als Anwerbephase bezeichnet wird, ist dem Namen entsprechend vor allem durch die Unterzeichnung von Anwerbeabkommen mit den "Mittelmeer-Staaten" gekennzeichnet. Im Jahre 1973 beginnt die Phase der ersten Integrationsversuche. Diese dauert bis 1981 an. Hier sind vor allem zwei wesentliche Punkte zu nennen. Einerseits ist ein Anwerbestopp verkündet worden, andererseits wurden Maßnahmen eingeleitet, die das gesellschaftliche Leben der bisher eingewanderten Ausländer betreffen. Ab 1981 geht die Abwehrphase los, die 17 Jahre später, 1998, endet. In diese Zeit fällt ein wichtiges geschichtliches Ereignis. Damit ist der Mauerfall 1989 gemeint.
Der Zusammenbruch der sozialistischen Systeme in Osteuropa löst eine erneute Einwanderungswelle nach Deutschland aus. Dies hat eine Änderung des Asylrechts zur Folge: Die „Drittstaatenregelung“. Zudem ist in diesem Zeitraum insbesondere das Inkrafttreten des Ausländerrechts eine wichtige politische Maßnahme. Anfang der 1990er Jahre erstreckt sich das Bewusstsein über die Integrationsproblematik auf weite Teile der Bevölkerung aus. Seit 1998 bis zum heutigen Tag besteht die Akzeptanzphase. Zwei rechtliche Regelungen vereinfachten die Situation der Migranten in Deutschland. Auf der einen Seite wird durch das Reform des Staatsangehörigkeitsrechts die Einwanderungssituation faktisch anerkannt und auf der anderen Seite ist mit dem Zuwanderungsgesetz das bestehende Ausländerrecht neugestaltet worden. Außerdem rief man den „Integrationsgipfel“ ins Leben, um eine Plattform für Diskussionen zu schaffen, die Probleme der Zuwandererintegration thematisieren. Auch die „Islamkonferenz“ ist eine Möglichkeit den Gedankenaustausch zwischen dem deutschen Staat und der Muslime zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einleitende Gedanken
- 1.2 Fragestellung der Arbeit
- 1.3 Vorgehensweise
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Migration
- 2.2 Personen mit Migrationshintergrund
- 2.3 Aussiedler und Spätaussiedler
- 2.4 Flüchtlinge
- 3. Phasen der Migration in Deutschland von 1955 bis heute
- 3.1 Kurze Zusammenfassung
- 3.2 Gastarbeiterphase (1955-1973)
- 3.3 Konsolidierungsphase (1973 – 1981)
- 3.4 Abwehrphase (1981 – 1998)
- 3.5 Akzeptanzphase (ab 1998)
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Migrationspolitik in Deutschland von 1955 bis heute. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie sich Deutschland von einem Auswanderungsland zu einem Einwanderungsland entwickelt hat und inwieweit politische Entscheidungen diesen Prozess beeinflusst haben. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Phasen der Migration und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen und Veränderungen.
- Entwicklung der Migrationspolitik in Deutschland seit 1955
- Definition und Abgrenzung wichtiger Begriffe im Kontext der Migration
- Analyse der verschiedenen Phasen der Migration (Gastarbeiterphase, Konsolidierungsphase, Abwehrphase, Akzeptanzphase)
- Einfluss politischer Entscheidungen auf das Migrationsgeschehen
- Deutschland als Einwanderungsland: Eine Bilanz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die lange Geschichte der menschlichen Migration und ihren Einfluss auf verschiedene Kulturen und Religionen. Sie betont die Veränderungen im Migrationsgeschehen seit dem Zweiten Weltkrieg, mit Europa als neuem Zielort für Migranten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung Deutschlands zu einem Einwanderungsland und der Frage, ob diese Entwicklung von politischen Entscheidungen beeinflusst wurde. Die Arbeit stellt ihre Forschungsfrage und -methode vor.
2. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen von zentralen Begriffen wie Migration, Personen mit Migrationshintergrund, Aussiedler, Spätaussiedler und Flüchtlinge. Es betont die Bedeutung einer klaren Begrifflichkeit für das Verständnis der weiteren Analyse und weist auf mögliche Abweichungen von der Standarddefinition in der Arbeit hin.
3. Phasen der Migration in Deutschland von 1955 bis heute: Dieses Kapitel unterteilt die Migrationsgeschichte Deutschlands seit 1955 in vier Phasen: Gastarbeiterphase, Konsolidierungsphase, Abwehrphase und Akzeptanzphase. Es bietet zunächst eine kurze Übersicht über die jeweilige Phase, bevor jede Phase detailliert analysiert wird. Die Analyse umfasst politische Entscheidungen, deren Hintergründe und Auswirkungen, sowie statistische Daten und Forschungsergebnisse, die die Entwicklungen veranschaulichen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung der Migrationspolitik in Deutschland von 1955 bis heute
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Migrationspolitik in Deutschland von 1955 bis heute. Sie analysiert, wie sich Deutschland von einem Auswanderungsland zu einem Einwanderungsland entwickelt hat und welchen Einfluss politische Entscheidungen auf diesen Prozess hatten. Die Arbeit betrachtet verschiedene Phasen der Migration und die damit verbundenen Herausforderungen und Veränderungen.
Welche Phasen der Migration werden behandelt?
Die Arbeit gliedert die Migrationsgeschichte Deutschlands seit 1955 in vier Phasen: die Gastarbeiterphase (1955-1973), die Konsolidierungsphase (1973-1981), die Abwehrphase (1981-1998) und die Akzeptanzphase (ab 1998). Jede Phase wird detailliert analysiert, inklusive politischer Entscheidungen, deren Hintergründe und Auswirkungen, sowie relevanter statistischer Daten und Forschungsergebnisse.
Welche Begriffe werden definiert?
Das Dokument enthält präzise Definitionen zentraler Begriffe wie Migration, Personen mit Migrationshintergrund, Aussiedler, Spätaussiedler und Flüchtlinge. Die klare Begrifflichkeit ist wichtig für das Verständnis der Analyse. Mögliche Abweichungen von Standarddefinitionen werden innerhalb der Arbeit erläutert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung der Migrationspolitik in Deutschland seit 1955, die Definition und Abgrenzung wichtiger Begriffe im Kontext der Migration, die Analyse der verschiedenen Migrationsphasen, den Einfluss politischer Entscheidungen auf das Migrationsgeschehen und die Bilanz Deutschlands als Einwanderungsland.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und -methode vorstellt. Es folgt ein Kapitel mit Begriffsdefinitionen. Der Hauptteil befasst sich mit den vier Phasen der Migration in Deutschland. Die Arbeit endet mit einem Fazit.
Welche Quellen werden verwendet?
Die bereitgestellte HTML-Vorschau nennt keine spezifischen Quellen. Die Analyse basiert jedoch auf statistischen Daten und Forschungsergebnissen, die die Entwicklungen in den verschiedenen Migrationsphasen veranschaulichen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist aufzuzeigen, wie sich Deutschland von einem Auswanderungsland zu einem Einwanderungsland entwickelt hat und inwieweit politische Entscheidungen diesen Prozess beeinflusst haben.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Migrationspolitik in Deutschland. Von 1955 bis heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1131080