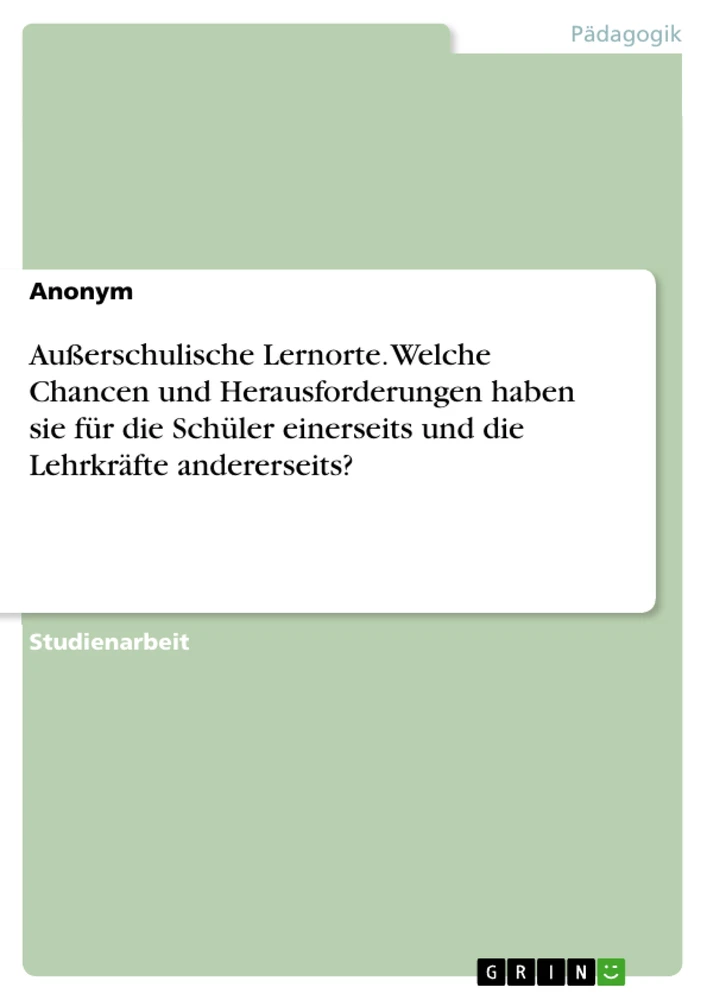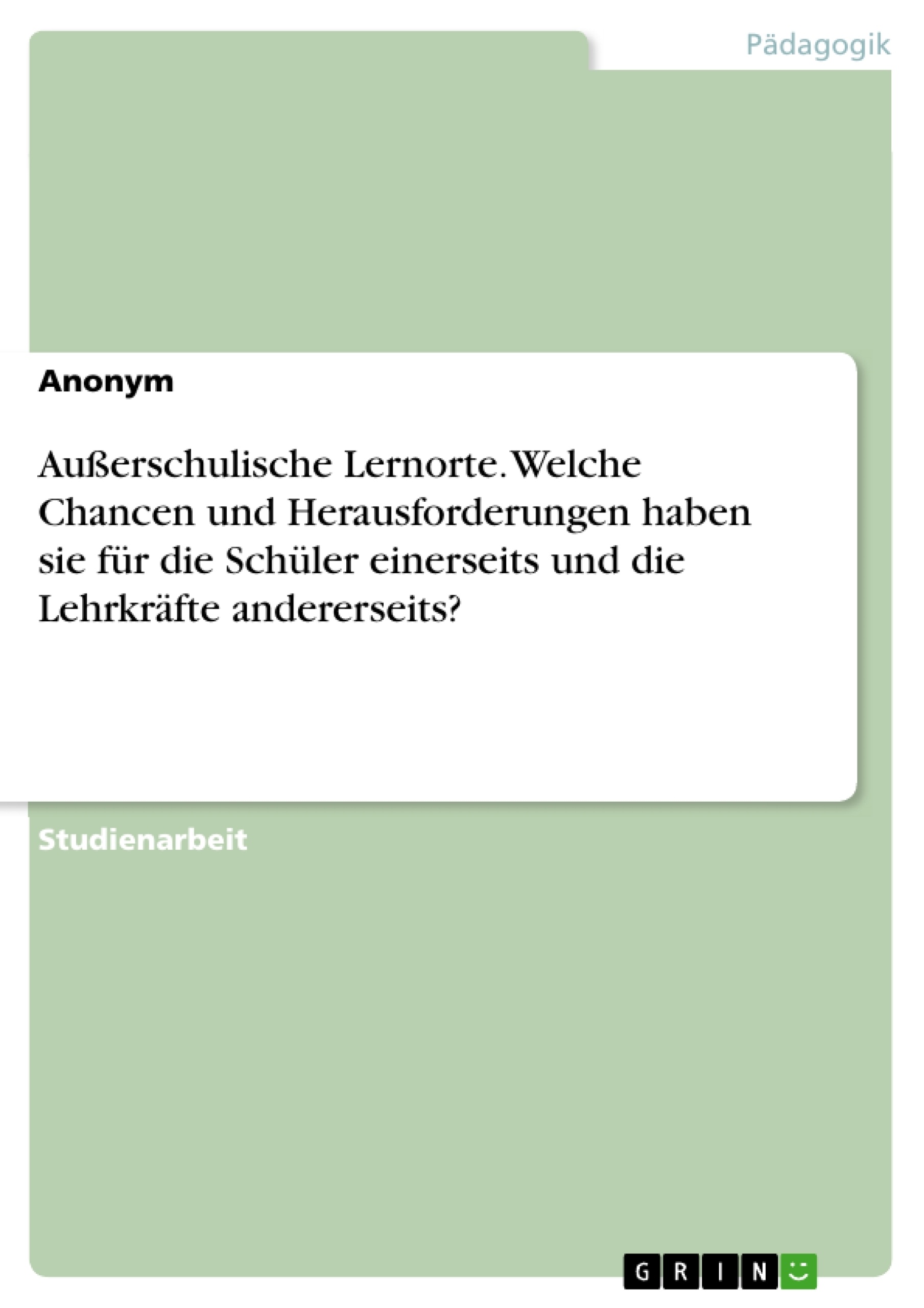Warum bevorzugen Lehrkräfte die außerschulischen Lernorte nicht so häufig? Bringen sie etwa nur Nachteile mit sich? Trägt es eventuell nur einen geringen Anteil zum Lernprozess bei? Hemmt es vielleicht bestimmte Kompetenzen, die der Unterricht im Normalfall fördern sollte? Oder gibt es auch Kompetenzen, die beim Lernen in außerschulischen Orten gefördert werden? Hat es überhaupt bestimmte Vorteile außerhalb vom Klassenzimmer zu lernen?
Mit diesen Fragestellungen beschäftigt sich die folgende Arbeit. Das Ziel dabei ist es zu untersuchen, welche Chancen und Herausforderungen die außerschulischen Lernorte für Schülerinnen und Schüler (SuS) und Lehrerinnen und Lehrer (LuL) haben.
Zunächst wird im ersten Kapitel der Arbeit ein Rückblick in die Vergangenheit gewonnen, bei der dabei die Geschichte des außerschulischen Lernens reflektiert wird. Dann wird der Begriff des außerschulischen Lernens definiert, wobei auch auf die unterschiedlichen Klassifikationen dieser eingegangen wird. Im Anschluss daran wird ein Blick in den Lehrplan für die Grundschulen in Nordrhein-Westfalen geworfen, um festzustellen, welche Rolle die außerschulischen Lernorte darin spielen.
Jeder kennt die folgende Situation aus der eigenen Schulzeit. Die Schüler werden im Unterricht dazu aufgefordert lange, komplizierte Texte mit vielen Fachbegriffen und Erklärungen zu lesen. Durch den Schwierigkeitsgrad sowie auch durch die Menge des neuen Wissens wird der Lernprozess bzw. auch der Verstehensprozess erschwert. Wie oft dachte man sich dann als Schüler, dass es doch eigentlich so einfach gewesen wäre, als Lehrperson den fachlichen Schwerpunkt leichter in der Praxis zu veranschaulichen, sodass man es schneller versteht? Als Schüler verstand man nicht, warum etwas eigentlich Einfaches kompliziert gelehrt wurde, wenn es doch auch durch die Veranschaulichung an der realen Praxis einfacher gewesen wäre. So hätten viele Aspekte des fachlichen Wissens auch in einer unmittelbaren Sachbegegnung verdeutlicht werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Früher und heute
- 2.1 Historie
- 3. Durchführung im Dreischritt...
- 4. Reflektion der Chancen und Herausforderungen.
- 5. Fazit.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Chancen und Herausforderungen außerschulischer Lernorte für Schülerinnen und Schüler (SuS) sowie Lehrerinnen und Lehrer (LuL). Sie beleuchtet die historische Entwicklung des außerschulischen Lernens, definiert den Begriff und betrachtet dessen Rolle im Lehrplan der Grundschulen in Nordrhein-Westfalen.
- Historische Entwicklung des außerschulischen Lernens
- Definition des außerschulischen Lernens
- Rolle außerschulischer Lernorte im Lehrplan
- Chancen und Herausforderungen des außerschulischen Lernens für SuS
- Chancen und Herausforderungen des außerschulischen Lernens für LuL
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Fragestellung der Arbeit dar. Im zweiten Kapitel wird ein Rückblick auf die Geschichte des außerschulischen Lernens geworfen, der Begriff definiert und dessen Einordnung in den Lehrplan für Grundschulen in NRW beleuchtet. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Durchführung der didaktischen Unterrichtsmethode, die in einem Dreischritt beschrieben wird.
Schlüsselwörter
Außerschulisches Lernen, Lernorte, Chancen, Herausforderungen, Didaktik, Schüler, Lehrer, Lehrplan, Grundschule, Nordrhein-Westfalen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Außerschulische Lernorte. Welche Chancen und Herausforderungen haben sie für die Schüler einerseits und die Lehrkräfte andererseits?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1130303