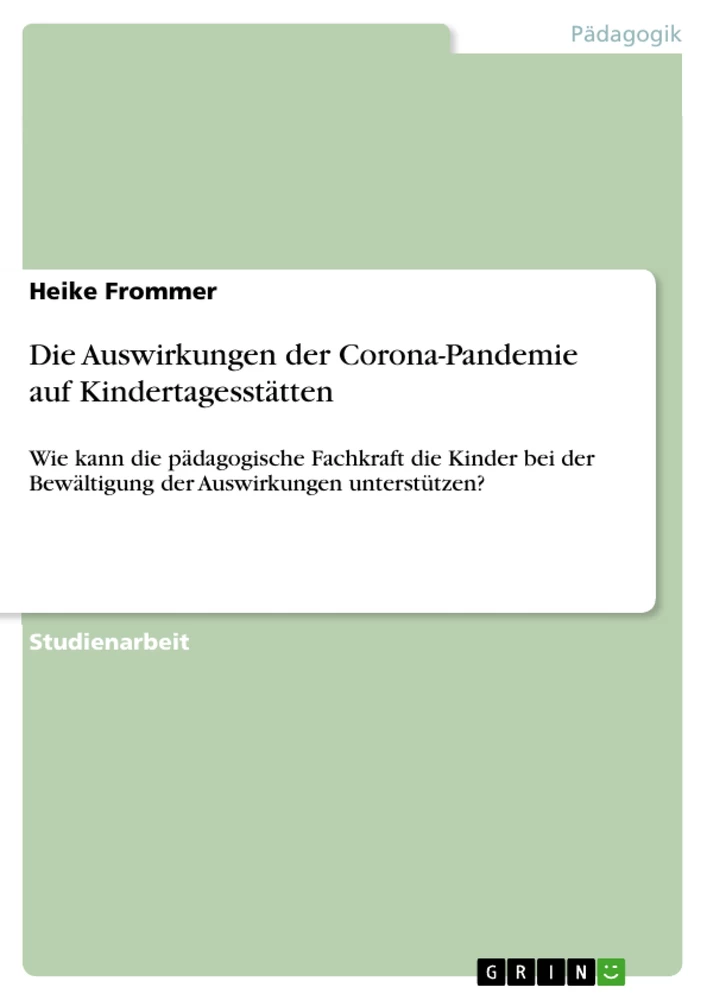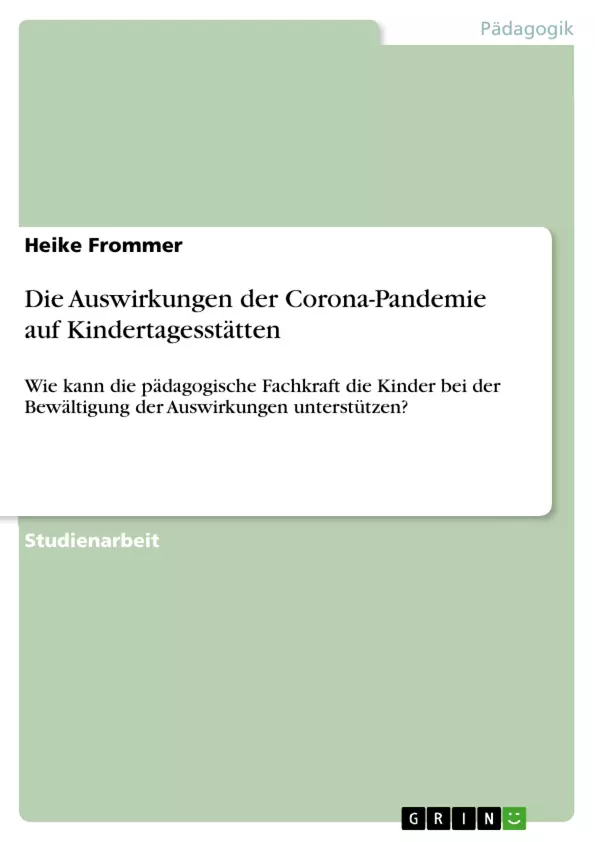Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie bei Kindern ausgelöst haben könnte, soll in dieser Arbeit behandelt werden. Da die Corona-Pandemie im aktuellen gesellschaftlichen Leben weiterhin präsent und der weitere Verlauf nicht absehbar ist, existieren aktuell wenig wissenschaftliche Quellen über die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei Kindern. Deshalb wird in dieser Arbeit der Frage nachgegangen, inwieweit die Corona-Pandemie als kritisches Lebensereignis zu betrachten ist.
Anhand des Ergebnisses dieser Überprüfung soll verglichen werden, welche Auswirkungen kritischer Lebensereignisse auch bei der aktuellen Pandemie zutreffen könnten. Die zentrale Forschungsfrage, die im Rahmen dieser Arbeit behandelt werden soll, ist, wie die pädagogische Fachkraft die Kinder im System Kindertagesstätten bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie unterstützen kann.
Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch des Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) vor dem Hintergrund der zunehmend globalen Ausbreitung offiziell zur Pandemie. Folgend wurden durch die Bundesregierung und die einzelnen Bundesländer auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG weitere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus festgelegt. Davon betroffen waren auch die Kindertagesstätten in ganz Deutschland. Mit der Schließung der Kindertagesstätten in der 12. Kalenderwoche 2020 brach für die Kinder im System Kindertagesstätte der gewohnte Alltag mit den sozialen Kontakten zusammen. Seitdem durchleben die Kinder die verschiedenen Phasen der Corona-Pandemie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Ist die Corona-Pandemie ein kritisches Lebensereignis?
- 1.1 Begriff „Kritisches Lebensereignis“
- 1.2 Bezug zur Corona-Pandemie
- 2 Auswirkungen kritischer Lebensereignisse auf die Kinder
- 2.1 Bezug zur Corona-Pandemie
- 2.2 Positive Auswirkungen
- 2.3 Negative Auswirkungen
- 3 Bewältigung der Auswirkungen mit der pädagogischen Fachkraft
- 3.1 Bindungsperson pädagogische Fachkraft
- 3.2 Kinder in der Kindertagesstätte
- 3.3 Kinder im familiären Umfeld
- 3.4 Prävention
- 4 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das System Kindertagesstätte. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und die Rolle der pädagogischen Fachkraft bei der Bewältigung dieser Auswirkungen.
- Einstufung der Corona-Pandemie als kritisches Lebensereignis
- Auswirkungen kritischer Lebensereignisse auf Kinder im Kontext der Pandemie
- Positive und negative Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder
- Unterstützungsmöglichkeiten der pädagogischen Fachkraft für Kinder im Umgang mit den Auswirkungen der Pandemie
- Bedeutung von Bindung und Prävention für Kinder in Zeiten der Corona-Pandemie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 befasst sich mit der Frage, ob die Corona-Pandemie als kritisches Lebensereignis einzustufen ist. Dabei werden die Merkmale kritischer Lebensereignisse definiert und auf die Situation der Kinder während der Pandemie bezogen.
Kapitel 2 beleuchtet die Auswirkungen eines kritischen Lebensereignisses auf Kinder und untersucht die spezifischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von Kindern. Es werden sowohl positive als auch negative Auswirkungen, die im Rahmen von Studien wie der COPSY-Studie und der Corona-KiTa-Studie erforscht wurden, beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich der Rolle der pädagogischen Fachkraft bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder. Es werden verschiedene Strategien und Maßnahmen vorgestellt, die die pädagogische Fachkraft einsetzen kann, um Kinder zu unterstützen und ihnen Sicherheit und Orientierung in dieser besonderen Situation zu bieten.
Schlüsselwörter
Corona-Pandemie, kritisches Lebensereignis, Kindertagesstätte, pädagogische Fachkraft, Auswirkungen, Bewältigung, Bindung, Prävention, Studien, COPSY-Studie, Corona-KiTa-Studie, Familien & Kitas in der Corona-Zeit, Kind sein in Zeiten von Corona.
Häufig gestellte Fragen
Gilt die Corona-Pandemie als „kritisches Lebensereignis“ für Kinder?
Ja, da sie den gewohnten Alltag unterbrach, soziale Kontakte einschränkte und eine hohe Anpassungsleistung von den Kindern forderte.
Welche negativen Auswirkungen hatte die Pandemie auf Kita-Kinder?
Studien wie die COPSY-Studie zeigen vermehrt psychische Belastungen, Ängste und Defizite in der sozialen Interaktion durch die Schließungen.
Wie können Erzieher Kinder bei der Bewältigung unterstützen?
Pädagogische Fachkräfte dienen als stabilisierende Bindungspersonen, die Sicherheit vermitteln, Ängste thematisieren und soziale Lernprozesse wieder fördern.
Was sagt die Corona-KiTa-Studie aus?
Die Studie untersucht die Auswirkungen der Schließungen und Hygieneauflagen auf den pädagogischen Alltag und das Wohlbefinden von Kindern und Personal.
Welche Rolle spielt die Prävention in diesem Zusammenhang?
Präventive Maßnahmen zielen darauf ab, die Resilienz der Kinder zu stärken, um langfristige psychische Folgen der Pandemie zu minimieren.
- Arbeit zitieren
- Heike Frommer (Autor:in), 2021, Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kindertagesstätten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1129412