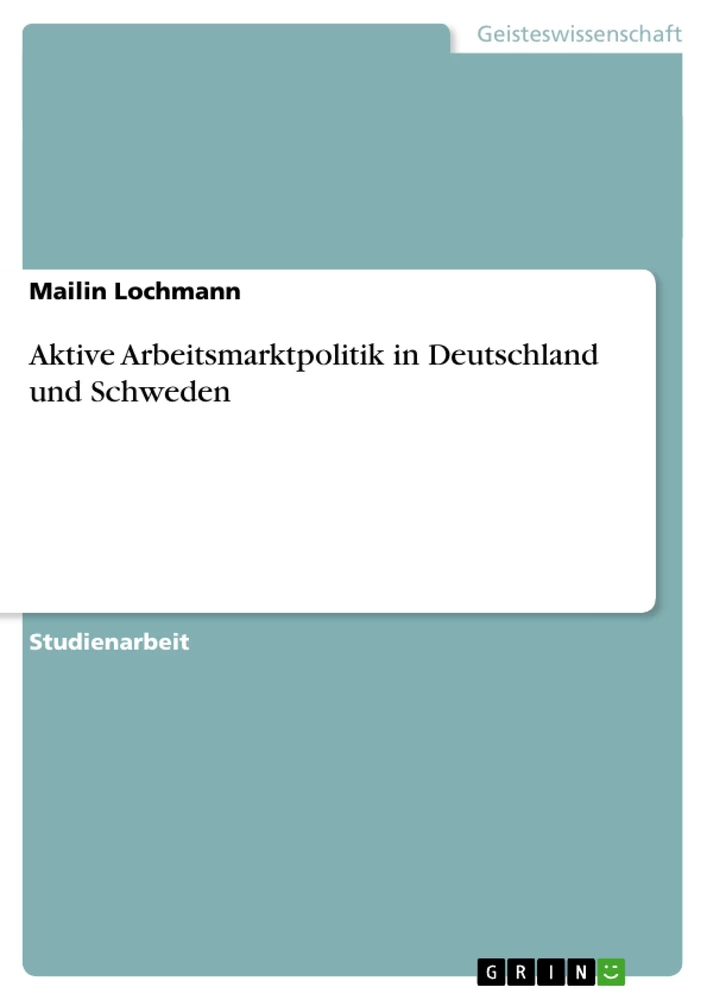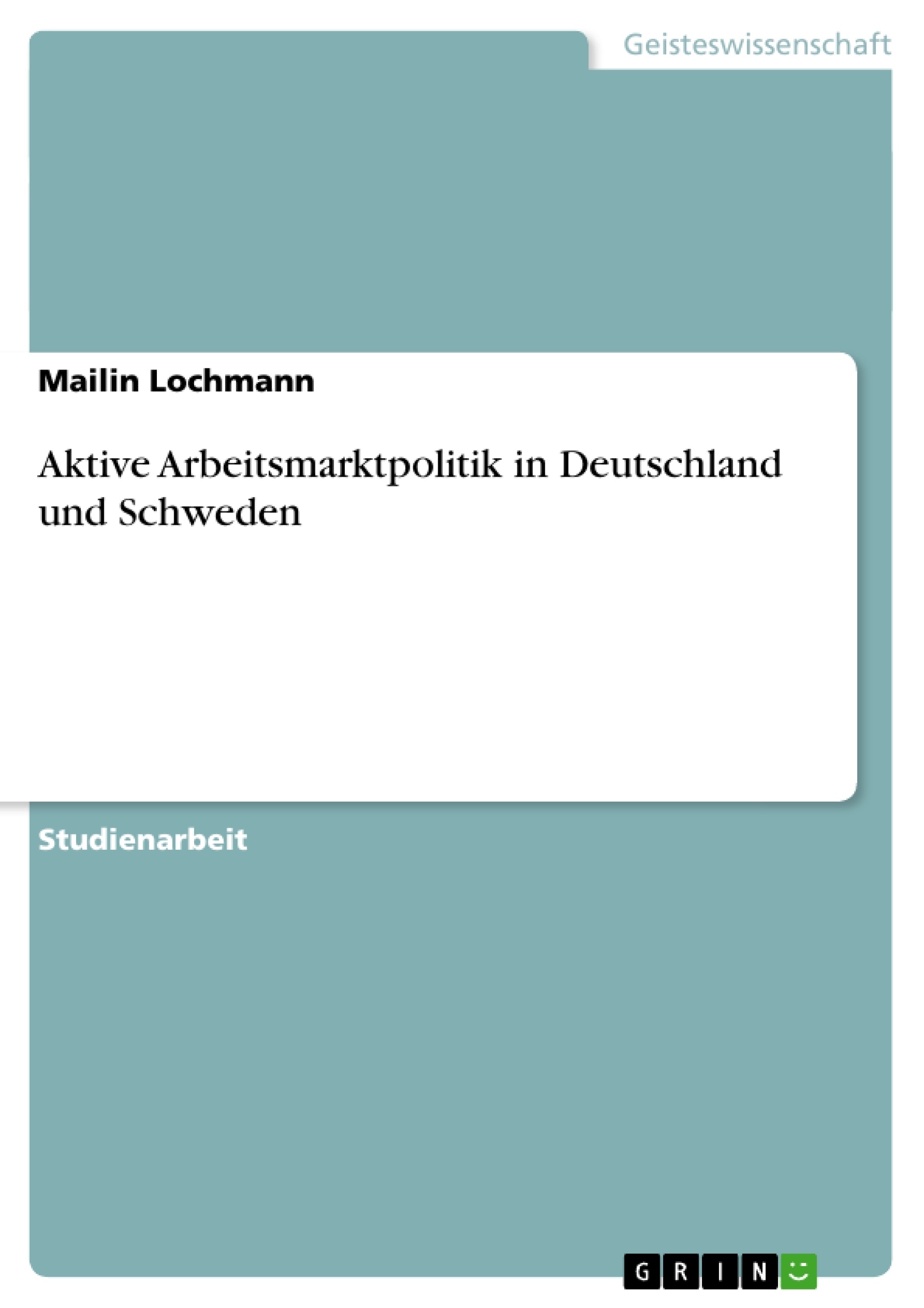Laut OECD – Bericht ist seit Beginn der 80er Jahre in den beteiligten Ländern ein stetiger Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen, was zunehmend zu einem Massenproblem wird. Die Prophezeiungen mancher Autoren in den 90er Jahren lauteten daher „das Ende der Arbeit“ von Jeremy Rifkin, oder in der „Globalisierungsfalle“. In ihnen wird die Zukunft der Industrienationen als 20:80 Gesellschaft gesehen, die nicht ohne gesellschaftliche und staatliche Intervention zu verbessern ist. Da die Zukunft nicht vorhersehbar ist, ist es ungewiss was aus der Arbeitsgesellschaft wird und ob die Arbeitslosigkeit langfristig überwunden werden kann. Tatsächlich ist es so, dass durch Flexibilisierung und Deregulierung die prekäre oder atypischen Beschäftigungsverhältnisse zunehmen, ein Auseinanderklaffen zwischen Hochqualifizierten und Geringqualifizierten am Arbeitsmarkt beobachtet werden kann und dass die Rate der Langzeitarbeitslosigkeit tendenziell ansteigt. Ist ein Anstieg der Arbeitslosenrate zu verzeichnen, dann beginnt meistens auch die Diskussion über die sogenannten Sozialschmarotzer. In der Regel wird das Problem der Arbeitslosigkeit meist individualisiert und die Arbeitslosen werden stigmatisiert. Doch eigentlich müsste man sich Gedanken darüber machen, wie man die Arbeit neu- bzw. umverteilen kann.
Zu Beginn soll eine Einordnung von Deutschland und Schweden in die Modelle Esping Andersens vorgenommen werden. Danach sollen die Grundlagen der aktiven Arbeitsmarktpolitik im allgemeinen näher erläutern werden, daran anschließen soll die angebotsorientierte Position der nachfrageorientierten Position in der Ökonomie gegenübergestellt werden und die Arten und Ursachen der Arbeitslosigkeit beschrieben werden. Abschließend sollen die verschiedenen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in Deutschland und Schweden aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einordnung in die Modelle Esping Andersens
- Grundlagen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
- Das Angebot an Arbeitsleistungen
- Die Nachfrage der Arbeitsleistungen
- Ausgleichsprozesse und Ungleichgewichte am Arbeitsmarkt
- Die Wirkungen der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
- Aktive Arbeitsmarktpolitik in Deutschland
- kurzer historischer Rückblick
- Träger der Arbeitsmarktpolitik
- Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
- Maßnahmen der Angebotsseite
- Maßnahmen der Nachfrageseite
- Das neue Sozialgesetzbuch III
- gegenwärtige Arbeitsmarktpolitik
- wichtige arbeitsmarktpolitische Instrumente (gem. SGB III bzw. AFG)
- Aktive Arbeitsmarktpolitik in Schweden
- kurzer historischer Rückblick
- Träger der Arbeitsmarktpolitik
- Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
- Maßnahmen der Angebotsseite
- Maßnahmen der Nachfrageseite
- gegenwärtige Arbeitsmarktpolitik
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Deutschland und Schweden. Sie zielt darauf ab, die beiden Länder im Kontext der Modelle Esping Andersens einzuordnen und die Grundlagen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu erläutern. Dabei werden die angebots- und nachfrageorientierten Positionen der Ökonomie gegenübergestellt, die verschiedenen Arten und Ursachen der Arbeitslosigkeit beschrieben sowie die spezifischen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in Deutschland und Schweden aufgezeigt.
- Einordnung von Deutschland und Schweden in die Modelle Esping Andersens
- Grundlagen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
- Angebots- und Nachfrageseite des Arbeitsmarktes
- Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in Deutschland
- Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in Schweden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die steigende Arbeitslosigkeit seit den 1980er Jahren und die damit einhergehende Diskussion über die Zukunft der Arbeitsgesellschaft. Das zweite Kapitel ordnet Deutschland und Schweden in die Modelle Esping Andersens ein, wobei Deutschland dem konservativen und Schweden dem sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat zugeordnet werden.
Das dritte Kapitel erläutert die Grundlagen der aktiven Arbeitsmarktpolitik und stellt die klassisch/neoliberale und die keynesianische Theorie gegenüber. Es werden die Bedeutung von Angebot und Nachfrage sowie die Ursachen für Arbeitslosigkeit behandelt.
Das vierte Kapitel widmet sich der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Deutschland. Es gibt einen kurzen historischen Rückblick, stellt die Träger der Arbeitsmarktpolitik vor und erläutert die verschiedenen Maßnahmen, sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Schließlich wird das neue Sozialgesetzbuch III und die aktuelle Arbeitsmarktpolitik in Deutschland behandelt.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Schweden. Es folgt einem ähnlichen Aufbau wie das vierte Kapitel und behandelt die schwedische Arbeitsmarktpolitik, einschließlich ihrer Geschichte, Träger und Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Arbeitsmarktpolitik, Wohlfahrtsstaat, Esping Andersen, Angebot und Nachfrage, Arbeitslosigkeit, Deutschland, Schweden, Sozialgesetzbuch III, aktive Arbeitsmarktpolitik, Maßnahmen der Angebotsseite, Maßnahmen der Nachfrageseite.
- Quote paper
- Mailin Lochmann (Author), 2003, Aktive Arbeitsmarktpolitik in Deutschland und Schweden, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/11276