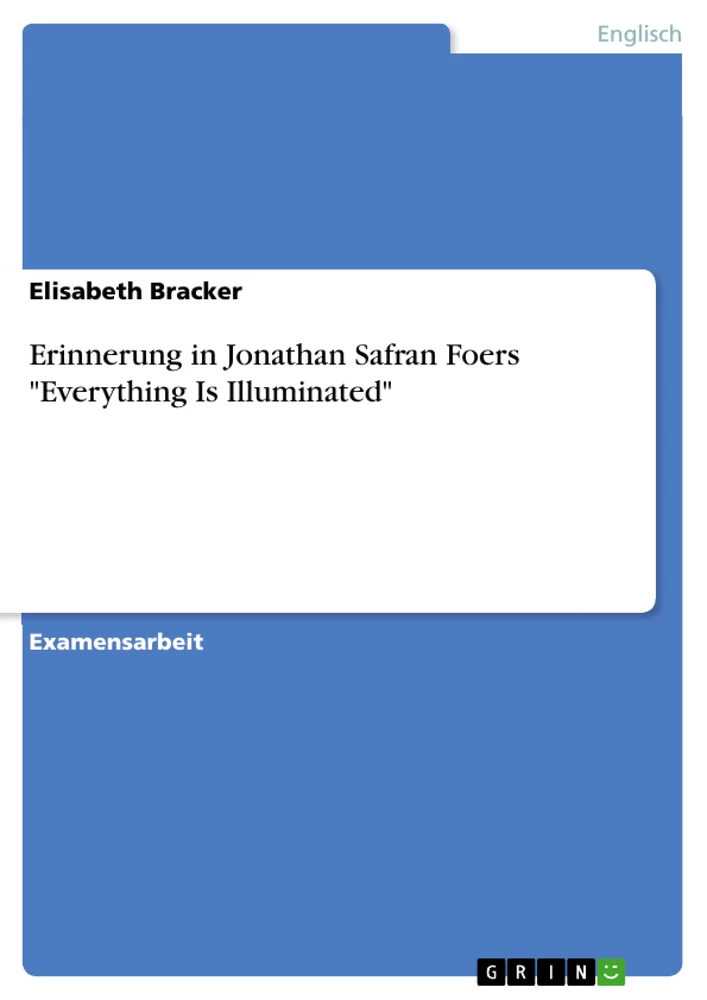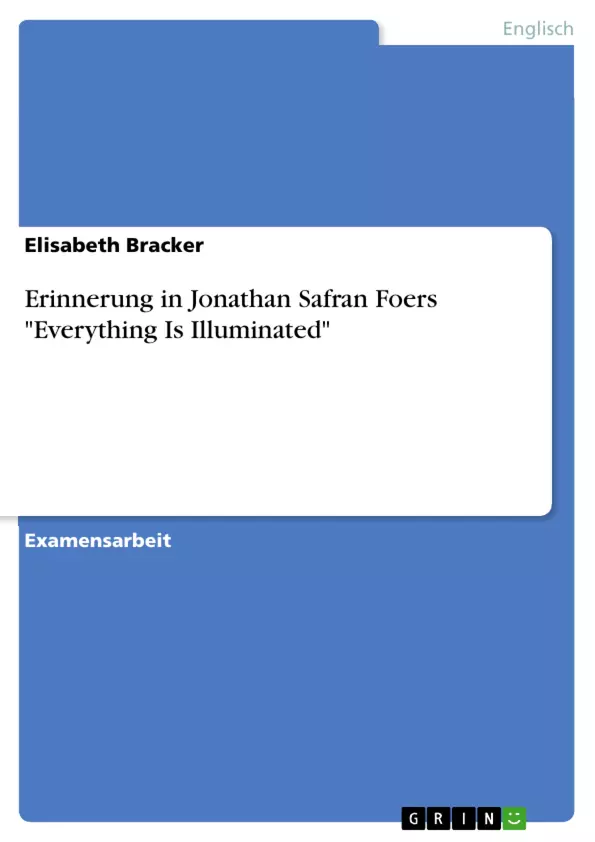Dieser Ausruf Queen Elizabeths in William Shakespeares Drama Richard III stellt das zirkulare und unabdingbare Verhältnis von Erinnerung und Identität heraus. Diese Kernfrage unserer Existenz ist auch das Leitmotiv Jonathan Safran Foers Roman Everything Is Illuminated . Die Identitätsstiftung über die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist nicht nur für das einzelne Individuum gewährleistet, sondern gilt gleichermaßen auch für Kollektive wie soziale Gruppen, Gesellschaften und Kulturen. Im gemeinsamen Erinnern an Vergangenes, wie es sich in Traditionen, Riten und Jahrestagen, aber auch über bedeutsame Schriften, Denkmäler, Gebäude und in anderen mnemonischen Symbolen niederschlägt, entwickelt sich ein kollektives Selbstverständnis von der gemeinsamen Vergangenheit vor dem Geschehen einer sich ständig wandelnden Gegenwart. Ein kollektives Selbstbild stützt sich maßgeblich auf materielle Erinnerungsträger, auf Repräsentationen also, über welche der Erhalt der zu erinnernden Vergangenheit über die Zeit hinweg gesichert werden kann.
Dieses scheinbar selbstverständliche Verhältnis von Erinnerung und Identität über eine Repräsentation des Vergangenen ist jedoch seit Mitte des 20. Jahrhunderts in ein neues Licht gerückt: Mit dem Holocaust brach ein Ereignis in den Lauf der Geschichte ein, welches häufig als ein historisches Moment bezeichnet wird, welches alles Bisherige transzendiert, sich über die Geschichte selbst stellt. Dieser Feststellung hat sich ein von einigen Autoren – unter ihnen der Holocaust-Überlebende Elie Wiesel – postuliertes Darstellungsverbot des Holocaust angeschlossen: Die Schrecken der Shoah sind schlicht in keine Vor- und somit auch in keine Darstellung zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Die Anfänge: Halbwachs' Konzept des „Kollektiven Gedächtnisses“
- Pierre Noras « Lieux de Mémoire »
- Das Assmannsche,, Kulturelle Gedächtnis" und die Differenzierung von ,,Speicher- und Funktionsgedächtnis"
- Holocaust-Erinnerung in den Vereinigten Staaten
- Jonathan Safran Foers Everything Is Illuminated
- Trachimbrod: Die Kulturgeschichte eines Schtetls
- Die Rolle mnemonischer Symbole für das kollektive Gedächtnis Trachimbrods
- Was ist Geschichte? Die Frage im Spannungsverhältnis von Bewahren und
Neugestalten
- Die konservierte Vergangenheit - das Speichergedächtnis als unbeseelter Erinnerungsträger
- History repeating - oder: wir alle schreiben Geschichte
- Das Formspiel der Geschichtsschreibung im intersubjektiven Beziehungsgeflecht
- There was nothing - Die Nicht-Darstellung des Holocaust
- Die Würdigung des Unvorstellbaren über die Repräsentation
- "This is not true," Grandfather said. – Die zerberstende Maske des Selbstschutzes
- Schlussbetrachtung und Ausblick: Die ewige Suche
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Thematik der Erinnerung in Jonathan Safran Foers Roman „Everything Is Illuminated“. Ziel ist es, die Rolle der Erinnerung und des Erinnerns im Roman zu analysieren und zu untersuchen, wie Foer die komplexe Beziehung zwischen individueller und kollektiver Erinnerung in Bezug auf den Holocaust darstellt.
- Die Bedeutung des kollektiven Gedächtnisses für die Identitätsstiftung
- Die Rolle von mnemonischen Symbolen und Repräsentationen in der Erinnerung
- Das Spannungsverhältnis zwischen Undarstellbarkeit und Notwendigkeit des Erinnerns
- Die Frage nach der Geschichte und der Möglichkeit, sie zu bewahren und neu zu gestalten
- Die Darstellung des Holocaust in der Literatur und die Grenzen der Repräsentation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Erinnerung und Identität ein und stellt die zentrale Frage nach dem Verhältnis von Erinnerung und Identität im Kontext des Holocaust. Sie skizziert die Problematik der Darstellung des Holocaust und die Notwendigkeit eines Darstellungsmittels, welches sich im Spannungsfeld zwischen Undarstellbarkeit und Erinnerung bewegt.
Der theoretische Teil der Arbeit stellt wichtige Gedächtnistheorien von Maurice Halbwachs, Pierre Nora und Jan und Aleida Assmann vor. Er beleuchtet die Konzepte des „Kollektiven Gedächtnisses“, der „Lieux de Mémoire“ und des „Kulturellen Gedächtnisses“ und zeigt deren Relevanz für die Analyse von Foers Roman.
Im Kapitel über Jonathan Safran Foers „Everything Is Illuminated“ wird zunächst die Kulturgeschichte des fiktiven Schtetls Trachimbrod untersucht. Dabei wird die Rolle mnemonischer Symbole für das kollektive Gedächtnis Trachimbrods beleuchtet.
Das Kapitel „Was ist Geschichte?“ beschäftigt sich mit der Frage nach der Geschichte und dem Spannungsverhältnis zwischen Bewahren und Neugestalten. Es analysiert die Rolle des Speichergedächtnisses und die Möglichkeit, Geschichte neu zu schreiben.
Das Kapitel „There was nothing - Die Nicht-Darstellung des Holocaust“ untersucht die Frage nach der Darstellung des Holocaust in der Literatur und die Grenzen der Repräsentation. Es analysiert die Strategien, die Foer einsetzt, um die Schrecken des Holocaust zu würdigen, ohne sie explizit darzustellen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Erinnerung, das kollektive Gedächtnis, die Identität, den Holocaust, die Darstellung, die Repräsentation, die Geschichte, die Literatur, Jonathan Safran Foer, „Everything Is Illuminated“, Trachimbrod, Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Jan und Aleida Assmann.
- Trachimbrod: Die Kulturgeschichte eines Schtetls
- Quote paper
- Elisabeth Bracker (Author), 2008, Erinnerung in Jonathan Safran Foers "Everything Is Illuminated", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/112397