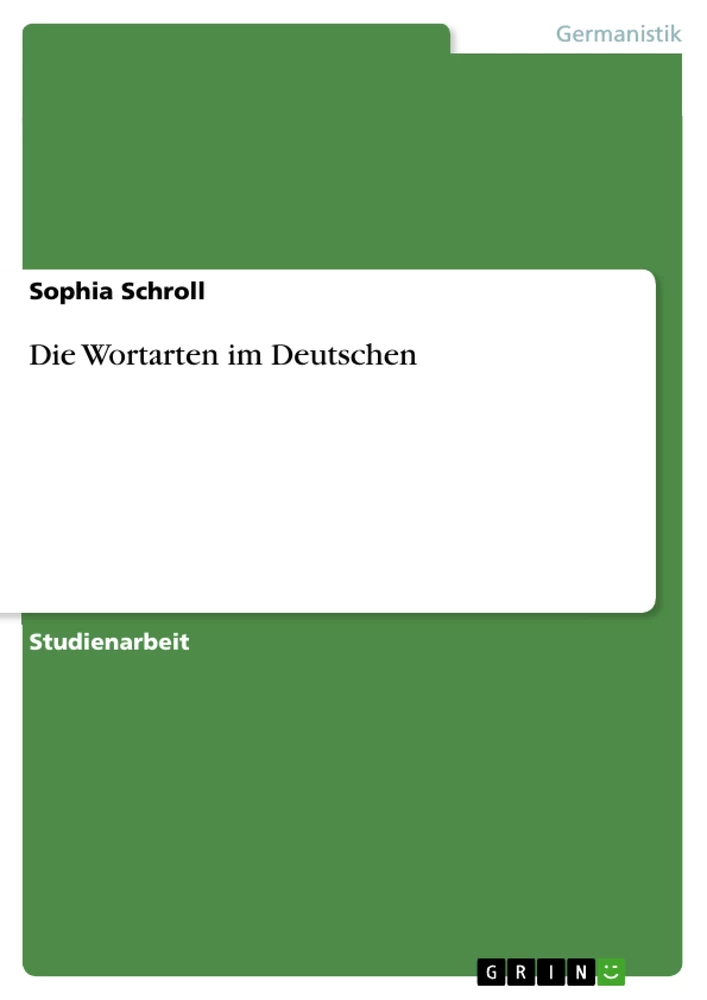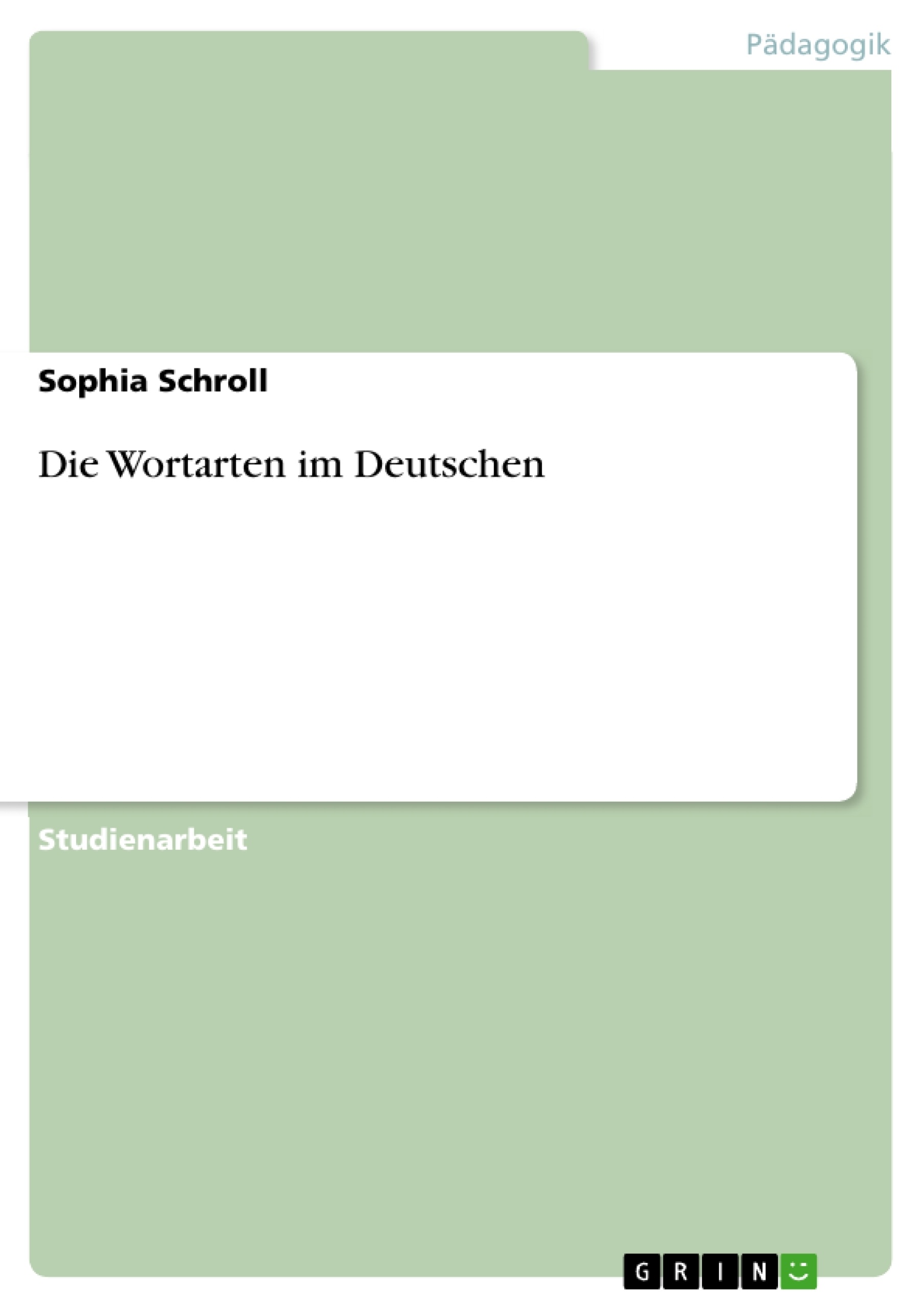Sinn einer Grammatik ist es unter anderem, Regeln zu formulieren, wie aus Wörtern Sätze gebildet werden. Sie interessiert sich dabei aber nicht für jedes einzelne dieser gewaltigen Anzahl von Wörtern, sondern versucht, Wörter mit ähnlichen oder gleichen Eigenschaften zu klassifizieren. Diese Arbeit soll sich vor allem mit den unterschiedlichen Möglichkeiten einer Klassifikation der Wörter beschäftigen und einen Einblick in die syntaktischen Kategorien, allen voran den lexikalischen, gewähren. Anhand der „Zehn-Wortarten-Lehre“ der traditionellen Grammatik, sowie der „Fünf-Wortarten-Lehre“ von Hans Glinz aus den 50er Jahren soll näher auf die Zuordnung der Wörter zu Wortarten und auf ihre weitere Subklassifizierung eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Wortarten
- Möglichkeiten zur Klassifikation von Wörtern
- Semantische Gesichtspunkte
- Klassifikation nach morphosyntaktischen Gesichtspunkten
- Lexikalische Kategorien
- Die „Zehn-Wortarten-Lehre“ der traditionellen Grammatik
- Die Einteilung in Wortarten nach morphologischen Kriterien (nach Pittner/Berman)
- Die „Fünf-Wortarten-Lehre“ nach Hans Glinz
- Die Subklassifikation der Wortarten
- Konjugierbare Wortarten
- Die Vollverben
- Die Hilfsverben (Auxiliare)
- Die Modalverben
- Kopulaverben
- Deklinierbare Wortarten
- Die Substantive/Nomen
- Die Adjektive
- Die Begleiter oder Stellvertreter
- Unflektierbare Wortarten
- Die Adverbien
- Die Präpositionen
- Die Konjunktionen
- Die Partikel
- Konjugierbare Wortarten
- Möglichkeiten zur Klassifikation von Wörtern
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Möglichkeiten der Wortklassifikation im Deutschen. Hauptziel ist es, einen Überblick über die syntaktischen Kategorien, insbesondere die lexikalischen, zu geben. Die Arbeit vergleicht dabei die traditionelle „Zehn-Wortarten-Lehre“ mit der „Fünf-Wortarten-Lehre“ nach Glinz und bezieht moderne Grammatiken, wie das Werk von Pittner und Berman, mit ein.
- Vergleich verschiedener Ansätze zur Wortklassifikation (semantisch vs. morphosyntaktisch).
- Detaillierte Betrachtung der „Zehn-Wortarten-Lehre“ und ihrer morphosyntaktischen Grundlagen.
- Analyse der „Fünf-Wortarten-Lehre“ nach Hans Glinz.
- Untersuchung der Subklassifizierung von Wortarten.
- Einbezug moderner grammatikalischer Ansätze.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Zweck der Arbeit: die Untersuchung unterschiedlicher Möglichkeiten der Wortklassifikation im Deutschen und den Einblick in syntaktische Kategorien. Sie benennt die „Zehn-Wortarten-Lehre“ der traditionellen Grammatik und die „Fünf-Wortarten-Lehre“ von Hans Glinz als zentrale Bezugspunkte und kündigt die Einbeziehung moderner Grammatiken, insbesondere von Pittner und Berman, an. Die Einleitung legt den Fokus auf morphosyntaktische Aspekte der Wortklassifikation.
Die Wortarten: Möglichkeiten zur Klassifikation von Wörtern: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Kriterien zur Wortklassifikation, beginnend mit einem kurzen Überblick über semantische Aspekte wie die Unterscheidung von Autosemantika und Synsemantika, sowie Abstrakta und Konkreta. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der morphosyntaktischen Klassifikation, die als Grundlage für die „Zehn-Wortarten-Lehre“ und die „Fünf-Wortarten-Lehre“ dient. Es wird deutlich, dass die morphosyntaktischen Eigenschaften der Wörter die Grundlage für die Klassifizierung bilden.
Die Wortarten: Lexikalische Kategorien: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der „Zehn-Wortarten-Lehre“ der traditionellen Grammatik. Es werden die zehn Wortarten (Substantiv, Verb, Adjektiv, Artikel, Pronomen, Adverb, Konjunktion, Präposition, Numerale, Interjektion) vorgestellt und die Schwierigkeiten bei der eindeutigen Zuordnung aufgrund der manchmal unscharfen Grenzen zwischen semantischen und morphosyntaktischen Kriterien diskutiert. Die Herausforderungen bei der Klassifizierung von Wörtern wie Numeralen, die sowohl semantische als auch morphosyntaktische Merkmale aufweisen, werden erläutert.
Die Wortarten: Die Subklassifikation der Wortarten: Dieses Kapitel befasst sich mit der detaillierten Unterteilung der Wortarten in Subkategorien. Es wird unterschieden zwischen konjugierbaren Wortarten (Vollverben, Hilfsverben, Modalverben, Kopulaverben) und deklinierbaren Wortarten (Substantive, Adjektive, Begleiter/Stellvertreter). Die unflektierbaren Wortarten (Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen, Partikel) werden ebenfalls behandelt. Der Fokus liegt auf den morphosyntaktischen Merkmalen, die die Subklassifizierung bestimmen.
Schlüsselwörter
Wortarten, Wortklassifikation, Semantik, Morphosyntax, „Zehn-Wortarten-Lehre“, „Fünf-Wortarten-Lehre“, Pittner/Berman, Substantiv, Verb, Adjektiv, Konjugation, Deklination, Funktionswörter, Distribution.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Wortklassifikation im Deutschen"
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Wortklassifikation im Deutschen. Es vergleicht verschiedene Ansätze, insbesondere die traditionelle „Zehn-Wortarten-Lehre“ mit der „Fünf-Wortarten-Lehre“ nach Glinz und berücksichtigt moderne grammatikalische Perspektiven (z.B. Pittner/Berman).
Welche Wortarten werden behandelt?
Das Dokument behandelt alle gängigen Wortarten, einschließlich Substantive, Verben, Adjektive, Artikel, Pronomen, Adverbien, Konjunktionen, Präpositionen, Numeralien und Interjektionen. Es geht dabei sowohl auf die Hauptklassen als auch auf deren Subklassifizierung ein (z.B. Vollverben, Hilfsverben, Modalverben).
Welche Kriterien zur Wortklassifizierung werden untersucht?
Das Dokument analysiert sowohl semantische als auch morphosyntaktische Kriterien zur Wortklassifizierung. Der Schwerpunkt liegt auf den morphosyntaktischen Eigenschaften, da diese die Grundlage für die meisten Klassifizierungssysteme bilden. Semantische Aspekte wie die Unterscheidung von Autosemantika und Synsemantika werden jedoch ebenfalls kurz angesprochen.
Welche Klassifizierungssysteme werden verglichen?
Der Hauptfokus liegt auf dem Vergleich der traditionellen „Zehn-Wortarten-Lehre“ mit der „Fünf-Wortarten-Lehre“ nach Hans Glinz. Zusätzlich werden moderne Ansätze, wie der von Pittner und Berman, eingebunden und diskutiert.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in mehrere Abschnitte gegliedert: Einleitung, ein Kapitel über die Wortarten mit Unterkapiteln zu verschiedenen Klassifizierungsmöglichkeiten und der Subklassifizierung, und einen Schluss. Es enthält außerdem eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Hauptziel ist es, einen Überblick über die verschiedenen Ansätze zur Wortklassifikation im Deutschen zu geben und die syntaktischen Kategorien, insbesondere die lexikalischen, zu erläutern. Es soll ein Verständnis für die Komplexität und die unterschiedlichen Perspektiven in der grammatikalischen Beschreibung der deutschen Sprache vermittelt werden.
Welche Rolle spielen Pittner/Berman in diesem Dokument?
Das Werk von Pittner und Berman wird als Beispiel für einen modernen Ansatz zur Wortklassifikation herangezogen und in den Vergleich der verschiedenen Klassifizierungssysteme einbezogen. Es dient als Referenzpunkt für die aktuelle grammatikalische Forschung.
Was sind die Schlüsselwörter des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Wortarten, Wortklassifikation, Semantik, Morphosyntax, „Zehn-Wortarten-Lehre“, „Fünf-Wortarten-Lehre“, Pittner/Berman, Substantiv, Verb, Adjektiv, Konjugation, Deklination, Funktionswörter, Distribution.
Für wen ist dieses Dokument bestimmt?
Dieses Dokument ist für akademische Zwecke gedacht und richtet sich an Personen, die sich mit der deutschen Grammatik und Wortklassifikation auseinandersetzen, z.B. Studenten der Linguistik oder Germanistik.
- Arbeit zitieren
- Sophia Schroll (Autor:in), 2008, Die Wortarten im Deutschen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/112215