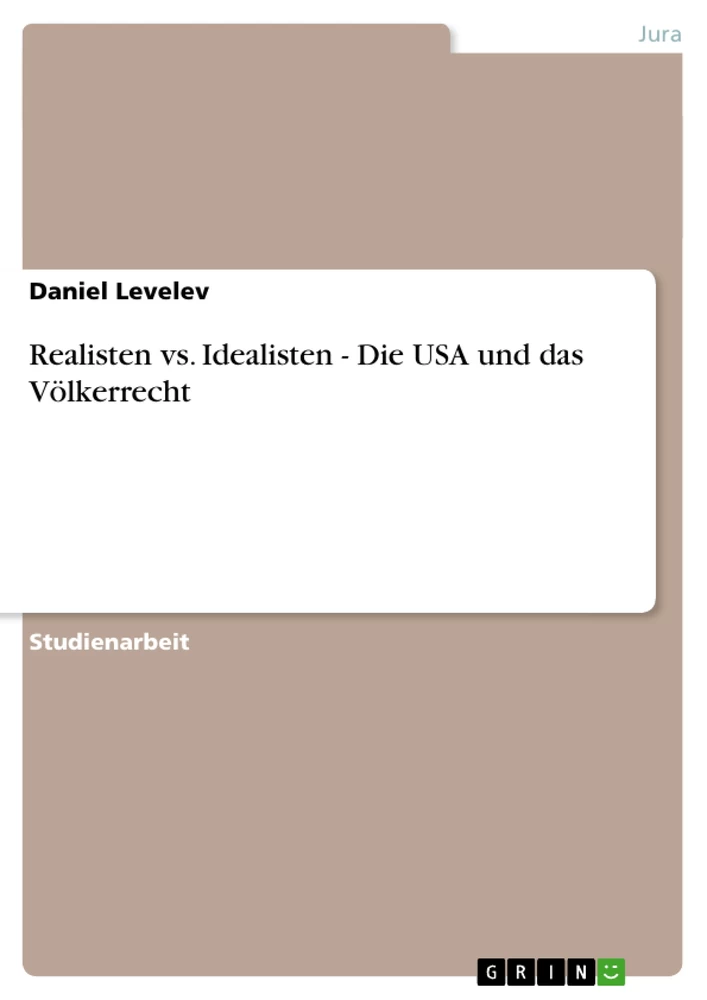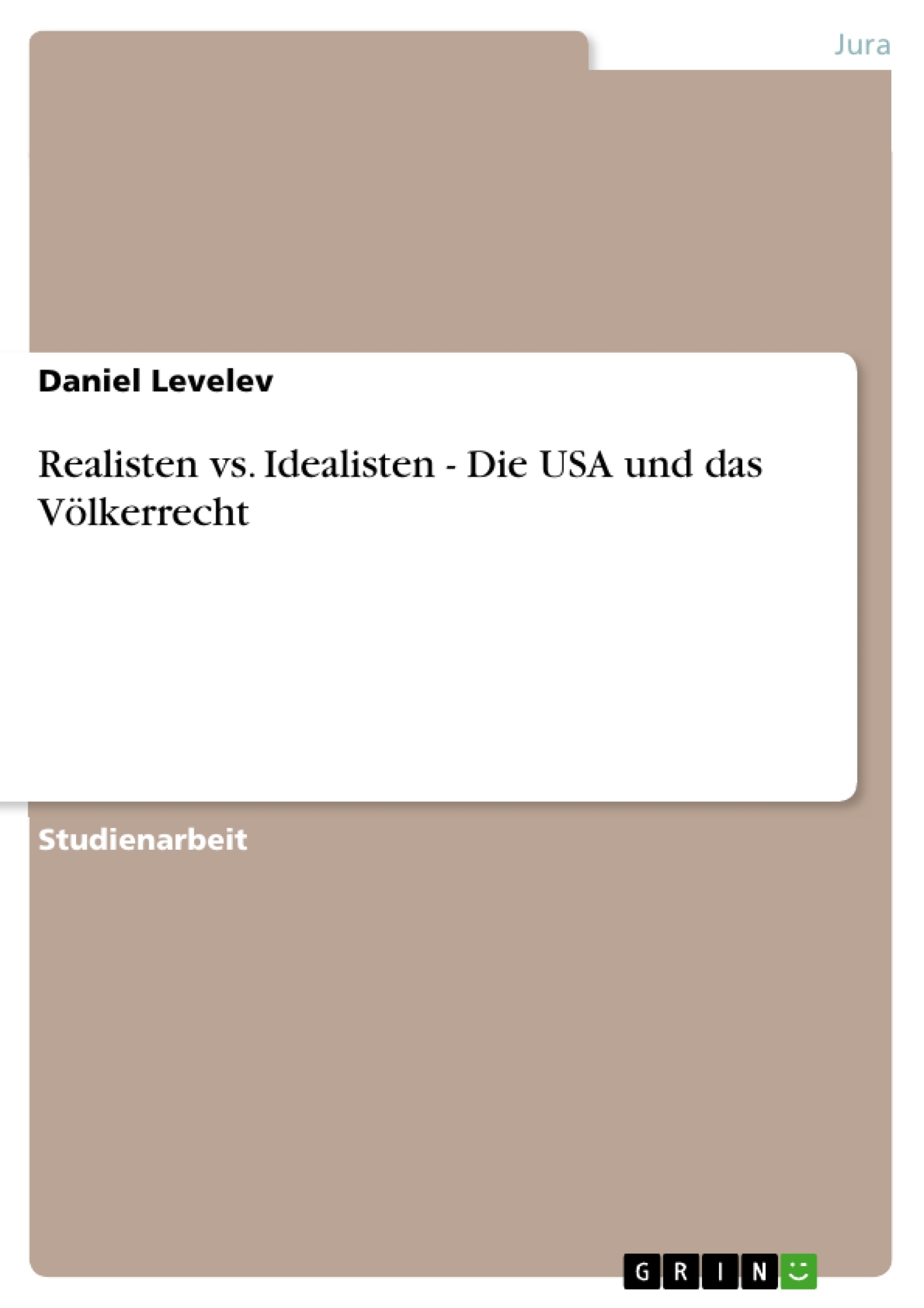Die Vereinigten Staaten von Amerika als Konkurrenzlose „Hypermacht“ üben über alle Gebiete der Internationalen Beziehungen, von Handel über Technologie und Militär bis hin zu kulturellen, moralischen und rechtlichen Werten,
einen richtungsweisenden Einfluss aus. In diesem Zusammenhang verdient die wechselseitige Beziehung zwischen der Politik und der Praxis der USA sowie dem Völkerrecht besondere Beachtung. Ziel dieser Arbeit ist es, das Völkerrechtsverständnis (Teil 1) und die daraus resultierende Praxis (Teil 2) der USA zu untersuchen. Dabei sollen Erkenntnisse über das Verhältnis der USA zum und die Rolle der USA im Völkerrecht gewonnen werden. Die Analyse soll über eine rein juristische Betrachtung hinaus, im Kontext der internationalen Beziehungen; im Wechselspiel von Macht und Recht erfolgen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei zwei politischen Theorien der Internationalen Beziehungen, dem Idealismus und dem Realismus zu.
GLIEDERUNG
EINLEITUNG
TEIL 1 – AMERIKANISCHE DOKTRIN UND VÖLKERRECHT
A. REALISMUS UND IDEALISMUS
I. Die realistische Konzeption − Mächtespiele im internationalen System
1. eine Welt ohne Ordnungsmacht
a. Ausgangspunkt: egoistisches Menschenbild
b. Übertragung: Konkurrenz der Staaten untereinander
2. Macht als Schlüssel zum internationalen System
II. idealistische (liberale/solidaristische) Konzeption − Synergie durch Kooperation in einer internationalen Gemeinschaft
1. Austausch statt Krieg
2. Die Internationale Gemeinschaft
III. Die Rolle des Völkerrechts bei Realisten und Idealisten
1. Realisten
a. Völkerrecht als Produkt von Staatsinteressen
b. Das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Staateninteressen
i. coincidence of interests − (zufällige) Übereinstimmung von Interessen
ii. coordination − Koordination
iii. cooperation − Kooperation
iv. coercion − Zwang
c. Konsequenzen
2. Idealisten
B. WELTBILD DER USA
I. New World Order
II. Ende der Geschichte
III. Kampf der Kulturen
IV. Globale Anarchie
V. Zentrum vs. Peripherie
VI. Bedeutung für die völkerrechtliche Praxis
C. SELBSTVERSTÄNDNIS DER USA
D. AMERIKANISCHE DOKTRINEN
I. Amerikanische Doktrinen der 1980er und 1990er Jahre
II. Bush jr.-Doktrin
TEIL 2 – DIE VÖLKERRECHTLICHE PRAXIS DER USA
A. WEITERENTWICKLUNG UND KODIFIKATION DES VÖLKERRECHTS
I. Abschluss von Verträgen unter dem Einfluss der USA
II. Nachverhandlung vertraglicher Regelungen nach Unterzeichnung
III. Nicht-Teilnahme an multilateralen Verträgen
B. VERLETZUNG VON VÖLKERRECHT
I. Verletzung von NAFTA und WTO Regelungen durch nationale Wirtschaftssanktionen
II. Verletzungen von Art. 36 (1) (b) WÜK im Zusammenhang mit der Hinrichtung fremder Staatsangehöriger
III. Anwendung von Gewalt
1. Völkerrechtliches Gewaltverbot des Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta
2. Anwendung von Gewalt mit UN-Mandat − Irak 1990, Afghanistan 2001, Irak 2003
a. Irak
b. Afghanistan
c. Irak 2003 ?
3. Selbstverteidigung
a. Nicaragua
a. Invasion in Panama
b. Luft- und Raketenangriffe in Irak 1993 sowie Afghanistan und Sudan 1998
c. Afghanistan
i. Aggression durch Beherbergen von Terroristen
ii. Selbstverteidigung gegen Terroristen
d. Antizipatorische Selbstverteidigung
i. Vorbeugende Selbstverteidigung gegen einen unmittelbar bevorstehenden Angriff
ii. Ein neues Recht preemptive actions ?
4. Intervention auf Einladung − Philippinen 1989, Saudi-Arabien 1990
5. Humanitäre Intervention − Kosovo / Jugoslawien
6. Zusammenfassung der Praxis der Anwendung von Gewalt
a. Rechtsfortbildung
i. Abwehr terroristischer Bedrohungen
ii. humanitäre Intervention
iii. Preemptive actions
b. Rechtsbeugung
c. Rechtsbruch
ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNISSE
EINLEITUNG
„Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir.” −Jean-Jacques Rousseau1
Die Vereinigten Staaten von Amerika als Konkurrenzlose „Hypermacht“2 üben über alle Gebiete der Internationalen Beziehungen, von Handel über Technologie und Militär bis hin zu kulturellen, moralischen und rechtlichen Werten, einen richtungsweisenden Einfluss3 aus. In diesem Zusammenhang verdient die wechselseitige Beziehung zwischen der Politik und der Praxis der USA sowie dem Völkerrecht besondere Beachtung.
Ziel dieser Arbeit ist es, das Völkerrechtsverständnis (Teil 1) und die daraus resultierende Praxis (Teil 2) der USA zu untersuchen. Dabei sollen Erkenntnisse über das Verhältnis der USA zum und die Rolle der USA im Völkerrecht gewonnen werden. Die Analyse soll über eine rein juristische Betrachtung hinaus, im Kontext der internationalen Beziehungen; im Wechselspiel von Macht und Recht erfolgen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei zwei politischen Theorien der Internationalen Beziehungen, dem Idealismus und dem Realismus zu.
TEIL 1 – A MERIKANISCHE D OKTRIN UND V ÖLKERRECHT
Im ersten Teil geht es um die theoretischen Grundlagen amerikanischer Außenpolitik und Völkerrechtspraxis. Zunächst werden Realismus und Idealismus (A.), zwei Eckpfeiler amerikanischer Außenpolitiktheorie, vorgestellt. Im Anschluss daran wird die Art und Weise, wie die USA die Welt (B.) und sich selbst (C.) sehen behandelt. Schließlich wird das Produkt dieser Theorien und die Grundlage amerikanischer Praxis, die Doktrinen der USA (D.) vorgestellt.
A. Realismus und Idealismus
Realismus und Idealismus stellen zwei bedeutende Theorien der internationalen Beziehungen dar. Auch die amerikanische Außenpolitik bewegt sich zwischen diesen Polen. Die Theorien unterscheiden sich, unter anderem, durch die Rollen, welche sie dem Völkerrecht zumessen. Realismus und Idealismus sollen in der vorliegenden Arbeit als Framework für das Verständnis der internationalen Praxis der USA dienen.
I. Die realistische Konzeption – Mächtespiele im internationalen System
Die Realisten sehen die internationalen Beziehungen als Machtbeziehungen zwischen den Staaten. Die Staatengemeinschaft ist für sie in einzelne souveräne Staaten gespalten, welche ihren Willen durch Ausübung von Macht Geltung verschaffen. Da jeder Staat sein eigenes Interesse verteidigt, und versucht seine Macht zu steigern sind Konflikte dieser Auffassung nach lediglich politischer Ausdruck der zwischenstaatlichen Rivalität. Die Staaten sind keiner höheren Autorität unterworfen und somit in ihren Handlungen völlig frei.
1. eine Welt ohne Ordnungsmacht
Die realistische Lehre sieht die Welt als eine Gesellschaft im Urzustand, welche nicht durch eine universelle Autorität reglementiert ist. Daraus folgt ein Konkurrenzkampf der Staaten untereinander.
[...]
1 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social ou pricncipes du droit politique, Amsterdam 1772, Chapitre III, Du droit du plus fort
2 der Begriff Hypermacht geht auf den damaligen französischen Außenminister Hubert Védrine zurück, für
Einzelheiten siehe: International Herald Tribune vom 05.02.1999 http://www.iht.com/articles/1999/02/05/france.t_0.php
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es behandelt die amerikanische Doktrin und das Völkerrecht, die völkerrechtliche Praxis der USA und die Beziehungen zwischen diesen Themen.
Was sind die Hauptteile dieses Dokuments?
Das Dokument ist in zwei Hauptteile gegliedert: Teil 1 befasst sich mit der amerikanischen Doktrin und dem Völkerrecht, während Teil 2 die völkerrechtliche Praxis der USA untersucht.
Welche Themen werden im ersten Teil behandelt?
Teil 1 behandelt Realismus und Idealismus, das Weltbild der USA, das Selbstverständnis der USA und amerikanische Doktrinen. Es untersucht auch die Rolle des Völkerrechts bei Realisten und Idealisten.
Welche Themen werden im zweiten Teil behandelt?
Teil 2 analysiert die Weiterentwicklung und Kodifikation des Völkerrechts, Vertragsabschlüsse unter US-Einfluss, Nachverhandlungen von Verträgen und die Nichtteilnahme an multilateralen Verträgen. Es behandelt auch die Verletzung des Völkerrechts durch die USA, einschließlich Verstöße gegen NAFTA- und WTO-Regelungen, Verletzungen der Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen (WÜK) und die Anwendung von Gewalt.
Welche Beispiele für die Anwendung von Gewalt werden im Dokument genannt?
Das Dokument geht auf die Anwendung von Gewalt im Irak (1990, 2003), in Afghanistan (2001), Nicaragua, Panama, im Sudan (1998), auf den Philippinen (1989), in Saudi-Arabien (1990) und im Kosovo ein. Es diskutiert auch Selbstverteidigung, humanitäre Interventionen und antizipatorische Selbstverteidigung.
Was sind die Haupterkenntnisse des Dokuments?
Das Dokument zielt darauf ab, das Völkerrechtsverständnis und die daraus resultierende Praxis der USA zu untersuchen und Erkenntnisse über das Verhältnis der USA zum Völkerrecht und die Rolle der USA im Völkerrecht zu gewinnen. Die Analyse soll über eine rein juristische Betrachtung hinaus im Kontext der internationalen Beziehungen; im Wechselspiel von Macht und Recht erfolgen, unter Berücksichtigung von Idealismus und Realismus.
Welche politischen Theorien der internationalen Beziehungen werden in dem Dokument eine wichtige Rolle spielen?
Zwei politische Theorien der internationalen Beziehungen, der Idealismus und der Realismus.
- Quote paper
- Daniel Levelev (Author), 2007, Realisten vs. Idealisten - Die USA und das Völkerrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/111448