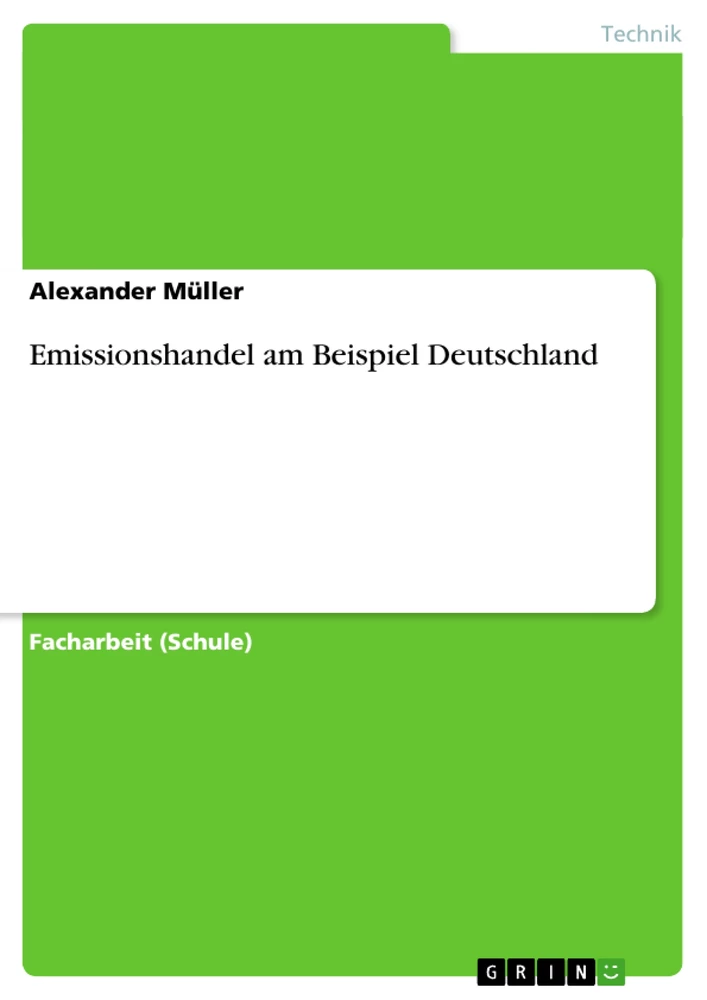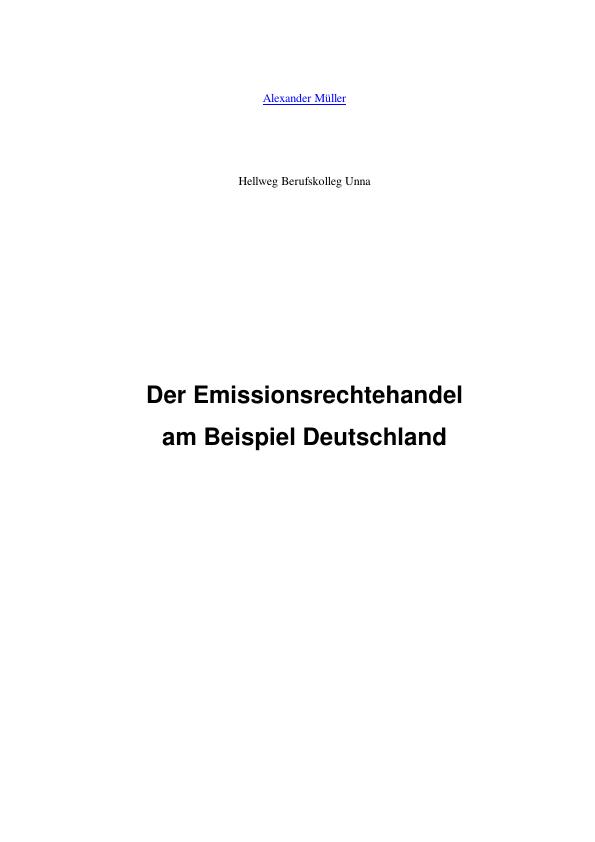Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Emissionshandel
2.1 Ermittlung der CO2-Emissionen
2.2 Zuteilung der Emissionsberechtigungen
2.3 Genehmigung zur CO2-Emittierung
2.4 Funktionsweise des Emissionshandels
3 Unterziele des Emissionshandels
3.1 Folgen für die Unternehmen
4 Emissionshandel aus Sicht der Unternehmen am Beispiel von 2 Studien
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
Einleitung
Es ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass der Treibhauseffekt für den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur verantwortlich ist. Dieser ist darauf zurück zu führen, dass große Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre ausgestoßen werden. Dies sind Kohlendioxid (CO2), Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), Methan (CH4), Distickstoffoxid (Lachgas; N2O), Ozon (O3) sowie perfluorierte Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), Schwefelhexafluorid (SF6), teilhalogenierte FCKW (H-FCKW) und wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW). (vgl. Geres 2000, S. 22) Da CO2 die Hälfte aller Treibhausgase weltweit ausmacht, werden weitere Betrachtungen dieser Arbeit darauf reduziert.
Die Vereinbarung über die Minderung der Emissionen von Treibhausgasen wurde in der Klimarahmenkonvention beschlossen. Sie wurde von 165 Staaten unterzeichnet und trat im März 1994 in Kraft. Die Zahl der Vertragsstaaten ist bis zum Jahre 1997 auf 167 angestiegen. In dem Jahr fand auch die Kyoto-Konferenz statt, wo das sogenannte Kyoto-Protokoll seinen Ursprung fand. Darin verpflichtete sich die Europäische Union, die „[...] Treibhausgase um 8 % bis zum Zielhorizont 2008 - 2012 auf Basis der Emissionen von 1990 [...]“ (Fichtner 2005, S. 1) zu verringern. Das bedeutet, dass bis zum Jahre 2008 die Emissionen im Vergleich zu 1990 92 % betragen würden. Um jedoch die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre stabil halten zu können, müssten die Emissionen in den Industrieländern um das Vierfache reduziert und in den noch nicht entwickelten Ländern mindestens halbiert werden. (vgl. Fichtner 2005, S. 1) Daher hat die Bundesregierung sich ein höheres Ziel gesetzt, und zwar ein „[...] Reduktionsziel von 40 % bis 2020 gegenüber den Emissionen des Jahres 1990 [...].“ (Fichtner 2005, S.1)
Das Kyoto-Protokoll enthielt ebenfalls Vorschläge für sog. Flexibilisierungsmechanismen, also Verfahren, mit denen eine Emissionsminderung erreicht werden kann; eins davon war der Emissionshandel. „Emissionshandel ist ein häufig anzutreffender verkürzter Ausdruck für den Handel mit Emissionsrechten. Er ist irreführend, weil nicht mit Emissionen gehandelt wird, sondern mit in Emissionszertifikaten verbrieften Emissionsrechten.“ (http://www.google.de) In der EU hat man sich im Juli 2003 auf diesen Mechanismus geeinigt. Zum 01. Januar 2005 ist der Emissionsrechtehandel in Deutschland gestartet.
Die EU-Richtlinie wird in den EU-Ländern durch nationale Gesetze geregelt. In Deutschland z. B. wird sie durch das Treibhaus-Emissionshandelsgesetz (TEHG) umgesetzt. Durch die jeweilige nationale Umsetzung der Richtlinie kommt es zwangsläufig zu gewissen Unterschieden im Emissionshandelssystem innerhalb der EU. Diese Arbeit beschränkt sich, um der zusätzlichen Komplexität aus dem Weg zu gehen, auf den Emissionshandel in Deutschland.
Das Anliegen dieser Arbeit ist es, den Emissionshandel verständlich zu machen. Als Einstieg dazu wird im ersten Abschnitt beschrieben, wie die CO2-Emissionen einer Anlage ermittelt werden. Zudem werden das Zuteilungsverfahren, der Vorgang der Genehmigung zur CO2-Emittierung und die Funktionsweise des Emissionshandels erläutert. Im zweiten Abschnitt geht es um die Unterziele des Emissionshandels. Darunter sind die Ziele zu verstehen, die für den funktionierenden Ablauf des Emissionshandels wichtig sind. Abschnitt drei behandelt die Folgen des Emissionshandels für die Unternehmen und im Abschnitt vier wird der Emissionshandel aus der Sicht der Unternehmen am Beispiel von zwei Studien dargestellt. Im Abschnitt fünf folgt das Fazit. Die Arbeit endet unter Punkt sechs mit dem Literaturverzeichnis.
1 Emissionshandel
Die Berechtigung für die gesamte Emission, welche einem Land zugeteilt wird, wird gespalten in sog. Emissionszertifikate (in Deutschland Emissionsberechtigungen genannt), ähnlich wie die Aufteilung vom Unternehmenskapital in Aktien. Diese Emissionsberechtigungen gestatten, eine bestimmte Menge an CO2 zu emittieren, also auszustoßen. (vgl. http://de.wikipedia.org) Das Besondere dabei ist, dass die Emissionsberechtigungen gehandelt werden können und die Inhaber diese an jedermann übertragen können. Somit haben die Anlagenbetreiber die Möglichkeit, die Emissionsberechtigungen zu kaufen und diese dann zur Deckung ihrer Emissionen einzusetzen. (vgl. Ebsen 2004, S. 12)
Bevor es jedoch zum Handel mit Emissionsberechtigungen kommt, haben die Anlagenbetreiber einen langen Weg vor sich. Zuerst müssen die CO2-Emissionen ermittelt werden, dann kommt der Zuteilungsprozess und schließlich wird die Genehmigung zur Emittierung erteilt. Diese drei Punkte sowie der Ablauf des Emissionshandels werden nun im Folgenden ausführlich beschrieben.
1.1 Ermittlung der CO2-Emissionen
Erst müssen die Anlagenbetreiber ermitteln, welche Menge an CO2 ihre Anlagen emittieren. Die Menge der CO2-Emissionen hängt im Wesentlichen davon ab, welche Brennstoffarten eingesetzt werden sowie vom jeweiligen Umfang. Dort bestehen gewisse Spielräume und zwar „[...] führt etwa eine unvollständige Verbrennung eines Brennstoffes zu niedrigeren CO2-Emissionen als eine vollständige Verbrennung.“ (Ebsen 2004, S. 20) Außerdem kann die tatsächliche CO2-Emission pro Brennstoffeinheit von der festgelegten CO2-Emission pro Brennstoffeinheit abweichen. Daher hängt die Ermittlung der Emissionen „[...] vom jeweiligen Prozess ab, der zu den CO2-Emissionen führt.“ (Ebsen 2004, S. 20) Dabei ist es im Interesse des Anlagenbetreibers, dass die ermittelte Menge an Emissionen möglichst gering ist, denn „je niedriger die ermittelten CO2-Emissionen sind, desto weniger Emissions-Berechtigungen muss der Anlagenbetreiber abgeben.“ (Ebsen 2004, S. 21)
1.2 Zuteilung der Emissionsberechtigungen
Die Emissionsberechtigungen werden nach bestimmten Kriterien an die Unternehmen, deren Anlagen erfasst sind, zugeteilt. Die EU-Handelsrichtlinie schreibt den EU-Mitglieds-staaten vor, „[...] welche Arten von Anlagen zu erfassen sind und welche nicht.“ (Ebsen 2004, S. 13) Erfasst werden Anlagen, die CO2 emittieren. Dazu gehören Feuerungsanlagen mit einer Leistung von über 20 MW, Mineralölraffinerien, Kokereien, Anlagen zur Herstellung von Glas und Glasfasern – mit einer Schmelzmenge von über 20 Tonnen pro Tag – , Anlagen zur Herstellung von Papier und Pappe – mit einer Produktionsmenge von über 20 Tonnen pro Tag – und weitere Anlagen. (vgl. Ebsen 2004, S. 13 f.) Die Zuteilung der Emissionsberechtigungen erfolgt für die Jahre 2005-2007 kostenlos. Es hängt davon ab, „[...] ob es sich um Altanlagen (Inbetriebnahme vor 2003), Neuanlagen (Inbetriebnahme ab 2005) oder Twilight-Anlagen (Inbetriebnahme 2003 u. 2004) handelt.“ (Ebsen 2004, S. 10 f.) Dies geschieht nach vier unterschiedlichen Regeln.
Die Zuteilung bei Altanlagen erfolgt nach dem sogenannten Grandfathering-Prinzip. Dabei bekommen die Anlagen, „[...] die vor 1994 in Betrieb genommen worden sind, [...] grundsätzlich für jedes Jahr[innerhalb der ersten Zielperiode 2005-2007] Emissions-Berechtigungen in einer Menge, die 97,09 % der durchschnittlichen Emissionen der Anlage in den Jahren 2000-2002 entspricht. Altanlagen, die ab 1994 in Betrieb genommen wurden, erhalten grundsätzlich Emissions-Berechtigungen in voller Höhe der durchschnittlichen Emissionen der Anlage in den Jahren 2000-2002.“ (Ebsen 2004, S. 11; Zus. v. A.M.)
Für Neuanlagen wird bei der Zuteilung von Emissionsberechtigungen entweder die Ersatzanlagen- oder Benchmark-Regel angewandt. Bei der Ersatzanlagen-Regel wird die Menge an Berechtigungen zugeteilt, die eine stillgelegte Altanlage, die durch eine Neuanlage ersetzt wurde, bekommen hätte. (vgl. Ebsen 2004, S. 11) Die Benchmark-Regel funktioniert wie folgt: Der Benchmark ist ein Wert, der festlegt, „[...] wie viele Emissions-Berechtigun-gen eine Anlage je produzierter Einheit erhält.“ (Ebsen 2004, S. 11) Die Menge der produzierten Einheiten wird mit dem Benchmark multipliziert. Das Ergebnis daraus ist die Produktionsmenge der CO2-Emissionen, die bei der Zuteilung entscheidend ist. Die Berechtigungen werden „[...] zunächst auf der Grundlage prognostizierter Produktionsmengen [...]“ (Ebsen 2004, S. 11) zugeteilt – da die Menge der produzierten Einheiten im Voraus nicht genau festgelegt werden kann – und nachträglich den tatsächlichen Mengen angepasst, falls diese niedriger ausfallen sollten.
Die Zuteilung für Twilight-Anlagen erfolgt „[...] nach einer modifizierten Benchmark-Regel.“ (Ebsen 2004, S. 11) D.h., die Menge der produzierten Einheiten wird nicht mit dem Benchmark, sondern mit der prognostizierter Emissionsmenge je produzierter Einheit der Anlage multipliziert. Der so ermittelte Wert, also die Produktionsmenge der CO2-Emissionen, ist, wie bei der Benchmark-Regel nicht genau. Das liegt daran, dass auch hier die Menge der produzierten Einheiten im Voraus nicht genau festgelegt werden kann. Jedoch wird sie trotzdem vorerst als Grundlage für die Zuteilung genommen. Der Wert wird später korrigiert, falls die tatsächliche Menge niedriger sein sollte. (vgl. Ebsen 2004, S. 11) Im Interesse des Anlagenbetreibers sollte die für die Zuteilung ermittelte Menge an CO2-Emissionen möglichst hoch sein, um möglichst viele Emissionsberechtigungen zu bekommen.
1.3 Genehmigung zur CO2-Emittierung
Die Anlagenbetreiber müssen für ihre Anlagen, welche CO2 emittieren, eine Genehmigung einholen. Je nach Art der Anlagen wird entweder die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz erteilt oder sie muss bei der Deutschen Emissionshandelsstelle beantragt werden. Auch Änderungen der Anlagen – wie Lage, Betriebsweise und -umfang oder auch Rechtsform usw. – sowie ihre Auswirkungen auf die CO2-Emissionen müssen entweder der zuständigen Immissionsschutzbehörde oder der Deutschen Emissionshandelsstelle mitgeteilt werden. Das hängt davon ab, von wem die Genehmigung stammt. (vgl. Ebsen 2004, S. 19 f.)
1.4 Funktionsweise des Emissionshandels
Der Emissionshandel funktioniert nach dem folgenden Prinzip: Den Betreibern von Anlagen wird die für ihre Anlage je ermittelte Menge (wie im Abschnitt 1.1 beschrieben) an Emissionsberechtigungen jeweils am 28. Februar eines Jahres kostenlos zugeteilt. Für jede dann emittierte Tonne der CO2-Emissionen müssen die Betreiber jeweils eine Emissionsberechtigung abgeben. Diese werden bis zum 30. April jeden Jahres abgegeben und zwar für das vergangene Jahr, das heißt, dass „für die Berechtigungen der Anlagen im Jahr 2005 [...] spätestens am 30. April 2006 Emissions-Berechtigungen abgeben“ (Ebsen 2004, S. 23) werden müssen. Falls dies nicht rechtzeitig geschieht, müssen die Anlagenbetreiber eine Strafe, die sog. Zahlungspflicht, in Höhe von 40 € pro Tonne CO2 – für die keine Berechtigung abgegeben wurde – leisten. Für eben diese Menge CO2 müssen dann aber im folgenden Jahr die Berechtigungen trotzdem abgegeben werden, obwohl die Zahlungspflicht geleistet wurde. (vgl. Ebsen 2004, S. 9 f.)
Hierzu ein Beispiel: Eine Anlage emittiert in den Jahren 2005 und 2006 50.000 Tonnen CO2. Der Anlagenbetreiber hat jedoch nur 25.000 Emissionsberechtigungen für die Emissionen des Jahres 2005 abgegeben. Daher muss er die Zahlungspflicht in Höhe von 25.000 x 40 € = 1.000.000 € zahlen. Im Jahr 2007 muss der Anlagenbetreiber 50.000 Emissionsberechtigungen für das Jahr 2006 und weitere 25.000 Emissionsberechtigungen für das Jahr 2005 abgeben; insgesamt also 75.000 Emissionsberechtigungen. (vgl. Ebsen 2004, S. 10) Wird nun die Menge der CO2-Emissionen, für die die Berechtigungen zugeteilt wurden, überschritten, müssen weitere Berechtigungen hinzugekauft werden. Wenn die Menge unterschritten wird, können die übrigen Berechtigungen verkauft werden. Somit wird „[...] ein vollkommener Markt für den Handel mit Emissionsrechten [geschaffen], in dem kein Unternehmen die überwiegende Marktmacht innehat und wo immer genügend Anbieter und Nachfrage existieren.“ (Cansier, S. 1, Zus. v. A.M.)
2 Unterziele des Emissionshandels
Die Unterziele werden künftig für den Erfolg oder Misserfolg der Emissionsrechtehandels entscheidend sein. Als Unterziele können Verlässlichkeit, Transparenz sowie ein geringer Regelungsbedarf genannt werden .
Zu Verlässlichkeit kann man sagen, dass die CO2-Emissionen nur dann eingespart werden können, wenn allen Teilnehmern die Regeln bekannt sind. Reduktionsziele sollten im weiteren Verlauf so gesetzt werden, dass sie erfüllbar bleiben. Auch auf Sanktionen, die bei Regelverstoß fällig werden, muss Verlass sein. Die Zielperioden sollten aufeinander folgen, denn eine Pause zwischen zwei Perioden würde zu Problemen bei der Anrechnung der Emissionsberechtigungen führen. Auf keinem Fall darf Unsicherheit darüber entstehen, ob weitere Reduktionen überhaupt notwendig werden. (vgl. Dutschke/Michaelowa 1998, S. 46 f.)
Die Anlagenbetreiber legen Wert auf die Planungssicherheit, die durch klare und transparente Regeln hergestellt werden kann. Jedoch war das Zustandekommen der Emissionsziele für die erste Zielperiode 2005-2007 nicht annähernd transparent, da lange Zeit nicht klar war, welches Land wie viele Emissionsberechtigungen zugeteilt bekommt. Das hatte auch Auswirkungen auf Deutschland, da diese Unsicherheit übertragen wurde. In Zukunft muss also ein Kriterienkatalog entwickelt werden, nach dem der Anteil einzelner Länder am weltweiten Emissionsziel ermittelt werden kann. (vgl. Dutschke/Michaelowa 1998, S. 46)
Die Regelungen für den Emissionshandel dürfen auf internationaler Ebene ausschließlich die Grundlagen des Handels festlegen, während die nationale Umsetzung sich an der jeweiligen Politik orientieren kann. Wie schon in der Einleitung erwähnt, wird der Emissionshandel in Deutschland durch das Treibhaus-Emissionshandelsgesetz (TEHG) geregelt. Die Grundlagen sollten möglichst keine Ausnahmeregelungen zulassen. Auch muss vermieden werden, dass ein Land aus dem Kyoto-Protokoll aussteigen kann. (vgl. Dutschke/ Michaelowa 1998 S. 45 f.)
2.1 Folgen für die Unternehmen
Obwohl die Emissionsberechtigungen kostenlos zugeteilt werden, verursachen die CO2-Emissionen der betroffenen Anlagen Kosten für die Betreiber. Das liegt daran, dass die Emissionsberechtigungen einen Vermögenswert haben. Dieser orientiert sich an den Regeln von Angebot und Nachfrage ständig neu am Markt. Je mehr also eine Anlage CO2 emittiert, desto mehr Emissionsberechtigungen müssen abgegeben werden von denen der Betreiber welche hätte verkaufen können. Somit entstehen die Kosten der CO2-Emissionen in Höhe des nicht erzielten Verkaufserlöses und nicht in Höhe der Anschaffungskosten – welche bei Null liegen – für die Emissionsberechtigungen. (vgl. Ebsen 2004, S. 2 f.)
Die Betreiber werden durch das Emissionshandelssystem aber auch begünstigt. Der Grund dafür ist: Wenn die Anlagenbetreiber mehr Emissionsberechtigungen bekommen als sie benötigen, können sie die nicht benötigten Emissionsberechtigungen verkaufen und somit Erlöse erzielen. Weitere Konsequenzen ergeben sich, wenn die Emissionen durch Emissionsberechtigungen nicht gedeckt sind, dem Betreiber also zu wenig Berechtigungen vorliegen. Wie schon im Abschnitt 1.4 erwähnt, müssen in diesem Fall weitere Berechtigungen hinzugekauft werden, was zu steigenden Kosten führt. (vgl. Ebsen 2004, S. 2 f.)
Die betroffenen Anlagenbetreiber sollten also untersuchen, welche Chancen und Risiken für sie durch den Emissionshandel resultieren und welches Ausmaß diese auf die Wirtschaftlichkeit haben können. (vgl. Ebsen 2004, S. 2 f.)
3 Emissionshandel aus Sicht der Unternehmen am Beispiel von 2 Studien
Die Beratungsgesellschaft LogicalCMG hat am 23. Mai 2005, fünf Monate nach der Einführung des Emissionshandels, eine Studie veröffentlicht, in der 100 deutsche Unternehmen aus der Energiewirtschaft und der Industrie befragt wurden, wie sie auf den Emissionshandel vorbereitet sind, ob sie negative Auswirkungen durch den Emissionshandel erwarten und ob sie die notwendigen Planungen in die Wege geleitet haben. (vgl. Logical CMG 2005)
68 % der befragten Unternehmen sagten, dass die Vorbereitungen für den Emissionshandel bereits abgeschlossen sind. 73 % der befragten Unternehmen gaben an, dass sie eine positive Wirkung erwarten. Allerdings waren sich gut zwei Drittel aller Unternehmen nicht sicher, wie sich dieses auf ihr Unternehmen auswirkt. Zur Einschätzung der Unternehmen, ob sie als Käufer oder Verkäufer am Handel teilnehmen wollen, gaben 46 % an, dass sie generell teilnehmen wollen; davon 13 % als reiner Verkäufer und 15 % als reiner Käufer. Die restlichen 18 % wollen sowohl als Käufer wie auch als Verkäufer auftreten. 23 % der Unternehmen wollen am Handel nicht teilnehmen und 27 % sind sich über ihre Rolle am Handelsmarkt noch unschlüssig. (vgl. LogicalCMG 2005)
In einer weiteren Studie, die von Fr. Sonja Baumann (Alle Angaben zur 2. Studie: vgl. Baumann; Nummerierung eingefügt von A.M.) durchgeführt wurde, haben sich 86 Unternehmen zu den möglichen Auswirkungen des Emissionshandels geäußert. Im Folgenden werden die wesentlichen Aussagen dieser Studie ausgeführt:
1.) Zu der Frage, ob die zugeteilten Emissionsberechtigungen für die Phase 2005-2007 ausreichen würden, äußerten sich mehr als die Hälfte der Unternehmen überzeugt, dass dies ausreichen würde, dass sie also keine Unterdeckung erwarten.
2.) Bezüglich der Investition in die Umrüstungstechnologien meinten 69 Unternehmen, dass sie keine Änderungen in ihren Anlagen aufgrund des Emissionshandels vornehmen werden.
3.) Zu der Frage, welche zukünftigen Auswirkungen in den Anlagen erwartet werden, gaben 46 Unternehmen an, dass sie keine Auswirkungen erwarten, 8 Unternehmen sahen eine Umstellung des Brennstoffs als notwendig an und nur 4 Unternehmen erwarten eine Verringerung oder Abschaffung der Energieerzeugung.
4.) Im Bezug auf die Kosten, die durch den Emissionshandel entstehen werden, glaubten 71 Unternehmen, dass sie in der ersten Phase mit 100.000 € belastet werden, dagegen rechneten nur zwei Unternehmen mit zusätzlichen Kosten von bis zu 1.000.000 €. Die restlichen 17 Unternehmen erwarteten, dass sie nur mit maximal 10.000 € belastet werden.
5.) Die Angaben der Unternehmen hinsichtlich des Nutzens durch den Emissionshandel sind eindeutig ausgefallen: Während 52 der Unternehmen keinen Nutzen sahen, prognostizierten jedoch 22 Unternehmen einen schwachen Nutzen für ihr Unternehmen. Von einem starken Nutzen gingen nur 2 Unternehmen aus.
6.) Auf die Frage, ob und welche Maßnahmen die Unternehmen für den Emissionshandel ergriffen haben, gaben nahezu alle Unternehmen an, dass sie bereits ein System zur Überwachung der Emissionen aufgebaut haben. 51 der Unternehmen haben bereits Emissionsprognosen durchgeführt und Minderungsmaßnahmen ergriffen.
7.) Zu der Frage, ob die Unternehmen die Preisentwicklung für Emissionsberechtigungen mitverfolgen, gaben 62 der Unternehmen an, dass sie dies bereits tun. Da der Handel mit Emissionsberechtigungen noch ziemlich neu ist, haben die meisten Unternehmen noch keine Handelserfahrungen vorzuweisen, 4 Unternehmen haben bereits Erfahrungen mit Handel sammeln können. 45 Unternehmen empfanden die Kosten und Gebühren durch den Emissionshandel zu hoch, was sich als großer Nachteil darstellt. Den zusätzlichen Arbeits- aufwand benannten 22 Unternehmen als nachteilig.
8.) Neben den eben unter Punkt sieben genannten Nachteilen gaben 18 Unternehmen an, dass sie für sich einen Vorteil durch den Emissionshandel sehen, während knapp 50 der befragten Unternehmen keinen Vorteil für sich erkennen können; was also auf eine neutrale Meinung ihrerseits in Bezug auf diesen Punkt schließen lässt, sie sind demnach nicht negativ gegenüber dem Emissionshandel eingestellt.
In Bezug auf diese beiden Studien lässt sich schlussfolgernd sagen, dass der Emissionshandel finanziell keine großen Wirkungen auf die Unternehmen hat. Im Vorfeld des Emissionshandels wurden Befürchtungen laut, dieser könne zu Produktionsverlagerungen ins Ausland führen; die ersten Erfahrungen zeigten jedoch, dass die Mehrzahl der Unternehmen zusätzliche Kosten in Höhe von 100.000 € erwartet, was die Produktionsverlagerung nicht rechtfertigt. Zudem erwarten knapp drei Viertel der Unternehmen positive Auswirkungen durch den Emissionshandel und fast die Hälfte möchte aktiv am Handel teilnehmen. Auch ist die Mehrheit der Unternehmen auf den Emissionshandel gut vorbereitet. Dies vermittelt insgesamt ein positives Bild des Emissionshandels aus Sicht der Unternehmen. Jedoch brauchen die Unternehmen bestimmt noch Zeit, um mehr Erfahrungen zu sammeln und bessere Prognosen abgeben zu können.
4 Fazit
Mit Blick auf die behandelten Aspekte in dieser Arbeit sollen hier nun noch mal wichtige Punkte hervorgehoben und schließlich der Versuch einer Prognose gegeben werden.
In Bezug auf den Abschnitt 1.1 und darüber hinaus gedacht, ist es vorstellbar, dass die Anlagenbetreiber versuchen, zuerst durch einfache Maßnahmen Kosten zu sparen. Das kann damit beginnen, dass andere Brennstoffe eingesetzt werden, wodurch weniger CO2-Emissionen emittiert werden. Auch wäre es denkbar, dass alle Prozesse, die zu CO2-Emissionen führen, von den Unternehmen analysiert und gegebenenfalls umgestellt werden, um Emissionen einzusparen. Sowohl für den Vorgang der Ermittlung der Emissionen als auch für die Koordination des Emmisohnshandels im eigenen Unternehmen müssen die Unternehmen Mitarbeiter abstellen oder neue Mitarbeiter einstellen bzw. Beratungsfirmen beauftragen. Das stellt einen zusätzlichen Kostenfaktor dar. Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass sich diese Tatsache jedoch nicht negativ auf die Unternehmen auswirkt. Im Bereich der Beantragung von Genehmigungen für CO2-Emissionen ist es für die Unternehmen wichtig, sich zu informieren, welche Stelle für sie zuständig ist bzw. welches Gesetz auf sie zutrifft. Hier besteht ein, wenn auch geringer, zusätzlicher Zeitaufwand, den einige Unternehmen als eher nachteilig empfinden, wie aus der Studie von Baumann ersichtlich wird.
Die Zuteilungsregeln, in Abschnitt 1.2 beschrieben, klingen recht kompliziert. Sie verlangen von den Zuständigen einen guten Überblick. Doch erscheinen sie durchaus sinnvoll, da ein fairer Umgang mit den unterschiedlichen Anlagetypen sonst nicht gewährleistet wäre.
Zum Abschnitt 1.4 ist nicht viel anzumerken. Er klingt ziemlich einleuchtend, gut nachvollziehbar und erscheint auch in der Umsetzung nicht sehr schwierig zu sein. Auf die besondere Stellung der Unterziele wurde ja bereits in der Einleitung hingewiesen und sie sollte in Abschnitt 2 auch deutlich geworden sein. Ebenso sind die Folgen des Emissionshandels für die Unternehmen, in Abschnitt 3 dargestellt, in sich schlüssig und selbsterklärend, sowohl für die Unternehmen als auch für Außenstehende.
Die beiden Studien stellen in dieser Arbeit eine zweite Sichtweise, nämlich die der Unternehmen, dar. Ihnen gegenüber wurde ja im Übrigen auf die Bereiche Politik und Gesetz eingegangen. Aufgrund der Darstellungen in dieser Arbeit sowie der Ergebnisse der Studien, scheinen jedoch beide Seiten den Optimismus in Bezug auf den Emissionshandel zu teilen.
Allgemein lässt sich zu den Aussichten des Emissionshandels sagen: Dadurch, dass ein hoher Anteil des Strombedarfs in Deutschland durch fossile Brennstoffe abgedeckt wird, kann der Emissionshandel nachhaltig den Endverbraucher treffen; jener könnte nämlich die Preise für die Energieversorgung nachteilig beeinflussen.
Da für die erste Zielperiode 2005-2007 die Emissionsberechtigungen noch ziemlich großzügig zugeteilt wurden, ist jedoch eine deutliche Verknappung der Emissionsberechtigungen für die nächste Periode 2008-2012 zu erwarten, damit das angestrebte Ziel der Emissionsminderung erreicht werden kann.
Während oben genannte Punkte noch recht gut prognostizierbar bzw. abschätzbar sind, können die Auswirkungen des Emissionshandels für Wirtschaft und Bürger erst in den kommenden Jahren beobachtet werden. Darüber zu spekulieren wäre an dieser Stelle noch zu früh.
Emissionshandel ist zusammenfassend nicht nur ein wirkungsvolles Instrument zur Reduzierung der Treibhausemissionen, er ist auch ein Muss. Man kann damit große Umweltkatastrophen vermeiden und den Gesundheitszustand aller Menschen im gewissen Maße sichern. Der Emissionshandel präsentiert sich also als ein stabiles und umweltpolitisches Instrument, das zur Erreichung der vorgegebenen Ziele führen wird.
5Literaturverzeichnis
Bücher:
Dutschke, Michael/Michaelowa, Axel: Der Handel mit Emissionsrechten für Treibhaus- gase. Empfehlungen aus ökonomischer Sicht auf der Grundlage des Kyoto-Protokolls. Hamburg: HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung-Hamburg 1998.
Ebsen, Peter: Emissionshandel in Deutschland. Ein Leitfaden für die Praxis. Köln/Berlin/ München: Carl Heymanns Verlag 2004.
Fichtner, Wolf: Emissionsrechte, Energie und Produktion. Verknappung der Umweltnut-zung und produktionswirtschaftliche Planung. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2005.
Geres, Roland: Nationale Klimapolitik nach dem Kyoto-Protokoll. Frankfurt a.M./Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Wien: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften 2000 (= Europäische Hochschulschriften: Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 2579).
Internetadressen mit Autorennamen:
Baumann, Sonja: Ergebnisse einer Befragung zu den Auswirkungen des Emissionshandels auf die am Handelssystem teilnehmende Unternehmen. Unter: http://w210.ub.uni-tuebingen.de/dbt/volltexte/2005/1565/pdf/Ergebnisse_EH-Befragung.pdf
Cansier, Dieter: Alles nur „heiße Luft“? Der Handel mit Emissionsrechten. Unter: http://www.uni-tuebingen.de/wirtschaft/allesheisseluft.pdf
LogicalCMG (Eine Studie): Deutsche Industrie steht dem Emissionshandel gelassen gegenüber. Eschborn 2005. Unter: http://www.presseportal.de/story.htx? nr=682057&ressort=5
Internetadressen ohne Autorennamen:
http://www.google.de/search?hl=de&q=define%3Aemissionshandel&btnG=Google-Suche&meta=
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Treibhauseffekt und welche Gase sind dafür verantwortlich?
Der Treibhauseffekt ist für den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur verantwortlich. Die Haupttreibhausgase sind Kohlendioxid (CO2), Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), Methan (CH4), Distickstoffoxid (Lachgas; N2O), Ozon (O3) sowie perfluorierte Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), Schwefelhexafluorid (SF6), teilhalogenierte FCKW (H-FCKW) und wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW).
Was wurde in der Klimarahmenkonvention und dem Kyoto-Protokoll vereinbart?
Die Klimarahmenkonvention, unterzeichnet von 165 Staaten, enthielt eine Vereinbarung zur Minderung der Emissionen von Treibhausgasen. Das Kyoto-Protokoll verpflichtete die Europäische Union, die Treibhausgase um 8 % bis zum Zielhorizont 2008 - 2012 auf Basis der Emissionen von 1990 zu verringern.
Was ist Emissionshandel?
Emissionshandel ist der Handel mit Emissionsrechten. Es handelt sich um einen Mechanismus, durch den Anlagenbetreiber Berechtigungen zum Ausstoß einer bestimmten Menge CO2 erhalten, die sie handeln können.
Wie funktioniert der Emissionshandel in Deutschland?
In Deutschland wird der Emissionshandel durch das Treibhaus-Emissionshandelsgesetz (TEHG) geregelt. Anlagenbetreiber müssen ihre CO2-Emissionen ermitteln, erhalten Emissionsberechtigungen, benötigen eine Genehmigung zur Emittierung und müssen für jede emittierte Tonne CO2 eine Emissionsberechtigung abgeben. Überschüssige Berechtigungen können verkauft werden, während fehlende hinzugekauft werden müssen.
Wie werden die CO2-Emissionen ermittelt?
Die Ermittlung der CO2-Emissionen hängt von der Art des eingesetzten Brennstoffs und dem jeweiligen Umfang ab. Anlagenbetreiber haben ein Interesse daran, die Menge der Emissionen möglichst gering zu halten, da dies die Anzahl der benötigten Emissionsberechtigungen reduziert.
Wie erfolgt die Zuteilung der Emissionsberechtigungen?
Die Zuteilung der Emissionsberechtigungen erfolgt nach bestimmten Kriterien an die Unternehmen, deren Anlagen CO2 emittieren. Die EU-Handelsrichtlinie schreibt den EU-Mitglieds-staaten vor, welche Arten von Anlagen zu erfassen sind und welche nicht. Die Zuteilung erfolgt unter Berücksichtigung ob es sich um Altanlagen, Neuanlagen oder Twilight-Anlagen handelt. Unterschiedliche Regeln wie das Grandfathering-Prinzip, die Ersatzanlagen- oder Benchmark-Regel werden angewandt.
Was passiert, wenn ein Anlagenbetreiber mehr CO2 emittiert als er Berechtigungen hat?
Wenn die Menge der CO2-Emissionen, für die die Berechtigungen zugeteilt wurden, überschritten wird, müssen weitere Berechtigungen hinzugekauft werden. Andernfalls droht eine Strafe, die sogenannte Zahlungspflicht, in Höhe von 40 € pro Tonne CO2, für die keine Berechtigung abgegeben wurde.
Welche Unterziele sind für den Erfolg des Emissionshandels wichtig?
Verlässlichkeit, Transparenz und ein geringer Regelungsbedarf sind wichtige Unterziele. Regeln müssen bekannt und verlässlich sein, Reduktionsziele sollten erfüllbar sein, und die Zielperioden sollten aufeinander folgen. Klare und transparente Regeln fördern die Planungssicherheit für die Anlagenbetreiber.
Welche Folgen hat der Emissionshandel für die Unternehmen?
Der Emissionshandel kann sowohl Kosten als auch Erlöse für die Unternehmen verursachen. Kosten entstehen durch den Wert der Emissionsberechtigungen, die für die emittierten CO2-Mengen abgegeben werden müssen. Erlöse können erzielt werden, wenn Unternehmen mehr Berechtigungen haben als sie benötigen und diese verkaufen können. Die betroffenen Anlagenbetreiber sollten also untersuchen, welche Chancen und Risiken für sie durch den Emissionshandel resultieren und welches Ausmaß diese auf die Wirtschaftlichkeit haben können.
Was zeigen die Studien zum Emissionshandel aus Sicht der Unternehmen?
Die Studien zeigen, dass der Emissionshandel finanziell keine großen Wirkungen auf die Unternehmen hat. Die Mehrheit der Unternehmen erwartet zusätzliche Kosten in Höhe von 100.000 €, was die Produktionsverlagerung nicht rechtfertigt. Knapp drei Viertel der Unternehmen erwarten positive Auswirkungen, und fast die Hälfte möchte aktiv am Handel teilnehmen. Insgesamt vermittelt dies ein positives Bild des Emissionshandels aus Sicht der Unternehmen, wenngleich noch Zeit für weitere Erfahrungen und bessere Prognosen benötigt wird.
Welche allgemeinen Aussichten hat der Emissionshandel?
Der Emissionshandel kann nachhaltig den Endverbraucher treffen, da ein hoher Anteil des Strombedarfs in Deutschland durch fossile Brennstoffe abgedeckt wird, der Emissionshandel könnte nämlich die Preise für die Energieversorgung nachteilig beeinflussen. Für die nächste Periode 2008-2012 ist eine deutliche Verknappung der Emissionsberechtigungen zu erwarten, damit das angestrebte Ziel der Emissionsminderung erreicht werden kann. Die Auswirkungen des Emissionshandels für Wirtschaft und Bürger können erst in den kommenden Jahren beobachtet werden.
- Quote paper
- Alexander Müller (Author), 2006, Emissionshandel am Beispiel Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/111401