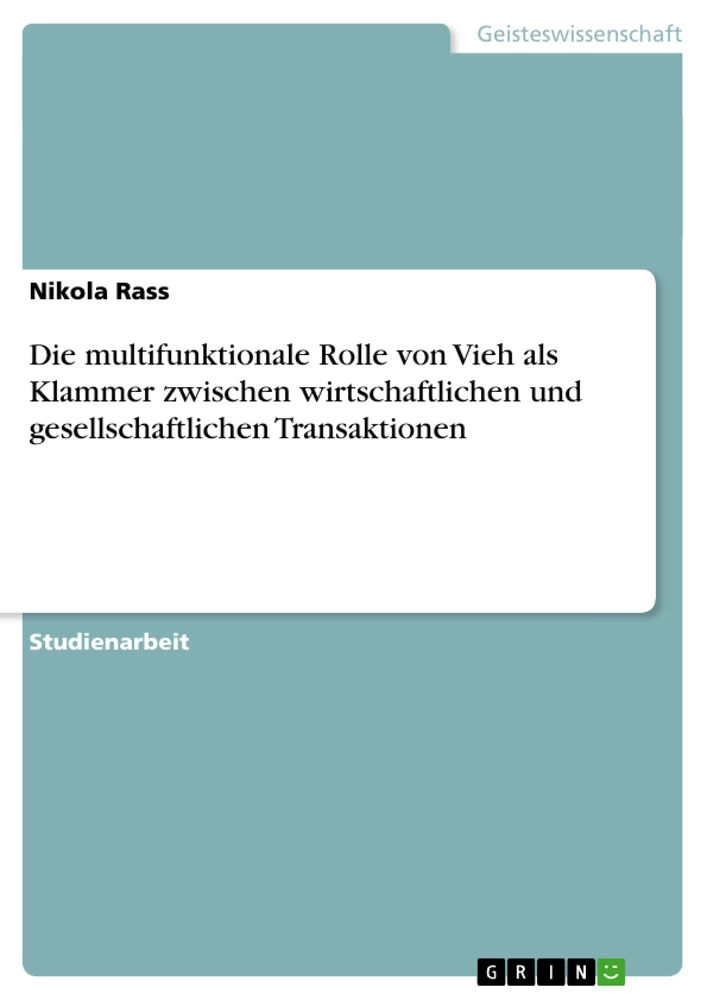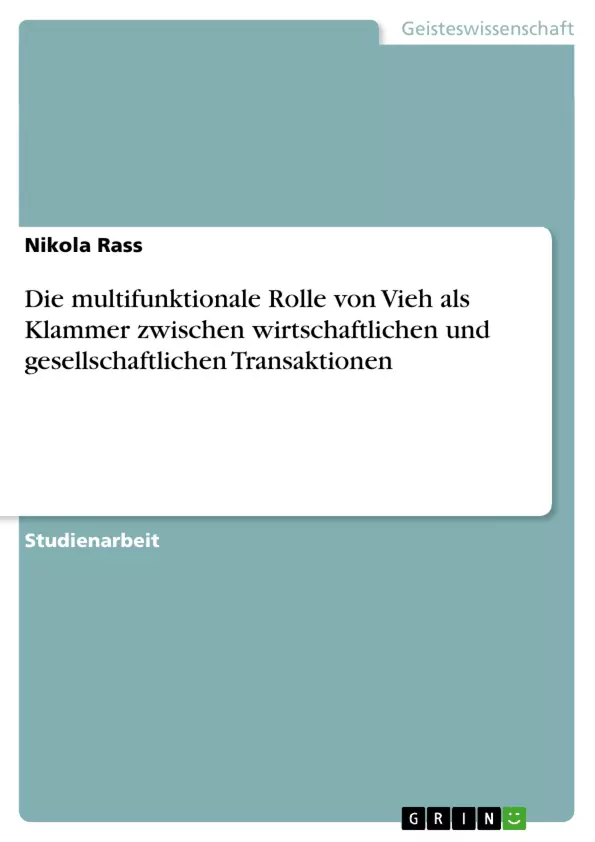Gliederung
1. Einleitung
2.Wie die traditionelle Gesellschaft aus formalistischem oder substantivistischem Theorieverständniss betrachtet wird.
3. Die Funktion von Geld in traditionellen und modernen Gesellschaften
4. Die multifunktionale Rolle von Vieh als Klammer zwischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transaktionen
5. Der Wandel traditioneller Gesellschaften im Kommerzialisierungsprozess
6. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Das entwicklungspolitische Credo der großen Institutionen wie IWF, BMZ oder GTZ beruht in großem Maße auf der Annahme, daß die positive Entwicklung eines Landes einhergeht mit seiner wirtschaftlichen Entwicklung, welche durch ein stärkere Einbindung der Gesellschaften in den Weltmark gefördert werden soll. Viele ihrer Entwicklungsstrategien bauen auf Wirtschaftstheorien auf, die am Modell des modernen Europas des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden. Diese Strategien werden nun auf Gesellschaften übertragen, die mit diesem Modell nur wenig gemeinsam haben. Denn im Europa des 19. Jahrhunderts fand die Herauslösung der Wirtschaft aus der Gesellschaftsstruktur statt und die wirtschaftliche Motivation kann sich seither frei von jeglicher gesellschaftlichen Kontrolle behaupten, wohingegen traditionelle Gesellschaften eben gerade durch dieses Moment der engen Bindung zwischen wirtschaftlichem Handeln und gesellschaftlicher Verpflichtung geprägt sind. Karl Polanyi hebt hervor, daß "zum Verständnis früherer oder weniger entwickelter Gesellschaften, in denen die ökonomischen Beziehungen noch im Gesellschaftssystem eingebettet sind (...) eine neue Theorie der vergleichenden Ökonomie" entworfen werden muß (Polanyi 1979: S. 1).
Ein wichtiger Teilaspekt dieser neuen vergleichenden Ökonomie ist die verschiedene Verwendung und Funktion von Geld in modernen und primitiven Gesellschaften. Diese wird im folgenden am Beispiel der Verwendung von Viehwährung in traditionellen Nomadenstämmen untersucht, um aus diesem Verständnis resultierend die Notwendigkeit einer vergleichenden Wirtschaftstheorie zu bekräftigen.
Zur Einordnung der verschiedenen Position in ein dahinterstehendes Theorieverständniss soll vorweg die Debatte zwischen Formalisten und Substantivisten dargestellt werden.
2.Wie die traditionelle Gesellschaft aus formalistischem oder substantivistischem Theorieverständniss betrachtet wird.
In den sechziger Jahren entstand in Entwicklungstheoretischen Kreisen eine Debatte, die sich mit dem Wirtschaftsverhalten in traditionellen Gesellschaften auseinandersetzte.
In dieser Debatte stehen die Formalisten, welche die Gültigkeit der neuen Wirtschaftstheorie auch auf traditionelle Gesellschaften erweitern wollen, den Substanivisten gegenüber, die meinen, daß traditionelle Gesellschaften einer grundauf anderen Logik folgen als moderne Gesellschaften, weswegen zum Verständnis dieser Gesellschaften eine neue Theorie entworfen werden müsse.
Der Untersuchungsgegenstand dieser Debatte ist die traditionelle Gesellschaft, die als Gesellschaft definiert wird, die vorwiegend Subsistenzwirtschaft betreibt und somit auch als Nichtmarktgesellschaft beschrieben wird.
Die Frage, die die Vertreter der verschiedenen Positionen beantwortet haben wollen, behandelt die spezifische Rationalität verschiedener Gesellschaften.
Eine der Hauptfragen, um die sich lange Zeit die Diskussion drehte, ist ob wirtschaftliches Handeln einer anderen Rationalität folgt als Handeln in anderen gesellschaftlichen Bereichen?
Als wirtschaftliches Handeln betrachten die Formalisten jegliches nach Gewinn strebende Handeln und die Entstehung des Tauschhandels wird durch diese Gewinnstreben, in Form von Nutzenmaximierung, begründet. Unter den Formalisten scheiden sich die Geister, wenn es um die Übertragbarkeit dieses Konzeptes vom rationalen Handeln auf andere gesellschaftliche Bereiche geht. Die Sozialanthropologen unter den Formalisten, wollen die Anwendung dieses wirtschaftlichen Handelns auf den Bereich der Gesellschaft beschränken, der die Gewinnung materiellem Nutzen beinhaltet. Dem wird entgegengesetzt, daß auch das Streben nach Kontrolle und Macht über andere Personen, dem Ziel der Nutzenmaximierung folgt und schließlich in allen gesellschaftlichen Bereichen dieses Handlungsziel bestehen muß.
Während die Formalisten davon ausgehen, daß der Mensch grundsätzlich ein rational handelndes nutzenmaximierendes Individuum, ein sogenannter Homo economicus, ist, dessen rationales Handeln in traditionellen Gesellschaften durch Tabus und andere soziale Regelungen eben stark eingeschränkt wird, weist die Grundannahme der Substantivisten ein gänzlich anderes Menschenbild auf. Der Mensch ist in den Augen der Substantivisten kein ökonomisches, sondern ein soziales Wesen, denn" das Tun der Menschen gilt nicht der Sicherung ihres individuellen Interesses an materiellem Besitz, sondern der Sicherung ihres gesellschaftlichen Ranges, ihrer gesellschaftlichen Ansprüche und ihrer gesellschaftlichen Wertvorstellungen" (Polanyi (1978) nach Schultz (1996): S. 126). Dementsprechend wird wirtschaftliches Handeln als Prozeß der Produktion und Konsumption materieller Güter interpretiert und nicht, wie bei den Formalisten, allgemein als zweckrationales, nutzenmaximierendes Handeln. Die Entstehung des Tauschhandels wird von den Substantivisten durch die aus der Alters- und Geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung resultierenden Notwendigkeit, das materielle Leben zu organisieren erklärt, "wobei der ökonomische Prozeß als solcher durch Blutsverwandtschaft, Heirat, Altersgruppen, Geheimgesellschaften, Totembünde und öffentliche Zeremonien in Gang gesetzt wird" (Polanyi (1979), nach Schultz (1996): S. 35). Nach Meinung der Substantivisten schränken diese gesellschaftlichen Institutionen nicht das gewinnmaximierende Handeln des Individuums ein, wie die Formalisten es behaupten, vielmehr wird wirtschaftliches Handeln (also auch Gewinnmaximierung) erst im durch Institutionen getragenen gesellschaftlichen Rahmen erlernt. Das Verhalten der Menschen ist demnach nur dann durch rationales wirtschaftliches Handeln geprägt, wenn sie in Institutionen wirtschaften, die solches Handelnd fördern. Die Institutionen, die formales ökonomisieren bewirken, gibt es allerdings nur in Gesellschaften mit hochentwickelter Arbeitsteilung und unpersönlichen Wirtschaftsstransaktionen, wo Güter-, Dienstleistungs- und Ressourcenströme allein durch den Markt reguliert werden. Das Paradigma des nach Gewinn strebenden Individuums läßt sich gesamtgesellschaftlich also nicht sinnvoll anwenden, da diese Institutionen in traditionellen Gesellschaften nicht gegeben sind.
Da in traditionellen Gesellschaften wirtschaftliches Handeln nicht von anderen gesellschaftlichen Bereichen getrennt stattfindet, sondern untrennbar mit ihnen verbunden ist, stellt sich aus substanitivistischer Perspektive die Frage nach der Übertragbarkeit von rationalem wirtschaftlichen Handeln auf andere Gesellschaftsbereiche eigentlich gar nicht. Von Interesse ist hier vielmehr welchen Zielen die gesellschaftlichen Institutionen, die das auf Reziprozität und Redistribution bestimmte Handeln der Individuen in traditionellen Gesellschaften bestimmen, folgen. Entgegen der Behauptung der Formalisten, daß die Institutionen der traditionellen Gesellschaft irrational sind, da sie das rationale Wirtschaftshandeln der Individuen einschränken, ist es Douglas gelungen eben jene Rationalität der Institutionen in traditionellen Gesellschaften herauszustellen, indem sie aufzeigt, daß diese Institutionen genauso rational begründet sind, bloß daß diese Rationalität vielmehr durch das Bedürfnis nach allgemeiner Sicherheit bzw. Risikominimierung geprägt ist, als durch das Bedürfnis nach individuellem Vorteil den Mitmenschen gegenüber. Geht man davon aus, daß traditionelle Gesellschaften durch die ständige Bedrohung von Dürrejahren, Mißernten oder Seuchen einem verhältnismäßig großem Risiko ausgesetzt sind, wird ihr Verhalten verständlich, welches dem Bedürfnis nach Risikominimierung entspringt. Betrachtet man soziale Normen wie Reziprozität und Redistribution unter diesem Gesichtspunkt, wird auch der persönliche Nutzen deutlich, den die Individuen daraus ziehen, wenn sie überschüssige Produktion lieber an ihre Mitmenschen verteilen als sie gewinnbringend zu verkaufen. Das Recht und die Möglichkeit zu verteilen schafft nicht nur soziales Ansehen, sondern gibt gleichzeitig die Sicherheit, daß einem selber in Notsituationen gegeben wird.
3. Die Funktion von Geld in traditionellen und modernen Gesellschaften
Der wesentliche Unterschied zwischen modernen und traditionellen Gesellschaften besteht wie oben erläutert nicht darin, ob den Individuen dieser Gesellschaften nutzenmaximierendes Handeln zugesprochen werden kann oder nicht; das wesentliche Moment ist vielmehr, daß in traditionellen Gesellschaften wirtschaftliches und soziales Handeln untrennbar miteinander verbunden sind und es sogar meist schwer fällt, eine Handlung analytisch in diese Teilaspekte zu zerlegen, wohingegen moderne Gesellschaften eben durch eine klare Trennung von wirtschaftlichem und sozialem Handeln gezeichnet sind. In traditionellen Gesellschaften gibt es streng genommen keine wirtschaftliche Beziehung, die nicht durch ein personales Element geprägt ist.
Bei der Betrachtung von traditionellen Gesellschaften wird oft der Fehler begangen, daß Begriffe die Funktionen von modernen Gesellschaften beschreiben auf traditionelle Gesellschaften übertragen werden. Dieses Vorgehen führt, wenn man die Bedeutung von Geld untersucht, zu der Vorstellung, daß traditionelle Gesellschaften den Gebrauch von Geld nicht kennen und erst durch den Kontakt mit modernen Gesellschaften deren Nützlichkeit erkannt haben. Dabei wird übersehen, daß in traditionellen Gesellschaften einfach nur anders geartete Geldformen bestehen, die ihrer oben beschriebenen sozialen Logik gerecht werden. So wird z.B. von den Nationalökonomen die Existenz einer Vielzahl von kulturellen Variationen von Geld abgestritten und allein dem in westlichen Gesellschaften angewandten Allzweckgeld, das die drei klassischen Geldfunktionen Tauschmittel, Wertstandard und Wertaufbewahrungsmittel in einem vereint, wird Geldcharakter zugeschrieben. Aber nicht nur die Nationalökonomen, sondern auch einige Anthropologen, wie z.B. Firth übersehen ihre egozentristische Sichtweise, wenn sie Geld anhand der Funktionen, die es in einer vollintegrierten Marktwirtschaft einnimmt definieren. Von Firth wird Geld folgendermaßen definiert: "In jeglichem ökonomischen System, wie primitiv es auch sein mag, kann ein Gegenstand nur dann als wirkliches Geld betrachtet werden, wenn es als ein bestimmtes allgemeines Tauschmittel fungiert, als ein praktisches Zwischentauschmittel, mit dessen Hilfe man eine Sache gegen eine andere Sache erwirbt. Bei diesem Vorgang dient es jedoch auch als Wertmesser, und es ermöglicht, den Wert aller anderen Sachen eigenständig auszudrücken." (Firth nach Polanyi 1979: S. 322). Nach dieser Definition können die verschiedenen Arten von Geld in traditionellen Gesellschaften nur dann auch als Geld betrachtet werden, wenn sie wie in modernen Gesellschaften alle Geldfunktionen auf einmal erfüllen. Diese Definitionsweise mißachtet die Tatsache, daß nur in modernen Gesellschaften die Geldfunktionen unter einem monetärem Mittel subsumiert werden, während sie in traditionellen Gesellschaften getrennt institutionalisiert sind (vgl. Dalton 1967: S. 143). Wenn man Geld nur dann als Geld definiert, wenn es wie in modernen Gesellschaften als Allzweckgeld fungiert, dann spricht man den traditionellen Gesellschaften die Existenz von Geld ab. Genauso vermessen wäre es nach Dalton die Familie nach dem Konzept der modernen Kleinfamilie zu definieren und daraus zu schlußfolgern, daß es in traditionellen Gesellschaften keine Familie gibt (Vgl. Dalton, zitiert nach Schultz 1996: S.137).
Um diesen Trugschluß zu vermeiden, definiert Polanyi Geld als quantifizierbare Objekte, die für einen der folgenden Verwendungsformen benützt werden: Bezahlung, Wertmaßstab, Hortung oder Tausch (Vgl. Polanyi 1979: S. 333).
Der Ursprung des Geldes läßt sich laut Polanyi nicht - wie die ökonomische Geldentstehungstheorie konstatiert - aus einer Neigung des Menschen zum Tausch begründen, vielmehr liegt der Ursprung des Geldes in nichtökonomischer Schuldhaftigkeit, die in archaischen Gesellschaften als Folge von bestimmten Ereignissen wie z. B. Status, Blut, Prestige, Rache, Verwandtschaft, Verlobung etc. besteht. Das spezifische Merkmal von Geld als Zahlungsmittel entsteht durch die Quantifizierung dieser Schuld z.B. in Form von bestimmten Abgaben, die an den übergeordneten Herrn zu richten sind, oder durch eine bestimmte Anzahl von Peitschenhieben oder Drehungen der Gebetsmühle. Die Verbindung von Geld als Zahlungsmittel mit der Wirtschaft findet demnach erst dann statt, wenn es sich bei den zu zahlenden Einheiten um physische Gegenstände handelt.
Den verschiedenen Objekten werden dann numerische Werte zugeordnet, so daß diese Objekte die Funktion eines Wertmessers innehaben und auch zum Zweck des Tausches oder der verwaltungsmäßigen Kontrolle verwendet werden können. Die Verwendung von Geld als Tauschmittel entsteht laut Polanyi erst, durch den Kontakt einer Gesellschaft mit anderen Gesellschaften; zum Handel mit den fremden Personen dieser Gesellschaft sind Gegenstände mit festgeschriebenem Wert von Nöten, da hier jegliche durch zwischenmenschliche Beziehung gegebene Langzeitversicherung nicht aufgebaut werden kann.
Da es unübersehbar Unterschiede in Funktion und Verwendung von Geld in traditionellen und in modernen Gesellschaften gibt, genauso wie es Unterschiede zwischen der modernen Kleinfamilie und der Großfamilie gibt, ist es nötig zur Präzisierung des Inhaltes über den gesprochen wird, den Begriff "Geld" durch sprachliche Ergänzungen so zu erweitern, daß deutlich wird auf welchen Sachverhalt er sich bezieht. Polanyi spricht deswegen von Allzweckgeld, wenn er von Geld spricht, daß der Definition des Nationalökonomen entspricht.
Obwohl Douglas mit Dalton und anderen Substantivisten einer Meinung ist, daß es verschiedene Funktionen und Verwendungsarten von Geld in verschiedenen Gesellschaften gibt, negiert sie es traditionelle Zahlungsmittel als Geld zu bezeichnen. Da für Douglas der ausschlaggebende Unterschied des traditionellen Geldes vom modernen Geld darin besteht, daß Geld in traditionellen Gesellschaften durch die getrennt institutionalisierten Verwendungsarten die Funktion der Rationierung einnehmen kann, wohingegen das moderne Geld jenseits jeglicher sozialen Kontrolle für jeden Zweck eingesetzt werden kann, unterscheidet sie Geld in Marktgesellschaften von Geld in traditionellen Gesellschaften durch den Freiheitsgrad der Geldtransaktion. Die spezifische Verwendungsform von Geld als "limited purpose money" wird von Forde/Douglas als eines der Wesensmerkmale von traditionellen Gesellschaften überhaupt angesehen (Vgl Ford/Douglas nach Schultz 1996: S. 143). Nur wenn verschiedene Geldmittel einzig in der für sie vorgesehenen Verwendungsform (z.B. Brautpreis, Viehfreundschaft oder Kaurimuschel) eingesetzt werden können, kann der Einsatz von Geld überprüft werden und die auf Reziprozität und Redistribution basierende soziale Norm der traditionellen Gesellschaften gesichert werden.
So soll z.B. in XXX durch die Verwendung von der sehr selten vorkommenden Kaurimuschel, die nur für ganz bestimmte Zwecke zum Tausch eingesetzt werden kann, die Verteilung von knappen Ressourcen kontrolliert werden. Aufgrund dieser Unterscheidung bezeichnet Douglas Geld in traditionellen Gesellschaften als Bezugsscheine. Diese Bezugsscheine sind nur bestimmten Transaktionen zugeordnet und nicht universell eintauschbar.
Die verschiedenen Funktionen, die Geld erfüllen kann, sind abhängig von seiner stofflichen Beschaffenheit, so kann nur ein äußerst seltener Gegenstand wie die Kaurimuschel der Rationierung bestimmter Ressourcen dienen, und nur haltbare Objekte können gehortet werden sowie nur homogene Objekte einen einheitlichen Wertmaßstab bilden können. Modernes Allzweckgeld muß in seinen miteinander kombinierten Funktionen die Eigenschaften Anonymität, Homogenität, Teilbarkeit und Seltenheit aufweisen.
Die Entstehung von Geld (nach dem modernen Verständis vom Allzweckgeld) wird oft als Ursache für die in modernen Gesellschaften bestehende Trennung von wirtschaftlichem und sozialem Handeln betrachtet. So ist für Simmel Geld der Agent, der eine Gemeinschaft in eine Gesellschaft umwandelt, denn erst die "ganze Herzlosigkeit des Geldes" (Simmel 1958: S. 187) bringt rational kalkulierende Individuen hervor, da die Geldwirtschaft die Entfernung des personalen Elementes aus den Beziehungen zwischen den Menschen begünstigt (vgl. Simmel 1958: S. 395). Diejenigen, die in der Verwendung von Allzweckgeld nicht die Ursache für diese Trennung sehen, betrachten die Existenz von Allzweckgeld als eine wichtige Voraussetzung für diese Trennung und sie deuten das Entstehen des Allzweckgeldes als "Ausdruck der Individualisierung von sozialen Beziehungen" (Schultz 1996: S. 149). Für diese Ansichtsweise, die es ablehnt anzunehmen, daß Geld seine eigene Revolution schafft, spricht die Tatsache, daß in einigen Gesellschaften in denen beide Arten von Geld Verwendung finden, in bestimmten sozialen Bereichen eine Traditionalisierung von modernem Geld zu beobachten ist. Dies ist insbesondere in Bereichen der Fall, wo traditionelles Geld als eine Art Bezugsschein verwendet wird, wohingegen andere getrennt institutionalisierte Verwendungsformen traditionellen Geldes wie z. B. die einfache Tauschmittelfunktion sich ohne Widerstand im Allzweckgeld auflösen können.
Wie durch die Verwendung von traditionellem Geld soziale und wirtschafltiche Prozesse miteinander verbunden werden können soll nun am Beispiel der Viehwährung dargestellt werden.
4. Die multifunktionale Rolle von Vieh als Klammer zwischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transaktionen
Anhand der Verwendung von Viehgeld läßt sich hervorragend die Bedeutung von traditionellem Geld herausstellen. Einige Autoren sehen in der Verwendung von Vieh als Währung sogar den Ursprung der Verwendung von monetären Mitteln überhaupt. Die These, daß die Entstehung des Geldes auf die Verwendung von Vieh als Währung zurückzuführen ist, wird durch die Ethymologie bestätigt: So ist die Bezeichnung der Römer für Geld "pecunia" als Viehgeld zu übersetzen, die Bezeichnung für den Zins eines Kredites "texos" bezeichnet die Fruchtbarkeit von Nutztieren, und auch das Wort Kapital wird ethymologisch auf die Kopfzahl einer Viehherde zurückgeführt (Duden, das Herkunfstwörterbuch der deutschen Sprache).
In seiner Kapitalgutthese geht Schneider davon aus, daß die Bedeutung von Vieh nicht aus seiner Funktion in der Subsistenzversorgung herzuleiten ist, sondern daß Vieh als Kapitalgut zum einen die beste Möglichkeit der Verwertung von Kapital darstellt und zum anderen auch noch als Geld einen Wert an sich darstellt. Für Schneider besteht grundsätzlich kein Unterschied zwischen der Tauschmittelfunktion, die Rinder in afrikanischen Ethnien erfüllen und dem Geld von modernen Gesellschaften (Vgl. Schneider 1961 nach Schultz 1996: S. 139). Um die hohe Wertschätzung von Vieh richtig einordnen zu können, braucht man seiner Meinung nach nur diese Rolle von Vieh in traditionellen Gesellschaften zu akzeptieren: " We need only to accept the fact that livestock are valued for themselves, just as understanding the western economic man does not require us to explain why he values gold." (Schneider 1985 nach Schultz 1996: S. 54). Hierbei betrachtet er jedoch nur den Aspekt des Viehgeldes, der sich aus seiner Tauschmittelfunktion verbunden mit einem ihm zugerechneten Wertstandard ergibt, und er vernachlässigt die Funktion von Vieh als Zahlungsmittel, die oftmals einer gänzlich anderen Logik folgt, was unten am Beispiel des Brautpreises noch weiter ausgeführt werden soll. Die gleiche Herleitung der Funktion von Vieh als Geld durch seine Tauschmittelfunktion wird von Engels bei der Beschreibung der Urgesellschaft dargelegt: "(...) Vieh wurde die Ware, in der alle anderen Waren geschätzt und die überall gerne im Austausch gegen jenen genommen wurde - kurz, Vieh erhielt Geldfunktion und tat Gelddienste schon auf dieser Stufe. " (Engels XY: S. 156).
Diese Gleichsetzung von Vieh mit modernem Geld kann nur solange Gültigkeit haben, wie man die Funktion von Vieh als Zahlungsmittelfunktion gänzlich aus der Betrachtung ausschließt, denn als Zahlungsmittel fungiert Vieh eben gerade nicht, weil es wie modernes Geld ist, sondern gerade weil es anders ist. Im Gegensatz zum modernen Geld ist es nicht mit den stofflichen Eigenschaften der Anonymität und Homogenität ausgestattet und kann somit ebenfalls soziale Bedeutungsebenen bei der Transaktion mit einander verknüpfen. Vieh kann in seiner Eigenschaft als lebendes Wesen, das durch seine Nachkommen über Generationen hinweg weiter existiert, hervorragend als Symbol für die Beziehung der Menschen untereinander dienen. Es stellt ein kontinuierliches Element innerhalb des Sozialgefüges einer Gesellschaft dar, weil es allgegenwärtig an den Erwerbsprozeß seiner selbst erinnert. Jedes Vieh verkörpert somit eine einzigartige Geschichte sozialer Beziehungen, die durch Zahlung, Geschenk oder Tausch besiegelt wurde.
Die Tshidi Barolong, ein Tswana Volk, praktizieren z.B. mit der Verbindung von "cattle linkage of siblings and bridewealth" (Comarfoff 1990: S. 203) eine Sitte, durch die der Braut, wenn sie die eigene Familie verläßt, bei der Übergabe des Brautpreises die weitere Verbundenheit mit der eigenen Familie insbesondere dem Bruder versichert wird. Jedem Mädchen wird nach der Geburt ein Bruder zugeordnet, der für sie verantwortlich ist. Der Bruder erhält den Brautpreis der Schwester, mit dem er für seine eigene Frau werben kann. Mit der Annahme des Brautpreises erhält er gleichzeitig eine Erinnerungsstütze an seine lebenslang währende Verantwortung der Schwester gegenüber.
Die Transaktion des Viehs bekommt hier neben seiner ökonomischen Funktion eine soziale Bedeutung.
Eben diese Bedeutung von Vieh hebt Herskovitz (1926) in seinem Artikel über den "Cattle Complex" in Ostafrika hervor. Er will deutlich machen, daß die Logik dieser Gesellschaften nur verstanden werden kann, wenn man die Rolle der Rinder im sozialen, politischen und rituellen Leben untersucht (Vgl. Herskovitz nach Schultz 1996: S. 53). Die Übergabe von Rindern beim Brautpreis deutet er als rein rituelle Handlung durch welche die Ehe geschlossen wird. Herskovitz ist der Meinung, daß die gesellschaftliche Stellung von dem Besitz von Rind abhängig ist. Dies begründet für ihn auch, warum Viehalter, trotz ansteigender Arbeitsintensität übermäßig viel Vieh besitzen wollen: Sie tun es aus Prestigegründen.
Dem Pastoralismus wird von klassischen Ökonomen Irrationalität vorgeworfen, da die Nomaden mit Vieh auf dem Markt nicht ökonomisch kalkulieren, denn entgegen der klassischen Theorie von Angebot und Nachfrage, verkauft der Pastoralist mehr Vieh auf dem Markt, wenn die Preisen niedrig als wenn die Preise hoch sind.
Nach Herskovitz ist dieses Verhalten der Nomaden, die nicht auf Anreize aus dem Marktsektor reagieren der Beweis dafür, daß Rinder einen Wert außerhalb der ökonomischen Tradition darstellen, denn ein Viehalter verkauft nur so wenig Rinder wie nötig sind, um bestimmte Fixkosten wie Hüttensteuer oder Schulgebühren zu bezahlen, da seine gesellschaftliche Stellung aus dem Besitz von Rindern abgeleitet wird.
Sowohl die Kapitalgutthese von Schneider als auch der Cattle Complex von Herskovitz haben zu der weitverbreiteten Ansicht geführt, daß "Overstocking" und Überweidung allein durch die Wertschätzung von Vieh als Prestigegut oder als Kapitalgut bedingt sind. Die Hirten werden demnach als Opfer ihrer eigenen Einstellungen und Traditionen betrachtet. Gegen diese Ansicht argumentiert eine Gruppe von Anthropologen, indem sie die Subsistenzfunktion des Viehs wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen. Das halten großer Vieherden erfüllt ihrer Meinung nach zwei wichtige Funktionen zur Sicherung der eigenen Subsistenz: Zum einen sind große Viehherden von Nöten, um die Milchversorgung zu gewährleisten, zum anderen erfüllen große Viehherden die Funktion der Risikoabsicherung im Falle einer möglichen Dürre, Seuche oder ähnlichem. Diese Risikoabsicherung ist auch der Grund, warum Viehgeschenke als Freundschaftssymbole durchgeführt werden, es handelt sich hierbei um eine Versicherung, daß einem selbst in Zeiten der Not geholfen wird. Durch das Verschenken oder Verleihen von Vieh treten für den Geber gleich zwei Vorteile in Kraft, zum einen wird der Arbeitsaufwand bei einer kleineren Herde geringer, zum anderen ist er versichert für den Fall, daß die eigene Herde bedingt durch Viehdiebstahl, Dürre oder ähnliches so weit reduziert wird, daß seine eigene Subsistenz hierdurch gefährdet ist. Das hohe Ansehen, das eine Person innehat, wenn sie eine große Herde besitzt resultiert demnach aus der Möglichkeit des Besitzers Vieh an bedürftige Personen zur Milchgewinnung und dergleichen zu verleihen oder sogar zu verschenken.
Hiermit haben die Substantivisten, durch das Herausstellen von Risikovermeidungsstrategien traditioneller Gesellschaften, diesen Gesellschaften ihre Rationalität wiedergegeben, denn das Handlungsmotiv der Risikominimierung ist in der Lebenssituation dieser Menschen weitaus rationaler als das Motiv der Gewinnmaximierung.
Die Vorliebe der Verwendung von Vieh als Tauschmittel, Zahlungsmittel, Hortungsmittel oder Wertmesser läßt sich demnach durch die Möglichkeit der Verbindung von wirtschaftlichen mit sozialem Handeln herleiten, denn hierdurch wird zugleich eine auf Reziprozität und Redistribution beruhende Risikominimierung gewährleistet. Die Tiere zirkulieren dabei nicht frei entsprechend einer Marktlogik, ihre Zirkulation ist vielmehr bestimmten Regeln unterworfen, die das Überleben aller in der Gesellschaft sichern sollen.
In einer "embedded economy", in der soziale, rituelle und ökonomische Aspekte des Lebens nicht voneinander zu trennen sind, bekommt das Vieh in seiner vielschichtigen Verwendung eine multifunktionale Bedeutung als Klammer zwischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transaktionen (vgl .Schultz 1996: S. 52 ff.).
Mit anderen Worten, die Rolle von Vieh als Währung erhält Bedeutung durch die Art und Weise wie dadurch der Produktionsprozeß mit dem Austausch verbunden wird, durch die Tatsache, daß es sich beim Vieh sowohl um ein konkretes Objekt als auch um die Verkörperung von geordneten Werten und Beziehungen handelt sowie dadurch, daß das Vieh durch sein Zirkulieren und seine Reproduktion soziale Systeme schafft.
5. Der Wandel traditioneller Gesellschaften im Kommerzialisierungsprozess
Heutzutage gibt es kaum noch reine Subsistenzwirtschaften, vielmehr sind die heute als traditionelle Gesellschaft beschriebenen Gesellschaften gezeichnet durch ein Mischung von traditionellen und modernen kommerziellen Elementen, in denen beide Arten der oben erläuterten Geldfunktionen und Geldverwendungen nebeneinander existieren.
Ein bemerkennswertes Phänomen ist hierbei die auftretende Traditionalisierung von modernem Geld, zur Sicherung des Fortbestehens sozialer Normen. So wird z.B. bei den Tshidi Barolong, einem Tswana Volk, die homogene Masse des modernen Geldes durch Zuweisung für bestimmte Transaktionzwecke unterschiedlich gehandhabt, wodurch dem Geld weiterhin Bezugsscheincharakter anhaftet. Dieses Geld wird von den Tshidi Barolong "cattle without legs"( Comarfoff 1990: S. 210) genannt und es wird bei Transaktionen mit Signal oder Symbolcharakter wie, Heirat, Patronageausleihe oder Bezahlung von Heilern und dergleichen verwendet. Es handelt sich hierbei um eine Geldmenge, die eine bestimmte Anzahl von Vieh anhand eines symbolischen Viehpreises repräsentieren soll.
Eine andere Strategie zum Schutz der traditionellen Werte wird von den Luo, einem Ostafrikanischen Stammesvolk, verfolgt. Anstatt modernes Geld zu traditionalisieren, verteufeln sie Geld, daß auf unehrenhafte Weise erwirtschaftet oder eingesetzt wird. Ihrer traditionellen sozialen Logik zu Folge bestimmt die Art und Weise wie man Gewinn erntet auch wie der Gewinn genutzt werden sollte. Geld, daß nicht diesen Regeln folgt, wird von den Luo als Pesa Makech, was soviel heißt wie bitteres Geld; bezeichnet. Der Umgang mit diesem bitteren Geld wird mit schlechten Schwingungen in Verbindung gebracht, die sich auf jeden der damit zu tun hat auswirken sollen.
Die Menschen versuchen auf diese Art und Weise ihre traditionelle auf Reziprozität und Redistribution basierende Wirtschaftsweise vor den Versuchungen der Kommerzialisierung mit ihrem reizvollen Warenangebot zu schützen.
Die Frage, die bei der Beobachtung dieses Phänomens auftritt, ist, ob die derzeit zu beobachtende Verbindung der beiden Sozialsysteme nur Übergangscharakter hat oder ob sich die moderne Rationalität zwangsläufig durchsetzten muß.
Kommerzialisierungsprozesse werden sowohl als Ursache von Wandlungsprozessen schlechthin betrachtet als auch als das Ziel der Entwicklungsbemühungen von Anhängern der Modernisierungstheorie anvisiert.
Die Entstehung der Kommerzialisierung von traditionellen Gesellschaften wird allgemein durch den Kontakt einer Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft, die andere Güter produziert erklärt. Der daraufhin einsetzende Außenhandel ist durch kommerziellen Tausch geprägt, weil er außerhalb des bestehenden Sozialsystems von statten geht. Die Verwendung von "herzlosem Geld" (Simmel 1989: S. XY) ist für die Funktionsfähigkeit dieses kommerziellen Handels eine wichtige Bedingung, d.h. nach dieser Ansicht ist die Verwendung von Allzweckgeld nicht die Ursache des Wandels (siehe X.). Durch den Kommerzialisierungsprozeß entsteht ein Druck auf die Subsistenzproduktion, die vormals konkurrenzlos das einzige Wirtschaftsziel war. Solange die Bedürfnisse nach den auf dem Markt angebotenen mit Allzweckgeld zu erstehenden Produkten gering sind, kommt es nur zu einer partiellen Kommerzialisierung der traditionellen Gesellschaften, d. h. es wird weiterhin nur soviel Vieh auf dem Markt verkauft, wie nötig ist, um die Konsumbedürfnisse zu befriedigen und den Zahlungsverpflichtungen wie Steuern etc. nachkommen zu können. Dabei wird weiterhin darauf geachtet, daß die Herdengröße zur Subsistenzversorgung ausreicht. Der Preis auf diesen Märkten reguliert nicht das Angebot. Für die Tierhalter bleiben die Märkte Targetmärkte.
Ein unausweichliches Verschwinden dieser zu Beginn des Kommerzialisierungsprozesses weiterhin bestehenden Targetmärkte prophezeite in den sechziger Jahren eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern. Ihnen zu Folge führt der Prozeß der Kommerzialisierung durch ein zunehmendes Begehren nach Konsumgütern zur Aufgabe der auf Eigenproduktion und reziproken Tausch basierenden traditionellen Wirtschaftsweise und eine volle Integration in die Marktwirtschaft ist das unausweichliche Endresultat. Dieser Behauptung wird von Bourgeot (Vgl. Bourgeot 1981 nach Schultz 1996: S. 159) das Argument gegenübergestellt, daß durch die Kommerzialisierung und Monetarisierung nur dann die traditionellen Regeln außer Kraft gesetzt werden können, wenn die Versorgung bedingt durch den Wandel nicht mehr von der Subsistenz sondern vom Markt abhängig ist. Die mögliche Entstehung dieser Abhängigkeit wird von Behnke als Kommerzialisierungsdilemma (Vgl. Behnke 1984 nach Schultz 1996: S. 162) beschrieben. Dieses Dilemma entsteht, wenn Pastoralisten ihre Produktionsmethoden verändern, um im Sinne der Markteffizienz schneller und besser produzieren zu können. Da aus diesem Grund das Melken und Bluten der Tiere sowie ihre Verwendung als Lasttiere weitestgehend eingeschränkt wird, ist der Ertrag für Nahrungsmittelversorgung geringer. Dies hat zur Folge, daß die Tierhalter gezwungen sind mehr Nahrungsmittel auf dem Markt zu kaufen. Um diese Nahrungsmittel kaufen zu können muß wiederum mehr Vieh auf dem Markt verkauft werden. Dieser Kreislauf drängt das Produktionsziel der Eigenversorgung zu Gunsten von kommerziellen Strategien immer weiter zurück und die Tierhalter werden letztendlich abhängig vom Markt.
Wie sich die traditionellen Gesellschaften weiterentwickeln werden, ob sie nur teilweise kommerzialisiert bleiben oder vollständig vom nationalen und internationalen Markt abhängig werden, hängt mitunter auch von dem Einfluß, den Entwicklungshelfer auf den Prozeß ausüben ab. Die Modernisierungstheoretiker sowie die Formalisten betrachten die Kommerzialisierung als Indiz für Fortschritt überhaupt. So sieht Schneider (Vgl. Schneider 1974 nach Schultz 1996: S. 179) die einzige Lösung für das Überleben und den Fortschritt der Hirtenvölker Ostafrikas in deren Integration in die nationalen und internationalen Märkte.
Dieses Kommerzialisierungsgebot wird gestärkt durch die Annahme, daß unter dem Gesichtspunkt der Ressourcenallokation die Viehvermarktung effizienter ist als die Subsistenzversorgung. Das einzige Manko was der Viehvermarktung aus dieser Perspektive zugesagt wird, ist das Fehlen einer sozialen Absicherung in Krisensituation, was sich aber durch den Aufbau einer dem kommerziellen Markt gerecht werdenden modernen Institution der Sozialversicherung beheben ließe. Zur Entkräftung dieser Behauptung weist Behnke (Vgl. Behnke 1984 nach Schultz 1996: S. 161) nach, daß das traditionelle System nach dem Gesichtspunkt der biologischen Effizienz, dem kommerziellen weitaus überlegen ist und fähig ist mehr Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Aus diesem Grund wird das traditionelle System von Scholz als sozio-ökologische Kulturweise des Nomadismus bezeichnet, die eine optimale Strategie zur Überlebenssicherung darstellt. Seiner Meinung nach zeichnet sie sich dadurch aus, "daß sie nicht auf Naturbeherrschung und Naturausbeutung, sondern auf das Leben in und mit der Natur - aus der erfahrungsbedingten Intention, dem erfahrungsbedingten Bewußtsein Nachhaltigkeit sichernden Ressourcenumgangs - gerichtet war."(Scholz 1995: S. 20)
6. Fazit
Die Handlungslogik der traditionellen Viehhaltergesellschaften macht deutlich, daß die komplexen Beziehungen von sozialen, wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Handlungen einen ernstzunehmenden Ansatz darstellen, den äußerst empfindlichen naturräumlichen Gegebenheiten durch eine daran angepaßte Wirtschaftsweise zu begegnen. Diese Wirtschaftsweise unterscheidet sich, nicht nur was die oben dargestellte Funktion und Verwendung von Geld angeht, fundamental von der Wirtschaft der modernen Gesellschaft. Deswegen ist es, zum Verständnis dieser Gesellschaften mit dem Ziel einer kooperativen Zusammenarbeit nötig, eine wie Polanyi verlangt neue vergleichende Wirtschaftstheorie zu stärken.
Literaturverzeichnis
- Bohannan, Paul 1967: The impact of money on African subsistence economy. In: dalton, George (Hrsg.): Tribal and peasant economies. London. S. 123-135.
- Cormafoff, Jean & Jon 1990: Goodly beasts, beastly goods:cattle and commodities in a South African context. In: American Ethnologist, 17/1990. S. 195-216.
- Douglas, Mary 1992: Risk and danger. In: Dies.: Risk and blame - Essays in cultural theory. London, New York. S. 38-54.
- Drosdowski, Günther (Hrsg.) 1989: Duden. Das Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim, Wien, Zürich.
- Engels, Friedrich: der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. In: Marx, Karl; Engels, Friedrich: Werke, Bd. 21.
- Polanyi, Karl 1979: Die Semantik der Verwendung von Geld. In: Ders.: Ökonomie und Gesellschaft. Frankfurt. S. 317-345.
- Scholz, Fred 1995: Nomadismus. Theorie und Wandel einer sozio-ökologischen Kulturweise. Stuttgart.
- Schultz, Ulrike 1996: Nomadenfrauen in der Stadt. Die Überlebensökonomie der Turkanafrauen in Lodwar/Nordkenia. Berlin.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei enthält eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit der vergleichenden Ökonomie befasst, insbesondere im Hinblick auf traditionelle Gesellschaften und die Rolle des Geldes in diesen Gesellschaften im Vergleich zu modernen Gesellschaften. Sie untersucht die Debatte zwischen Formalisten und Substantivisten, die Funktion von Geld, insbesondere Vieh als Währung, und den Wandel traditioneller Gesellschaften im Kommerzialisierungsprozess. Es enthält auch eine Gliederung, eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen und ein Literaturverzeichnis.
Was ist die Debatte zwischen Formalisten und Substantivisten?
Die Debatte zwischen Formalisten und Substantivisten dreht sich um die Frage, ob die gleichen ökonomischen Theorien, die für moderne Gesellschaften gelten, auch auf traditionelle Gesellschaften angewendet werden können. Formalisten glauben, dass dies der Fall ist, während Substantivisten argumentieren, dass traditionelle Gesellschaften einer anderen Logik folgen und eine neue Theorie für ihr Verständnis benötigt wird.
Welche Rolle spielt Geld in traditionellen Gesellschaften?
In traditionellen Gesellschaften ist die Funktion des Geldes oft eng mit sozialen und kulturellen Aspekten verbunden. Geld kann in Form von Vieh oder anderen traditionellen Währungen existieren und dient nicht nur als Tauschmittel, sondern auch als Wertmaßstab, Zahlungsmittel und Hortungsmittel. Im Gegensatz zu modernem Allzweckgeld kann traditionelles Geld in seiner Verwendung eingeschränkt sein und somit soziale Normen und Reziprozität sichern.
Was ist die multifunktionale Rolle von Vieh in traditionellen Gesellschaften?
Vieh spielt in vielen traditionellen Gesellschaften eine wichtige Rolle, die über seine ökonomische Funktion hinausgeht. Es dient als Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Zahlungsmittel, insbesondere bei Brautpreisen und anderen sozialen Transaktionen. Vieh symbolisiert oft soziale Beziehungen und kann zur Risikominimierung beitragen, indem es als eine Art Versicherung in Notzeiten dient.
Wie verändert sich die traditionelle Gesellschaft im Kommerzialisierungsprozess?
Im Zuge der Kommerzialisierung werden traditionelle Gesellschaften mit modernen kommerziellen Elementen konfrontiert. Dies kann zu einer Traditionalisierung von modernem Geld führen, um soziale Normen zu bewahren, oder zur Ablehnung von Geld, das auf unehrenhafte Weise erworben wurde. Der Kommerzialisierungsprozess kann auch zu einer Abhängigkeit vom Markt führen, wenn die Subsistenzproduktion zurückgedrängt wird.
Welche Kritik wird an der Anwendung westlicher Wirtschaftstheorien auf traditionelle Gesellschaften geübt?
Die Kritik besteht darin, dass westliche Wirtschaftstheorien oft von der Annahme einer klaren Trennung von wirtschaftlichem und sozialem Handeln ausgehen, während in traditionellen Gesellschaften diese Bereiche eng miteinander verbunden sind. Die Anwendung dieser Theorien kann daher zu einem falschen Verständnis der wirtschaftlichen Prozesse und der Handlungslogik in traditionellen Gesellschaften führen.
Was wird im Fazit zusammengefasst?
Das Fazit betont die Notwendigkeit einer vergleichenden Wirtschaftstheorie, um die komplexen Beziehungen zwischen sozialen, wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Handlungen in traditionellen Viehhaltergesellschaften zu verstehen. Es wird argumentiert, dass diese Gesellschaften eine an die lokalen Gegebenheiten angepasste Wirtschaftsweise entwickelt haben, die sich grundlegend von der Wirtschaft moderner Gesellschaften unterscheidet.
- Arbeit zitieren
- Nikola Rass (Autor:in), 2002, Die multifunktionale Rolle von Vieh als Klammer zwischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transaktionen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/110385