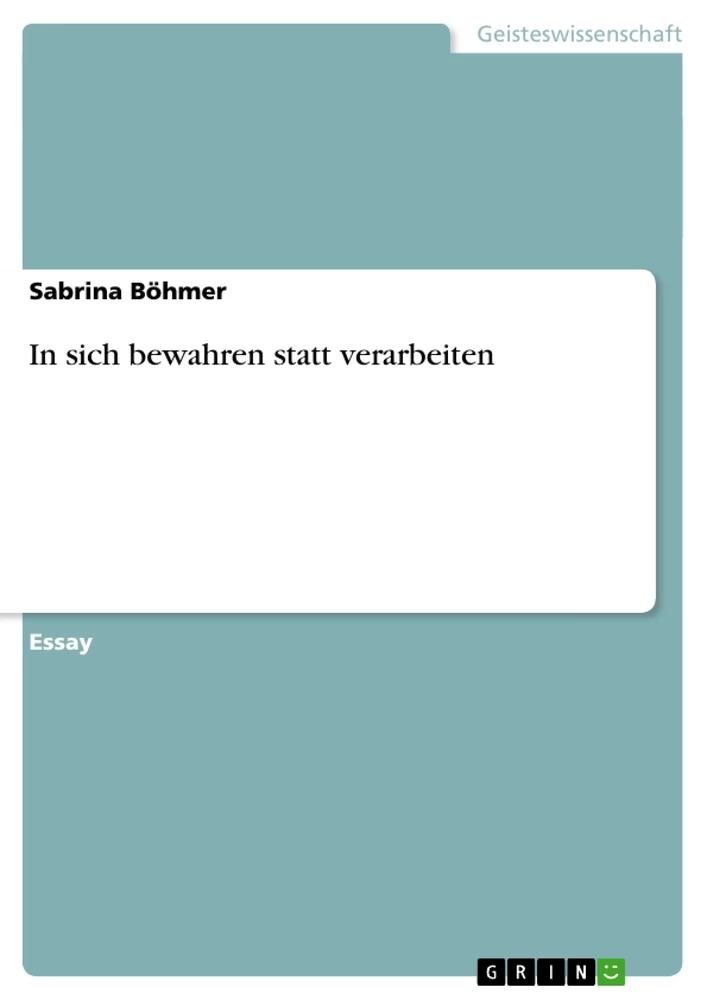Opfer und Täter nach dem Krieg
IN SICH BEWAHREN STATT VERARBEITEN
Essay von Sabrina Böhmer
Massaker, Massengräber, Flüchtlingsströme — Geschehnisse, die die Geschichte unseres Jahrhunderts leider nicht nur einmal prägten. Jüngstes Beispiel: der Kosovo. Hier, wo sich der Kriegszustand angeblich wieder zu entschärfen beginnt, erwartet die Welt einen Neuanfang — ein in Zukunft friedliches Nebeneinander der Ethnien. Doch statt jetzt auf Kommando wieder achtsam miteinander umzugehen, greifen nun Albaner ihrerseits Dörfer an.
Was geht in den einstigen Opfern und sich jetzt häufig in der Position der Angreifer befindlichen Menschen vor? Wie kann erlebtes Leid und Grauen dieses Ausmasses verarbeitet werden? Diesen Fragen möchte ich im Folgenden mittels Übertragung eige- ner Erkenntnisse aus Interviews mit Überlebenden und Tätern der Shoah nachgehen. Meiner Meinung nach ist es nämlich durchaus legitim, diese Resultate für die aktuelle Situation als Folie zu verwenden, um Kriegsfolgen zu ergründen.
SCHULDGEFÜHL DER ÜBERLEBENDEN
Überlebende, die beispielsweise aufgrund einer Flucht dem Vernichtungskrieg entkamen, fühlen sich häufig schuldig, da sie Eltern, Geschwister und Verwandte zurücklassen mussten. Dies ist ein Ergebnis einer internationalen Studie, die sich mit den Auswirkungen des Holocaust auf Angehörige und Nachkommen beschäftigte. Die Überlebenden fühlen sich schuldig, weil sie über ihr rechtzeitiges Entkommen froh waren. Ihre Überlebensschuld ist mit der Zeit verknüpft, in der ihre nächsten Verwandten noch am Leben waren, über die Verfolgung berichten konnten oder konkret um Hilfe für die eigene Flucht baten. Sie ist die Folge der in der Situation erlebten Machtlosigkeit und Überforderung, sich selbst in der Fremde zurechtfinden zu müssen, sich aber gleichzeitig verantwortlich für die Familie und deren Rettung zu fühlen.
Diese Schuldgefühle tragen Überlebende oftmals ihr ganzes Leben mit sich. Sie können sich mit der Familie nicht aussöhnen, können die Situation nicht klären, da sie häufig die einzigen sind, die den Massakern entkamen; und sie können sich Fremden gegenüber nicht öffnen, da sie Anklage erwarten. Anklage dafür, als Frau ihre Familie oder Kinder im Stich gelassen zu haben, nicht da gewesen zu sein, als ihre Männer, Eltern, Geschwister oder Freunde sie am nötigsten gebraucht hätten.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Essay "Opfer und Täter nach dem Krieg"?
Der Essay behandelt die Frage, wie Menschen, die Opfer von Kriegsverbrechen geworden sind und sich später möglicherweise in der Rolle der Angreifer wiederfinden, mit ihrem erlebten Leid und Grauen umgehen. Die Autorin Sabrina Böhmer überträgt Erkenntnisse aus Interviews mit Überlebenden und Tätern der Shoah auf aktuelle Kriegssituationen, wie beispielsweise den Kosovo, um die psychologischen Kriegsfolgen zu ergründen.
Welches Schuldgefühl beschreibt der Essay?
Der Essay beschreibt das Schuldgefühl von Überlebenden, die beispielsweise durch Flucht dem Vernichtungskrieg entkamen. Sie fühlen sich schuldig, weil sie Eltern, Geschwister und Verwandte zurücklassen mussten und froh über ihr eigenes Überleben waren. Dieses Schuldgefühl, die sogenannte Überlebensschuld, begleitet sie oft ein Leben lang.
Warum können sich Überlebende oft nicht mit ihrer Familie aussöhnen oder sich Fremden öffnen?
Überlebende können sich oft nicht mit ihrer Familie aussöhnen, da sie häufig die Einzigen sind, die den Massakern entkamen und die Situation nicht mehr klären können. Fremden gegenüber können sie sich nicht öffnen, da sie Anklage erwarten, beispielsweise dafür, als Frau ihre Familie im Stich gelassen zu haben.
Welchen Einfluss haben traumatische Kriegserlebnisse auf den innerfamiliären Dialog?
Traumatische Kriegserlebnisse haben einen großen Einfluss auf den innerfamiliären Dialog. Der Familiengespräche basieren oft auf der Familienvergangenheit während des Krieges. Entscheidend ist, ob und wie Großeltern und Eltern die Shoah überlebten bzw. inwieweit sie in die Naziverbrechen einbezogen waren.
Welches Ergebnis hatte das erwähnte Projekt im Essay?
Das erwähnte Projekt zeigte deutlich, dass strukturelle Unterschiede im Familiengespräch nicht davon abhingen, ob die Familien nach 1945 in der BRD, der DDR oder in Israel lebten, sondern davon, was die Familie vor 1945 erlebt bzw. erlitten hatte.
- Arbeit zitieren
- Dr. Sabrina Böhmer (Autor:in), 1999, In sich bewahren statt verarbeiten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/110347