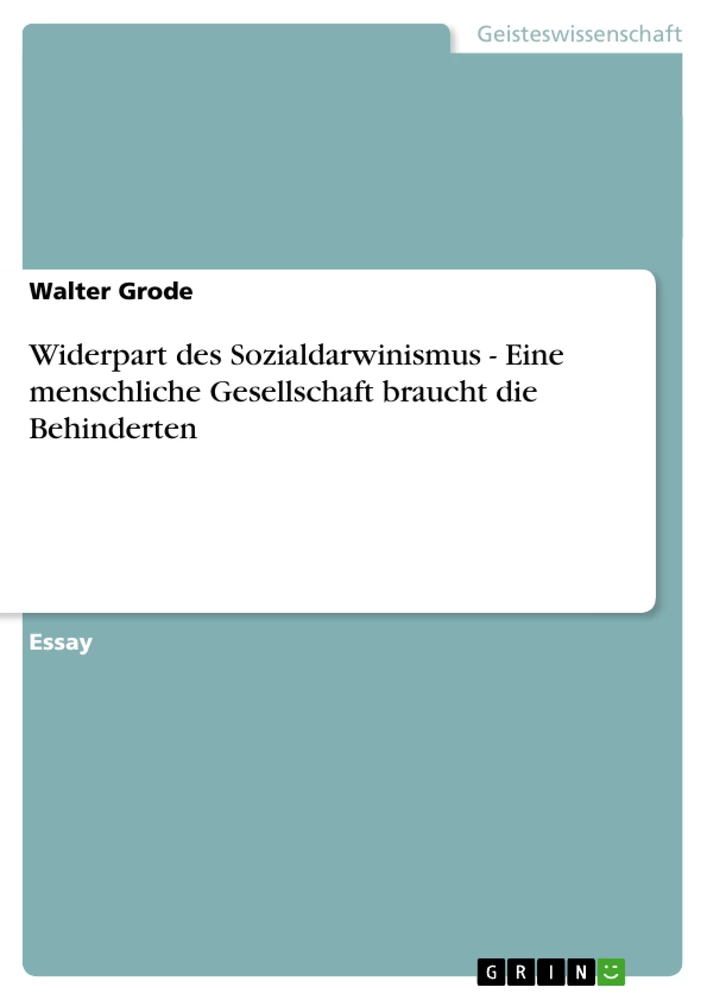Walter Grode
Widerpart des Sozialdarwinismus
Eine menschliche Gesellschaft braucht die Behinderten
( erschienen in: >zeitzeichen< Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft, Heft 11/2001)
Die Gesellschaft benötigt die Behinderten, weil sie die Perspektive menschlicher Hilfsbereitschaft offen halten. Eine sozialdarwinistische Gesellschaft könnte dagegen trotz allem denkbaren Einsatz der Medizin nicht aufhören, Behinderte zu produzieren, einfach deswegen, weil es in ihrer Logik liegt .
A chtundvierzig Prozent aller Deutschen befürworten die Präimplantationsdiagnostik (PID), 47 lehnen sie ab. Doch nur rund 10 Prozent aller werdenden Mütter lassen den Fötus in ihrem Bauch gentechnisch untersuchen.
Zum Vergleich hätten nach einer internationalen Umfrage aus dem Jahre 1993 26 Prozent der Japaner, 43 Prozent der US-Amerikaner, 60 der Inder und 80 Prozent der Thailänder die Gentechnik angewandt, wenn sie es damals bereits gekonnt hätten. Und zwar zur Steigerung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten ihrer Kinder.
Nicht nur in der Forschung, sondern auch im Bewußtsein der Bevölkerung gibt es also - zumindest bei uns in Deutschland - noch "viel Raum diesseits des Rubikon". Mit diesem lakonischen Satz hatte Bundespräsident Johannes Rau in seiner Berliner Rede vom 18. Mai allen widersprochen, die im Streit um eine verbrauchende Embryonenforschung und Präimplantationsdiagnostik für eine Lockerung der Grenzen des Erlaubten plädieren.
Die Forschung an embryonalen Stammzellen, heißt es in der Rede des Bundespräsidenten, ist unvereinbar mit dem Konzept der Menschenwürde, da menschliches Leben vernichtet werden müsste, um es anderem menschlichen Leben nutzbar zu machen. Für eine solche Güterabwegung gibt es keine überzeugende Begründung.
Zugleich wissen wir, sagt der Bundespräsident, dass Krankheit und Behinderung immer zum menschlichen Leben gehören werden. Deshalb wird das Ziel abgelehnt, mit Hilfe der Gentechnik den Versuch zu unternehmen, falsche Maßstäbe vom "perfekten Menschen" zu verwirklichen.
Aber es geht nicht nur um falsche Maßstäbe vom perfekten Menschen. Es geht - diesseits von Ethik und Menschenwürde - auch um richtige oder falsche Maßstäbe für unsere Gesellschaft.
Zumindest in Deutschland nährt sich die beträchtliche Zustimmung der Bevölkerung zur PID vorläufig noch einzig und allein aus der Angst vor Behinderung. Einer Angst, die individuell überaus berechtigt ist und nicht bagatellisiert werden soll.
Gesellschaftlich aber ist diese Angst, und damit die Bereitschaft ethische Grenzen zu überschreiten, jedoch zumindest ambivalent, wenn nicht gar töricht.
Denn was ist das für eine Gesellschaft, die Stärke, Schönheit und Reichtum auf ihre Fahnen geschrieben hat, deren neue Gesetzestafeln die Idee des aggressiven Wettbewerbs feiern? Überall wird der Eindruck vermittelt, als ginge es ums Überleben: "Ihr müßt die Besten, die Stärksten, die Gewinner sein; seid ihr es nicht werden andere es sein", lautet die Botschaft. Flankiert wird das durch durch die von allen Medien kaum noch kaschiert lancierte Botschaft, nur schön und jung und, koste es was es wolle, durchsetzungsfähig zu sein, sei die einzig lohnende Lebensform. Das in dieser Perspektive jede Möglichkeit, das eigene und das fremde menschliche Leben zu manipulieren, dankbar aufgegriffen werden muß, ist eine Selbstverständlichkeit.
E ine solche auf dem sozialdarwinistischen Kult des Stärksten basierende Gesellschaft produziert systematisch behinderte Menschen, indem sie die Schwelle zu dem, was als behindert gelten soll, immer tiefer ansetzt. Und sie benötigt geradezu behinderte Menschen zu ihrer Selbstvergewisserung: In Sport und Politik, Unterhaltung und Alltag dürfen sie sich als besonders motivierte Verfechter des "survival of the fittest" präsentieren - in der Erwartung, dass dies von den (Noch-)Jungen, (Noch-)Starken und (Noch-)Gesunden im rechten Sinne re-interpretiert wird.
Dieses "survival of the fittest" ist die unausgesprochene Grundlage fast allen Gengeschäfts. In einer solchen Gesellschaft wird auch der Hinweis nicht fruchten, dass auch in Zukunft selbst durch die bedingungslose Inanspruchnahme der Gentechnologie allenfalls drei Prozent aller Behinderungen sicher ausgeschlossen werden können.
Denn nur sie sind eindeutig genetischer Natur, der Rest ist erworben. Überwiegend als Teil des unvermeidlichen, gar nicht so selten aber eben auch als Teil des vermeidbaren Risikos: Am Anfang, in der Mitte und am Schluß des Lebens. Insbesondere schwer- und mehrfachbehinderte Menschen (aber) sind das genaue Gegenteil des von der "Gesellschaft der Stärke" propagierten isolierten Einzelkämpfers. Um ihre Qualitäten auch nur ansatzweise entfalten zu können, benötigen sie - wie grundsätzlich alle anderen Menschen auch - Unterstützung.
Des Anderen Helfer
Damit aber üben sie eine durchweg positive Wirkung auf ein Gemeinwesen aus, das von humanitären und christlichen Werten geprägt ist. Gerade auch geistig behinderte Menschen, bringen allein durch ihre pure Existenz das unbewußte Bedürfnis nach Gemeinsamkeit, Humanität und Solidarität in die Welt, das in jedem von uns steckt: "Ich bin glücklich, wenn ich verstanden werde, wenn ich auf andere zählen kann.". "Der Mensch soll des anderen Helfer sein" könnte eine humane Lebensmaxime lauten.
Behinderte Menschen bilden einen Kristallisationskern, um den herum sich (bewusst oder unbewusst) der potentielle Widerpart zum Sozialdarwinismus bildet. Sie mindern allein dadurch, dass man sie gesellschaftlich trägt und/oder erträgt und nicht zuletzt dadurch, dass sie sich selbst und ihre eigenen Unzulänglichkeiten ertragen, den Normierungs- und Selbstanpassungsdruck, der auf der ganzen Gesellschaft lastet.
Und zwar sowohl im direkt anschaulichen Sinne als auch im abstrakt-normativen Sinne. Jede moderne, rationale Konkurrenzgesellschaft bringt - weil sie die "Normalität" als allgemeinen Maßstab benötigt - ganz automatisch auch das Nicht-Normale, das Nicht-Angepaßte, das Behinderte hervor. Würde dies - zum Beispiel durch die aktuell avisierten Fortschritte der Humangenetik - beseitigt, so würden zukünftig ganz neue, heute noch völlig "normale" Menschen an ihre Stelle treten, die dann als "unnormal" gelten würden.
Behinderte Menschen sind zudem der personifizierte Ausdruck all derjenigen Probleme und Lebensrisiken, die beispielsweise die moderne Medizin und die Ernährungsindustrie, das Mobilitärsdenken und das Militär zu lösen vorgeben. Deshalb tragen sie, allein durch ihre gesellschaftliche Anwesenheit, dazu bei, dass soziale Problemlagen und Konflikte als solche identifiziert und nicht biologisiert werden können.
Das Leben von und mit Behinderten birgt ein Potenzial in sich, das auf ganz spezielle Weise die Gesetze der Markt- und Konkurrenzgesellschaft zu unterlaufen in der Lage ist.
Es birgt - wie jeder bewusste Umgang mit existentiellen Lebessituationen (Krankheit, Geburt und Tod) - die Möglichkeit, einen ganz anderen Maßstab für den Umgang mit der eigenen Natur, wie auch mit der gesellschaftlichen und natürlichen Umwelt zu Tage zu fördern.
Weil es gezwungen ist, sich auf die eigenen (natürlich begrenzten) Ressourcen zu besinnen, vermag das Leben von und mit behinderten Menschen zugleich die eigenen Glücksversprechungen und Hoffnungen zu bewahren. In der simplen Erkenntnis, dass es geradezu kontraproduktiv ist, alles uns nur Mögliche (sofort) haben zu wollen und/oder (unverzüglich) tun zu müssen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Walter Grodes Text "Widerpart des Sozialdarwinismus"?
Der Text argumentiert, dass eine Gesellschaft, die auf sozialdarwinistischen Prinzipien basiert, behinderte Menschen systematisch produziert und benötigt, um sich selbst zu bestätigen. Im Gegensatz dazu benötigt eine menschliche Gesellschaft behinderte Menschen, da sie die Perspektive menschlicher Hilfsbereitschaft offenhalten.
Was ist Präimplantationsdiagnostik (PID) und wie wird sie in Deutschland wahrgenommen?
PID ist die gentechnische Untersuchung von Föten. In Deutschland befürworten 48% der Bevölkerung die PID, während 47% sie ablehnen. Die Zustimmung basiert vor allem auf der Angst vor Behinderung.
Welche Bedenken äußert der Autor bezüglich der PID und der Gentechnik?
Der Autor warnt davor, dass die Gentechnik dazu missbraucht werden könnte, falsche Maßstäbe vom "perfekten Menschen" zu verwirklichen. Er hinterfragt, was für eine Gesellschaft es ist, die Stärke, Schönheit und Reichtum über alles stellt und in der der aggressive Wettbewerb gefeiert wird.
Was ist die Rolle behinderter Menschen in der Gesellschaft laut dem Autor?
Behinderte Menschen sind das genaue Gegenteil des isolierten Einzelkämpfers, der von der "Gesellschaft der Stärke" propagiert wird. Sie benötigen Unterstützung, um ihre Qualitäten zu entfalten und üben eine positive Wirkung auf ein Gemeinwesen aus, das von humanitären und christlichen Werten geprägt ist. Sie sind ein Kristallisationskern für den Widerstand gegen den Sozialdarwinismus.
Wie tragen behinderte Menschen zur Minderung des Normierungsdrucks in der Gesellschaft bei?
Dadurch, dass behinderte Menschen gesellschaftlich getragen oder ertragen werden und dass sie sich selbst und ihre eigenen Unzulänglichkeiten ertragen, mindern sie den Normierungs- und Selbstanpassungsdruck, der auf der ganzen Gesellschaft lastet.
Warum sind behinderte Menschen wichtig für die Identifizierung sozialer Problemlagen?
Behinderte Menschen sind der personifizierte Ausdruck all derjenigen Probleme und Lebensrisiken, die beispielsweise die moderne Medizin und die Ernährungsindustrie, das Mobilitätsdenken und das Militär zu lösen vorgeben. Ihre Anwesenheit trägt dazu bei, dass soziale Problemlagen und Konflikte als solche identifiziert und nicht biologisiert werden können.
Welches Potenzial birgt das Leben von und mit Behinderten?
Das Leben von und mit Behinderten birgt das Potenzial, die Gesetze der Markt- und Konkurrenzgesellschaft zu unterlaufen und einen anderen Maßstab für den Umgang mit der eigenen Natur, sowie mit der gesellschaftlichen und natürlichen Umwelt zu fördern.
- Quote paper
- Dr. phil. Walter Grode (Author), 2001, Widerpart des Sozialdarwinismus - Eine menschliche Gesellschaft braucht die Behinderten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/110253