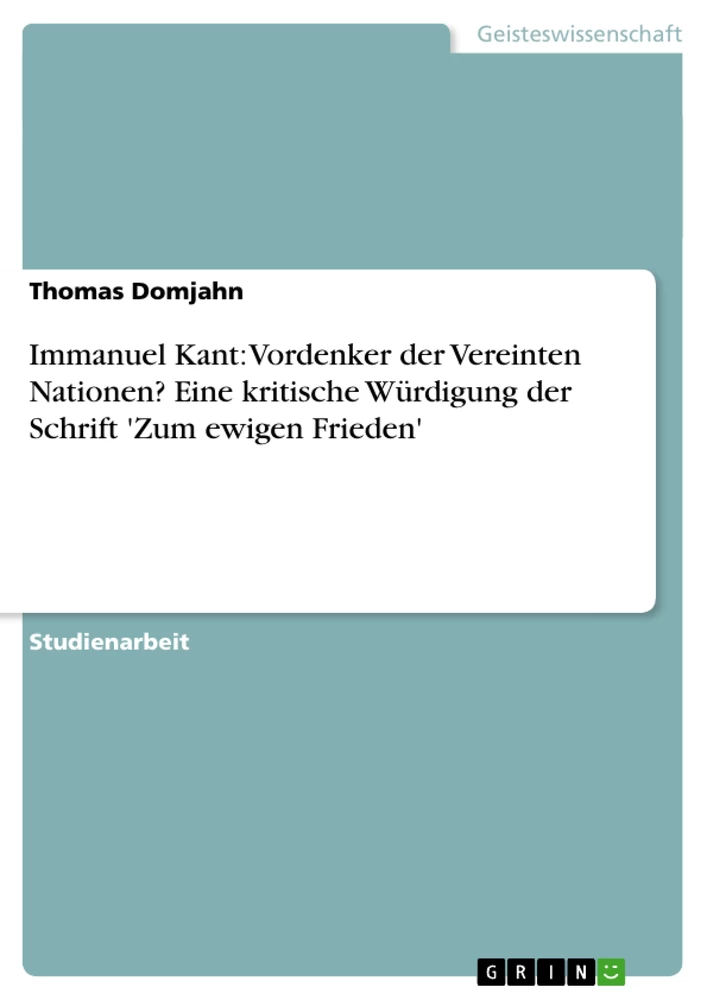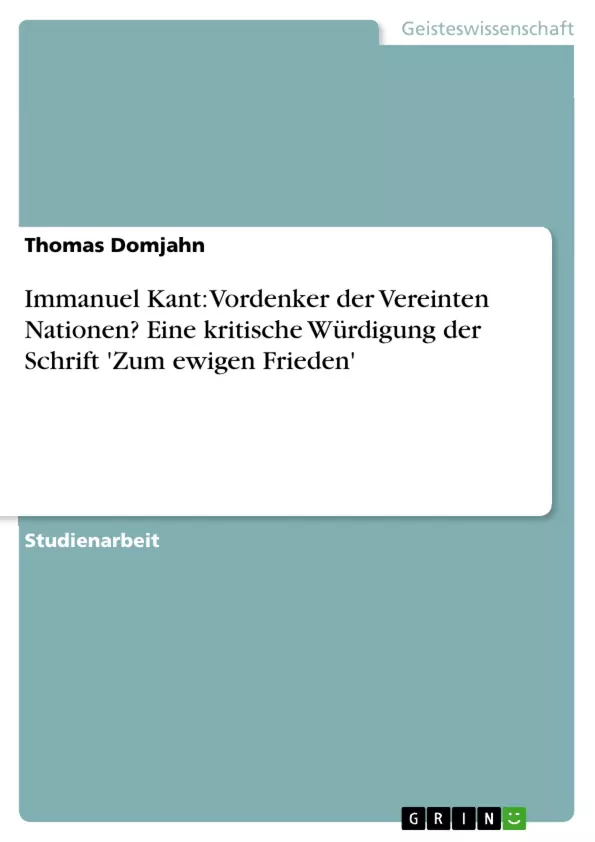Stellen Sie sich eine Welt vor, in der ewiger Frieden nicht länger eine Utopie ist, sondern ein erreichbares Ziel. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise durch das bahnbrechende Werk Immanuel Kants „Zum ewigen Frieden“ und seine überraschenden Parallelen zur Gründung und den Zielen der Vereinten Nationen. Entdecken Sie, wie Kants philosophische Ideen, die vor über zwei Jahrhunderten formuliert wurden, die Grundlage für die moderne internationale Friedenssicherung bilden. Die Leser werden mitgenommen auf eine Reise von Kants Präliminarartikeln, die die Vorbedingungen für den Frieden schaffen, bis hin zu den Definitivartikeln, die eine rechtliche Grundlage für eine friedliche Weltordnung legen. Das Buch untersucht detailliert, wie Kants Konzept einer Republik, eines Föderalismus freier Staaten und eines Weltbürgerrechts im Kontext der UNO Gestalt annimmt. Dabei werden sowohl die Übereinstimmungen als auch die kritischen Unterschiede zwischen Kants idealistischer Vision und der realen Politik der Vereinten Nationen herausgearbeitet. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse der UN-Charta, der Rolle des Sicherheitsrates und der Herausforderungen bei der Umsetzung von Kants Ideen in der heutigen komplexen Welt. Die Leser erhalten wertvolle Einblicke in die Debatten um Souveränität, Intervention und die Notwendigkeit einer globalen Zusammenarbeit. Dieses Buch ist nicht nur eine fundierte Analyse von Kants Werk und der UNO, sondern auch ein inspirierender Aufruf zu einer aktiven Friedenspolitik. Es zeigt auf, wie Kants zeitlose Ideen uns helfen können, die drängenden Probleme unserer Zeit zu verstehen und zu lösen, von Kriegen und Konflikten bis hin zu Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Es bietet eine neue Perspektive auf die Rolle der UNO als zentrale Institution für die Gestaltung einer friedlicheren und gerechteren Welt und regt zum Nachdenken über die zukünftige Ausrichtung der internationalen Beziehungen an. Schlüsselwörter: Immanuel Kant, Ewiger Frieden, Vereinte Nationen, UNO, Völkerrecht, Friedenssicherung, Internationale Beziehungen, Republik, Föderalismus, Weltbürgerrecht, Souveränität, Intervention, UN-Charta, Sicherheitsrat, Friedenstheorie, Politische Philosophie, Globalisierung, Krieg, Konfliktlösung, Menschenrechte, Gerechtigkeit, Weltordnung. Dieses Buch ist unerlässlich für alle, die sich für Philosophie, Politikwissenschaft, internationale Beziehungen und die Zukunft des Friedens interessieren.
1. Einleitung
2. Kants Idee einer globalen Friedensordnung
2.1 Die Vorbedingungen des Friedens
2.1.1 Die strengen Verbotsgesetze
2.1.2 Die weiten Verbotsgesetze
2.2 Die Verrechtlichung des Friedens
2.2.1 Erster Definitivartikel
2.2.2 Zweiter Definitivartikel
2.2.3 Dritter Definitivartikel
3. Die Vereinten Nationen und Kants Friedensschrift
3.1 Die UNO als erste globale Friedensinstitution
3.1.1 Entstehungsgeschichte
3.1.2 Ziele und Grundsätze
3.1.3 Organisation
3.2 Die UNO-Politik im Lichte Kants
4. Fazit
1. Einleitung
„Wir, die Völker der Vereinten Nationen – fest entschlossen, künftige Geschlechter von der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit […] erneut zu bekräftigen […] und für diese Zwecke […] unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren […] – haben beschlossen, in unserem Bemühen um die Erreichung dieser Ziele zusammenzuwirken.“[1]
Mit diesen Worten beginnt die Charta der Vereinten Nationen (United Nations Organisation, UNO), die im Jahre 1945 von damals 51 Staaten zum Zweck der globalen Friedenssicherung gegründet wurden. Genau 150 Jahre zuvor, im Jahre 1795, hatte der Philosoph Immanuel Kant (1724-1804) seine Schrift „Zum ewigen Frieden“ veröffentlicht, in der er die Idee einer institutionellen Friedenssicherung ausarbeitete. In der vorliegenden Arbeit soll die ideelle Verbindung dieses philosophischen Entwurfs zur politischen Realisierung durch die Gründung der UNO untersucht werden.
Freilich ist Kant nicht gerade durch seine politische Philosophie berühmt geworden. Die Friedensschrift blieb sein einziges systematisches Werk auf diesem Gebiet. Vielmehr ist Kant für seine Erkenntnistheorie, Moralphilosophie und Ästhetik, die er in seinen drei Kritiken (Kritik der reinen Vernunft (1781), Kritik der praktischen Vernunft (1788), Kritik der Urteilskraft (1790)) entwickelte, bekannt und geschätzt. Doch gerade heute, im 200. Todesjahr des Philosophen aus Königsberg, gelangt insbesondere seine Abhandlung „Zum ewigen Frieden“ aufgrund ihrer Aktualität wieder in den Fokus der Diskussion.
Das Attraktive an seiner Argumentation ist ihre Universalität, das heißt Kants Argumente sind an keine bestimmte historische Situation oder geographische Konstellation gebunden, sondern gelten allgemein und global. Durch diese Universalität überwindet Kant die Versuche seiner Vorgänger, die ihre Friedensideen in erster Linie für ein Europa in einer bestimmten Zeit konzipierten. Darüber hinaus ist Kants Entwurf keine Friedensutopie, wie sie etwa Erasmus von Rotterdam (1466-1536) in seinem Werk „Querela pacis“ (1517) entwickelte, sondern eine realistische und zu realisierende Aufgabe für die Menschheit. Schließlich nimmt Kant den Menschen so wie er anthropologisch ist, nicht wie er moralphilosophisch sein soll, wodurch sich Kant von - vielleicht zu optimistischen - Friedensentwürfen, wie z. B. der Schrift „De la Paix Perpetuelle“ (1769) von François Voltaire (1694-1778), unterscheidet.[2]
Beeinflusst wurde Kant insbesondere von Jean Jacques Rousseau (1712-1778) und Abbé de Saint-Pierre (1658-1743). So argumentierte Kant schon 1784 in seiner „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ in Anlehnung an diese beiden Theoretiker für einen Völkerbund.
„So schwärmerisch diese Idee auch zu sein scheint, und als solche von einem Abbé von St. Pierre oder Rousseau verlacht worden (vielleicht, weil sie solche in der Ausführung zu Nahe glaubten): so ist es doch der unvermeidliche Ausgang der Not, worein sich Menschen einander versetzen, die die Staaten zu eben dieser Entschließung (so schwer es ihnen auch eingeht) zwingen muss, wozu der wilde Mensch eben so ungern gezwungen ward, nämlich: seine brutale Freiheit aufzugeben, und in einer gesetzmäßigen Verfassung Ruhe und Ordnung zu suchen.“[3]
Als äußerer Anlass der Friedensschrift gilt der im März 1795 geschlossene Friedensvertrag von Basel zwischen Preußen und Frankreich, den Kant allerdings an keiner Stelle explizit erwähnt.
In dieser Arbeit sollen weniger die hier kurz dargestellten historischen Aspekte, sondern vielmehr die systematische Bedeutung der Friedensschrift im Vordergrund stehen. Zu diesem Zweck soll zunächst der für die im Titel formulierte Fragestellung, ob Kant als Vordenker der UNO bezeichnet werden kann, relevante Teil der Friedensschrift dargestellt und interpretiert werden (Abschnitt 2). Auf dieser Analyse aufbauend werden dann nach einer Darstellung der Geschichte, der Grundsätze sowie der Organisation der Vereinten Nationen (3.1) die Kantischen Ideen mit der Realisierung durch die UNO abgeglichen (3.2). Im Fazit (4.) sollen die Ergebnisse noch mal zusammengefasst und abschließend beurteilt werden.
Sowohl bei der Darstellung der Kantischen Gedanken, wie auch bei der Untersuchung der UNO soll nicht jede Einzelheit beleuchtet werden. Vielmehr geht es darum, den ideengeschichtlichen roten Faden von Kant zur UNO aufzuzeigen. In diesem Sinne möchte sich der Autor dieser Arbeit die Kritik Rousseaus an früheren Friedensforschern, deren Theorien sich zu sehr im Detail verhedderten und die den Wald vor lauter Bäumen nicht sahen, zu Herzen nehmen und sich auf die wesentlichen Aspekte beschränken. Nach Rousseau haben nämlich seine Vorgänger sich zu sehr auf nebensächliche Probleme konzentriert, wie z. B. ob im Tagungsort der Staatenversammlung
„der Tisch rund oder eckig sein soll, ob der Saal mehr oder weniger Türen haben soll, ob dieser Bevollmächtigte dem Fenster den Rücken oder das Gesicht zuwenden soll oder ob jener bei einem Besuche zwei Zoll des Weges mehr oder weniger zurücklegen soll, und über tausend Fragen von gleicher Wichtigkeit.“[4]
2. Kants Idee einer globalen Friedensordnung
Kants Schrift ist im Stil eines Friedensvertrages aufgebaut: Die Präliminarartikel (Erster Abschnitt) stellen die Vorbedingungen des Friedens dar, auf denen die Verrechtlichung des Friedens durch die Definitivartikel (Zweiter Abschnitt) basiert. Es folgen zwei Zusätze und ein Anhang, welche allerdings in der vorliegenden Arbeit nicht explizit thematisiert werden, da sie sich nicht direkt mit der rechtsphilosophischen Idee des ewigen Friedens auseinandersetzen. Vielmehr gilt es im Folgenden die ersten beiden Abschnitte genauer zu beleuchten, denn dort wird im Wesentlichen Kants Idee einer globalen Friedensordnung entworfen.
2.1 Die Vorbedingungen des Friedens
Im ersten Abschnitt stellt Kant in negativer Formulierung sechs Präliminarartikel auf, die kurze und prägnante normative Forderungen an die Politik sowie ihre Begründung enthalten. Die Präliminarartikel sind argumentativ nur lose verbunden, werden aber von Kant nachträglich in strenge Verbotsgesetze, „die sofort auf Abschaffung dringen“[5] und weite Verbotsgesetze, welche die „Erlaubnis enthalten, die Vollführung aufzuschieben, […] damit sie nicht übereilt und so der Absicht selbst zuwider geschehe […]“[6], differenziert.[7] An dieser Systematik soll auch bei der folgenden Darstellung der einzelnen Präliminarartikel festgehalten werden.
2.1.1 Die strengen Verbotsgesetze
Der erste Präliminarartikel fordert einen fairen und unbedingten Friedensschluss, der keinerlei Gründe oder Vorwände für einen Nachfolgekrieg enthalten darf.
„Es soll kein Friedensschluss für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden.“[8]
Andernfalls sei der Friede nur provisorisch, „ein bloßer Waffenstillstand“[9] und würde dem im Titel der Schrift angekündigten Ziel, dem ewigen Frieden, widersprechen. Schon begriffsanalytisch sei klar, dass ein Frieden, auf den ein Krieg folgt, kein Frieden im eigentlichen Sinne sein kann. Vielmehr sei der Ausdruck „ewiger Frieden“ ein „verdächtiger Pleonasm“[10], da es einen nicht-ewigen Frieden aus sprachlogischen Gründen nicht geben könne.[11] Der erste Präliminarartikel ist in der Literatur unumstritten und findet sich auch bei anderen Autoren aus Kants Zeit, z. B. bei Johann Gottfried Herder.
„Herder betont, dass Friedenschlüsse nicht `mit Hinterlist zweideutig abgefasst` werden dürfen. Man bringe nämlich `Pulverfässer unter Häuser, die man bewohnet`.“[12]
Eine ähnliche Argumentationsstruktur hat Kants sechster Präliminarartikel: Er fordert, gewisse Grundsätze auch während eines Krieges einzuhalten, um das für einen Friedensschluss notwendige Vertrauen nicht zu zerstören.
„Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen: als da sind, Anstellung der Meuchelmörder […], Giftmischer […], Brechung der Kapitulation, Anstiftung des Verrats […] in dem bekriegten Staat etc.“[13]
Werden diese Maximen verletzt, drohe die Gefahr eines Ausrottungskrieges, der dazu führe, dass der ewige Friede „nur auf dem großen Kirchhofe der Menschengattung stattfinden würde. Ein solcher Krieg also, mithin auch der Gebrauch der Mittel, die dahin führen, muss schlechterdings unerlaubt sein.“[14] Einige dieser Überlegungen Kants finden sich im Haager Abkommen von 1907, einem Versuch, auf der Basis des Völkerrechts die Kriege zu humanisieren, so das Verbot der Verwendung von Giftstoffen oder der meuchlerischen Tötung (Artikel 23a und b). Gerade im atomaren Zeitalter scheint es notwendig zu sein, den Waffengebrauch einzuschränken, um die Zivilbevölkerung und unbeteiligte Staaten möglichst nicht zu gefährden.[15] Unterstützung erfährt Kants Argument auch von Friedrich Schiller, der wie viele Intellektuelle seiner Zeit Kants Friedenschrift gelesen hatte. „Offenbar im Anschluss an und im Geiste Kants spricht Friedrich Schiller vom Versuch, beim Feind `Vertrauen zu erwecken´, als dem einzigen `Weg zum Frieden`.“[16] „Denn hört der Krieg im Kriege nicht schon auf, woher soll Friede kommen?“[17]
Der fünfte Präliminarartikel wird gerade im 21. Jahrhundert angesichts des Irak-Krieges von Kriegsgegnern gern zitiert.[18] Er verbietet gewaltsame Interventionen in die Innenpolitik anderer Staaten.
„Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewalttätig einmischen.“[19]
Kants Begründung ist kurz und knapp: „Denn was kann ihn dazu berechtigen? Etwa das Skandal, was er den Untertanen eines andern Staats gibt?“[20] Innenpolitische Entscheidungen, die zu Ungerechtigkeiten innerhalb eines Staates führen, können zwar als abschreckendes Beispiel dienen, seien aber kein hinreichender Grund für einen gewaltsamen Eingriff von außen. Ein rein verbaler Eingriff wird allerdings nicht verboten. Kant wendet sich ausschließlich gegen gewaltsame Einmischungen. Kritik, etwa durch öffentliche Resolutionen, bleibt weiterhin erlaubt. „Das Verbot der Intervention ist kein Gebot der Zustimmung sondern der Duldung.“[21] Auch ökonomische Sanktionen, wie sie heutzutage ausgeführt werden, schließt der Artikel nicht explizit aus. Trotzdem wird er häufig als zu restriktiv kritisiert. So bezeichnet ihn der Jurist und Philosoph Reinhard Merkel als „unangemessene Verabsolutierung des Souveränitätsdogmas“[22]. In der Tat scheint es in der heutigen Welt, in der 83% aller Kriege innerstaatliche Konflikte darstellen[23], unmöglich zu sein, einen globalen Schutz der Menschenrechte mit dem fünften Präliminarartikel zu vereinbaren. Kants Argument mag für seine Zeit zutreffen, muss aber für das moderne Zeitalter modifiziert werden. Wie die UNO das Interventionsproblem in Theorie und Praxis handhabt, soll im dritten Abschnitt dieser Arbeit untersucht werden.
2.1.2 Die weiten Verbotsgesetze
Der zweite, dritte und vierte Präliminarartikel sind weite Verbotsgesetze. Das heißt die normativen Forderungen sollen nicht sofort, von einem auf den anderen Tag, erfüllt werden. Vielmehr müssen die Präliminarartikel durch einen allmählichen, aber kontinuierlichen Reformprozess umgesetzt werden. Der Versuch, eine rasche Umsetzung durch eine Revolution zu erzwingen würde letztlich kontraproduktiv wirken, wie es Kant mit einem Zitat seines Schülers Friedrich Bouterwek verdeutlicht. „Biegt man das Rohr zu stark, so bricht´s; und wer zu viel will, der will nichts.“[24]
Der zweite Präliminarartikel soll ähnlich wie der fünfte die Souveränität und Autonomie eines Staates schützen.
„Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von einem anderen Staate durch Erbung, Tausch oder Schenkung erworben werden können.“[25]
Ein Staat sei nämlich kein Objekt des Eigentums, sondern „eine Gesellschaft von Menschen, über die niemand anders als er selbst, zu gebieten hat, […] eine moralische[..] Person.“[26] Hier wendet sich Kant direkt gegen die imperialistischen Aktivitäten der damaligen europäischen Großmächte.
Der zweite Präliminarartikel gehört zu den weiten Verbotsgesetzen, weil er nicht verlangt, alle unrechtmäßig erworbenen Staaten sofort in die Freiheit zu entlassen. Vielmehr ist es erforderlich die Bevormundungen ursprünglich autonomer Staaten Schritt für Schritt abzubauen, um diese nicht zu überfordern. Auf die Entkolonialisierungspolitik der UNO wird noch im dritten Abschnitt dieser Arbeit eingegangen werden.
Zum Schluss des Kommentars zum zweiten Präliminarartikel thematisiert Kant den seinerzeit weit verbreiteten Soldatenhandel. Die Zwangsrekrutierung von Einwohnern fremder Staaten sowie der Verkauf eigener Untertanen sei unmoralisch, „denn die Untertanen werden dabei als nach Belieben zu handhabende Sachen gebraucht und verbraucht.“ Hier bleibt Kant konsequent seiner Moralphilosophie treu. Die Argumentation ergibt sich aus der Mittel-Zweck-Formel des kategorischen Imperativs:
„Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.“[27]
Dieses Argument weitet Kant in der Erläuterung zum dritten Präliminarartikel auf alle Soldaten in stehenden Heeren aus, da
„[…] zum Töten, oder getötet werden in Sold genommen zu sein einen Gebrauch von Menschen als bloße Maschinen und Werkzeuge in der Hand eines andern […] zu enthalten scheint, der sich nicht wohl mit dem Rechte der Menschheit in unserer Person vereinigen lässt.“[28]
Weil zudem stehende Heere ein globales Hoch- und Wettrüsten provozieren, sollen sie nach und nach ganz abgebaut werden, wie es der dritte Präliminarartikel fordert. „Stehende Heere […] sollen mit der Zeit ganz aufhören.“[29] Mit dieser Forderung und ihrer Begründung ist Kant wahrscheinlich der erste Theoretiker, der gegen die grenzenlose Dynamik der Aufrüstung und für ein allmähliches Abrüsten plädiert.[30]
Das Argument ist außerdem auch eine implizite Kritik an der Militärpolitik des damaligen Preußens, welches seinerzeit ein stehendes Heer von 80.000 Soldaten bei einer Bevölkerung von 2,2 Millionen hatte, was prozentual umgerechnet einem Berufsheer von über 3 Millionen (!) Soldaten in der heutigen Bundesrepublik entspräche. Durch die hohe Militarisierung der Gesellschaft mussten in Friedenszeiten 70-80%, in Kriegszeiten über 90% der Staatseinnahmen für die Finanzierung der Armee ausgegeben werden.[31] Statt eines stehenden Heeres plädiert Kant für eine Milizarmee „mit der freiwilligen periodisch vorgenommenen Übung der Staatsbürger in Waffen.“[32]
Die globale Abrüstung ist ein wichtiger Bestandteil der UNO-Friedenspolitik. So fordert Artikel 26 der UN-Charta, „dass von den menschlichen und wirtschaftlichen Hilfsquellen der Welt möglichst wenig für Rüstungszwecke abgezweigt wird.“[33] Mehr als ein Viertel aller UN-Resolutionen widmen sich diesem Thema.[34]
Der fünfte Präliminarartikel versucht, der globalen militärischen Aufrüstung einen Riegel vorzuschieben, indem er Staatsschulden zu Rüstungszwecken verbietet. „Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden.“[35] Zwar ist es den Staaten erlaubt, für zivile Zwecke, zum Beispiel zur Verbesserung der Infrastruktur, Kredite aufzunehmen. Aber durch schuldenfinanzierte Aufrüstung entstehe eine
„gefährliche Geldmacht, nämlich ein Schatz zum Kriegsführen […]. Diese Leichtigkeit Krieg zu führen, mit der Neigung der Machthabenden dazu, welche der menschlichen Natur eingeartet zu sein scheint, verbunden, ist also ein großes Hindernis des ewigen Friedens […].“[36]
Aus heutiger Sicht erscheint der fünfte Präliminarartikel angesichts der globalen Verschuldung sowohl der Industriestaaten, als auch der Entwicklungsländer als utopisch. So einleuchtend das Argument auch theoretisch sein mag, in der politischen Praxis spielt es keine Rolle. „Wir sind inzwischen an das Schuldenmachen der Staaten so gewöhnt, dass wir uns von einer solchen Einschränkung nicht mehr viel versprechen werden.“[37]
2.2 Die Verrechtlichung des Friedens
Der Friedenszustand ist für Kant kein natürlicher Zustand, sondern muss durch Rechtsstaatlichkeit „gestiftet“[38] werden. In Anlehnung an Hobbes Naturzustandskonzeption herrscht nach Kant im rechtsfreien Raum ein Krieg „aller gegen alle“ (bellum omnium contra omnes), der nicht notwendigerweise durch akute Gewalttaten, sondern durch die potentielle Bedrohung durch die Mitmenschen gekennzeichnet ist. „Denn der Krieg dauert ja nicht etwa nur so lange wie faktische Feindseligkeiten, sondern so lange wie der Vorsatz herrscht, Gewalt mit Gewalt zu vergelten.“[39] Im Gegensatz zu Hobbes definiert Kant den Friedenszustand aber nicht als „Zeit […], in der kein Krieg herrscht“[40], sondern erweitert den Friedensbegriff durch das Adjektiv „ewig“, um die Notwendigkeit der Dauerhaftigkeit des Friedens zu betonen. Zum zweiten geht es Kant nicht nur um den innerstaatlichen Frieden, sondern um einen allumfassenden globalen Frieden.
Auf diesem Weg stellen die vorgestellten Präliminarartikel einen Zwischenschritt dar, indem sie einen „Vorfrieden“[41] sichern. Um zum ewigen Frieden zu gelangen, ist es in einem zweiten Schritt notwendig, rechtliche Grundsätze aufzustellen, welche die Anreizstrukturen so modifizieren, dass sich kriegerische Handlungen dauerhaft nicht lohnen. Diese Aufgabe erfüllen die Definitivartikel, die im Folgenden einzeln vorgestellt werden.
2.2.1 Erster Definitivartikel
„Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein.“[42]
Der erste Definitivartikel betrifft die Rechtsstruktur innerhalb eines Staates, das so genannte Staatsbürgerrecht. Kant fordert die Einrichtung einer republikanischen Verfassung, die durch folgende Merkmale charakterisiert wird. Erstens muss eine Republik auf den Prinzipien der rechtlichen Freiheit und Gleichheit basieren. Rechtliche Freiheit definiert Kant als „Befugnis, keinen äußeren Gesetzen zu gehorchen, als zu denen ich meine Bestimmung habe geben können.“[43] Rechtliche Gleichheit ist „dasjenige Verhältnis der Staatsbürger, nach welchem keiner den andern wozu rechtlich verbinden kann, ohne dass er sich zugleich dem Gesetz unterwirft, von diesem auf dieselbe Art auch verbunden werden zu können.“[44] Zweitens hat eine Gewaltentrennung zwischen der Exekutive und der Legislative zu erfolgen. Drittens ist das Oberhaupt nicht Staatseigentümer, sondern „oberster Diener des Staats“[45], wie es der preußische Kaiser Friedrich II. formulierte. Die Regierung muss also repräsentativ sein.
Für den Vertragstheoretiker Kant ist nur die republikanische Verfassung mit der Idee des Urvertrags kompatibel. Dieser Vertrag ist ein Gedankenexperiment zur Legitimation des Staates. In der liberalen Tradition, zu der auch Kant gezählt werden kann, geht man davon aus, dass sich die Individuen im Naturzustand vereinigt haben, um einen Staat zu gründen. Durch die fiktive Unterzeichnung eines Vertrags erwerben die Individuen staatsbürgerliche Rechte (z. B. bei Locke auf „life, liberty, property“), verpflichten sich aber andererseits, den Gesetzen zu gehorchen.
Neben diesem Vorteil „aus dem reinen Quell des Rechtsbegriffs entsprungen zu sein“[46], weist Kant der republikanischen Verfassung eine friedensfördernde Wirkung zu. Kants Prämisse ist, dass die „Drangsale des Krieges [...] als da wären: selbst zu fechten; die Kosten des Krieges aus ihrer eigenen Habe herzugeben; die Verwüstung, die er hinter sich läßt, kümmerlich zu verbessern; zum Übermaße des Übels endlich noch eine, den Frieden selbst verbitternde, nie (wegen naher immer neuer Kriege) zu tilgende Schuldenlast selbst zu übernehmen,“[47] von dem Bürgern getragen werden müssen. Dagegen können absolut herrschende Fürsten die Kosten des Krieges aufs Volk überwälzen und haben somit keinen Anreiz unnötige Kriege zu vermeiden. Im Gegenteil, für sie stellt der Krieg sogar eine „Art von Lustpartie“[48] oder einen „Sport der Könige“[49] dar.
In einer Republik hingegen erfordert ein Krieg die Zustimmung der Bürger, die aufgrund der hohen Kosten zumindest Angriffskriegen tendenziell ablehnend gegenüberstehen. Durch die republikanische Organisation des Staates verliert die Außenpolitik also ihren aggressiven Charakter. Das selbe Argument findet sich im Übrigen schon bei Charles-Louis Montesquieu und später bei Friedrich Schlegel.
„Der Geist der Monarchie ist auf Krieg und Eroberung gerichtet, der Geist der Republik auf Friede und Maßhalten.“[50]
„Der universelle und vollkommene Republikanismus und der ewige Friede sind unzertrennliche Wechselbegriffe.“[51]
Das Kantische Argument, in der Literatur als Republikanismustheorem bezeichnet, ist nicht unumstritten. Zum einen kann die republikanische Organisation des Staates nur Angriffskriege abwehren. Verteidigungskriege und unter Umständen auch Präventivkriege liegen durchaus im Interesse des Volkes und würden somit jederzeit die Zustimmung bekommen. Wenn jedoch alle Staaten der Welt Republiken wären, würde dieses Gegenargument wegfallen. Wichtiger ist das empirische Argument, dass Republiken in der Geschichte nicht signifikant weniger Kriege als andere Staaten geführt haben. Als Beispiel wird oft auf das nachrevolutionäre Frankreich verwiesen. Allerdings ist es so, dass Republiken untereinander kaum Kriege geführt haben. Also ist auch hier das Argument, dass eine globale Republikanisierung den Frieden befördern würde, nicht widerlegt.[52] Schließlich behauptet Cavallar, dass in einer wohlhabenden Gesellschaft mit einer Berufsarmee die Kriegskosten von den Bürger kaum verspürt würden.[53] Aber selbst wenn der Krieg auf fremden Territorium stattfindet, und nur ein Bruchteil der Bevölkerung aktiv am Krieg beteiligt ist (Beispiel: der aktuelle Irak-Krieg aus der Sicht der U.S.A.), muss die breite Masse die Armee über Steuererhöhungen finanzieren oder der Staat sich verschulden, was Kosten für zukünftige Generationen verursacht. Somit werden Kriegskosten langfristig immer vom Volk verspürt, zumindest monetär (Beispiel: U.S.A.), oftmals aber auch physisch (Beispiel: irakische Bevölkerung).
Das Republikanismustheorem lässt sich auch noch um das Moment der Publizität erweitern. Es ist zu erwarten, dass eine Kultur der Meinungsfreiheit einen besseren Nährboden für Lernprozesse und Aufklärung bietet und so zu einer friedlicheren Einstellung beiträgt. Zudem sind die Entscheidungsprozesse in einer Republik schwerfälliger. Durch Diskussionen und Abstimmungen könnte eine kriegerische Stimmung eher abgeschwächt und kritisch hinterfragt werden.[54] Dadurch ist in einer Republik die Umsetzung einer Politik der kleinen Schritte nach dem Vorbild des Popperschen „piecemeal social engineering“ eher möglich, so dass auf außenpolitische Abenteuer zu Gunsten eines vorsichtigen Reformprozesses verzichtet werden kann.
Kant schließt die Ausführungen zum ersten Definitivartikel mit einer Abgrenzung der republikanischen Verfassung von der demokratischen. Nach Kant gibt es analog zur aristotelischen Klassifizierung drei Regierungs formen. Entweder es herrscht einer (Autokratie) oder es herrschen einige (Aristokratie) oder es herrschen alle (Demokratie). Diese können je nach Regierungs art republikanisch oder despotisch geführt werden, so dass es sechs denkbare Kombinationen gibt. Unter Despotismus versteht Kant die Bündelung der legislativen und exekutiven Gewalt in einer Person oder Regierung, die dadurch nur ihren eigenen Gesetzen unterworfen ist, also de facto machen kann was sie will. In diesem Sinne ist eine Demokratie immer despotisch, „weil sie eine exekutive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls auch wider Einen (der also nicht mit einstimmt), mithin alle, die doch nicht alle sind, beschließen“[55]. Dadurch, dass in einer Demokratie die Mehrheit sowohl die exekutive als auch legislative Gewalt hat, ist das demokratische Prinzip und der Republikanismus unvereinbar. Diese auf den ersten Blick verwirrende Differenzierung kann teilweise mit Zensureinflüssen erklärt werden. So schreibt Kant in seinen unveröffentlichten Vorarbeiten: „Das repräsentative System der Demokratie ist das der Gleichheit der Gesellschaft oder die Republik.“[56] Es ist somit wohl nicht übers Ziel hinausgeschossen, Kants ideale Republik in moderner Terminologie als parlamentarische Demokratie oder als liberalen Verfassungsstaat zu bezeichnen. Kants Demokratiekritik richtet sich in erster Linie gegen die direkte Demokratie.[57]
Interessant ist Kants Hinweis, dass die Regierungsart wichtiger ist, als die Regierungsform. Dadurch wird es selbst in einer Monarchie wie etwa im damaligen Preußen möglich, „durch allmähliche Reformen“[58] republikanische Prinzipien einzuführen. Kants Ziel ist nicht die Abschaffung des monarchischen Systems, sondern dessen Erneuerung durch eine republikanische Reformpolitik.
2.2.2 Zweiter Definitivartikel
„Das Völkerrecht soll auf einen Föderalism freier Staaten gegründet sein.[59]
Der zweite Definitivartikel betrifft das Völkerrecht, also die Rechtsbeziehungen zwischen Staaten. Er fordert die Einrichtung eines föderalen Völkerbundes. Die Mitgliedsstaaten sollen „frei“ sein, was sich sowohl auf die Innen- als auch auf die Außenpolitik bezieht: Innenpolitisch sollen sie durch eine republikanische Verfassung die Freiheit der Individuen institutionell garantieren (vgl. Erster Definitivartikel); außenpolitisch sollen die Staaten ihre Souveränität, also das Recht auf politische und kulturelle Selbstbestimmung, behalten.[60]
Kant eröffnet seine Argumentation mit der Übertragung des Naturzustandsmodells von der individuellen auf die zwischenstaatliche Ebene. Somit erweitert er das Hobbes’sche Modell um eine neue Dimension.
„Völker, als Staaten, können wie einzelne Menschen beurteilt werden, die sich in ihrem Naturzustand (d. i. in der Unabhängigkeit von äußern Gesetzen) schon durch ihr Nebeneinandersein lädieren, und deren jeder, um seiner Sicherheit willen, von dem andern fordern kann und soll, mit ihm in eine, der bürgerlichen ähnliche, Verfassung zu treten, wo jedem sein Recht gesichert werden kann.“[61]
Diesen Zusammenschluss nennt Kant Völker bund, der sich allerdings nicht notwendigerweise durch ein Verschmelzen der Mitglieder zum Völker staat entwickeln muss.
Kants Analyse des damaligen Status Quo zeigt, dass die Länder von diesem Ideal noch weit entfernt waren. Vielmehr sei es das Ziel der Regierungen gewesen, mit einer starken Armee auf eigene Faust eine nationale Außenpolitik machen zu können. Dieses Verhalten vergleicht Kant mit dem von Menschen aus unzivilisierten Kulturen, die „sich lieber unaufhörlich [...] balgen, als sich einem gesetzlichen, von ihnen selbst zu konstituierenden, Zwange unterwerfen, mithin die tolle Freiheit der vernünftigen vor[...]ziehen.“[62] Vom moralischen Standpunkt aus betrachtet seien die „gesitteten Völker“ den „Wilden“ in diesem Aspekt nicht überlegen.
Durch dieses kriegerische Verhalten zeige sich die „Bösartigkeit der menschlichen Natur [...] unverhohlen.“[63] Trotzdem bestehe Hoffnung auf eine „ob zwar zur Zeit schlummernde, moralische Anlage im Menschen“[64], da die Staaten ein internationales Recht nicht prinzipiell ablehnen, sondern im Gegenteil versuchen, sich – teilweise sogar mit Bezug auf Philosophen wie Hugo Grotius, Samuel Pufendorf oder Emer de Vattel, die Kant als „leidige Tröster“[65] bezeichnet - moralisch und rechtlich für ihre Politik zu rechtfertigen.
Streitigkeiten zwischen Ländern können aber nie auf kriegerische Weise gelöst werden, da durch den Sieg einer Partei zwar der akute Krieg beendet, aber dadurch noch kein Recht geschaffen wird, so dass die Gefahr eines erneuten Kriegsausbruchs bestehen bleibt. Nur durch die Etablierung einer neutralen überstaatlichen Institution lässt sich dieser Kriegszustand überwinden.
„[I]ndessen daß doch die Vernunft vom Throne der höchsten moralischen gesetzgebenden Gewalt herab, den Krieg als Rechtsgang schlechterdings verdammt den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, welcher doch, ohne einen Vertrag der Völker unter sich, nicht gestiftet oder gesichert werden kann: - so muß es einen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund [...] nennen kann, der vom Friedensvertrag [...] darin unterschieden sein würde, daß dieser bloß auf einen Krieg, jener aber alle Kriege auf immer zu endigen suchte.“[66]
Dieser Friedensbund ist mehr als ein Gleichgewicht der Mächte, aber weniger als ein Weltstaat. Ein bloßer Gleichgewichtszustand ohne rechtliche Schranken ist nach Kant zu instabil, um den ewigen Frieden zu garantieren.
„[D]enn ein dauernder allgemeiner Friede, durch die so genannte Balance der Mächte in Europa ist, wie Swifts Haus, welches von einem Baumeister so vollkommen nach allen Gesetzen des Gleichgewichts erbauet war, daß, als sich ein Sperling drauf setzte, es so fort einfiel, ein bloßes Hirngespinst.“[67]
Ein Weltstaat, von Kant als „Universalmonarchie“ bezeichnet, wäre unregierbar, „weil die Gesetze mit dem vergrößerten Umfange der Regierung immer mehr an ihrem Nachdruck einbüßen, und ein seelenloser Despotism, nachdem er die Keime des Guten ausgerottet hat, zuletzt doch in Anarchie zerfällt.“[68] Zudem müssten die Einzelstaaten ihre Souveränität aufgeben, was kein Staat freiwillig tun würde. Der Beitritt zum Völkerbund beruht aber auf freiwilliger Basis, so dass die Idee eines Weltstaats sich weder theoretisch noch praktisch umsetzen lässt.[69]
Kants Lösung ist ein Nachtwächterstaat, der sich nicht in innerstaatliche Entscheidungen der Primärstaaten einmischt, sondern sich ausschließlich auf die zwischenstaatliche Streitschlichtung konzentriert. Diesem Staatenbund weist Kant ausschließlich sicherheitspolitische Aufgaben zu, jegliche machtpolitischen Motive schließt Kant aus. Der Völkerbund ist als Sekundärstaat nur mit minimalen Kompetenzen gegenüber den Primärstaaten ausgestattet. Nicht einmal eine gemeinsame Währungs- oder Verteidigungspolitik liegt in seinem Aufgabenbereich. Somit hat der Völkerbund zwar Rechts- aber keinen Staatscharakter.[70]
Den Völkerbund charakterisiert Kant als „das negative Surrogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden, und sich immer ausbreitenden Bundes, [der] den Strom der rechtsscheuen, feindseligen Neigung aufhalten [kann], doch mit beständiger Gefahr ihres Ausbruchs [...].“[71] Somit kann die Kriegsgefahr selbst durch den Völkerbund nicht dauerhaft („ewig“) beseitigt werden. Trotzdem bleibt die Annäherung an das Ideal des ewigen Friedens eine moralische Pflicht.[72]
„Empirische Beweisgründe wider das Gelingen dieser auf Hoffnung genommenen Entschließungen richten hier nichts aus. Denn: daß dasjenige, was bisher noch nicht gelungen ist, darum auch nie gelingen werde, berechtigt nicht einmal, eine pragmatische oder technische Absicht (wie z. B. die der Luftfahrten mit aerostatischen Bällen) aufzugeben: noch weniger aber eine moralische, welche, wenn ihre Bewirkung nur nicht demonstrativ-unmöglich ist, Pflicht wird.“[73]
2.2.3 Dritter Definitivartikel
„Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein.“[74]
Der dritte und letzte Definitivartikel befasst sich mit dem Weltbürgerrecht, also mit der Rechtsbeziehung von Individuen zu fremden Staaten. Kant weist den Individuen das Recht auf Hospitalität zu, welches er folgendermaßen definiert.
„[D]a bedeutet Hospitalität (Wirtbarkeit) das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines anders wegen, von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann; so lange er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich begegnen.“[75]
Da das Individuum zwar das Recht hat, einen fremden Staat zu besuchen, sich aber nicht ohne weiteres dort niederlassen darf, ist die Hospitalität ein „Besuchsrecht“, aber kein „Gastrecht“. Dieses Recht begründet Kant mit dem Hinweis, dass das Recht auf eine bestimmte Fläche nicht natürlich sei. Vielmehr habe die Welt ursprünglich allen Menschen zu gleichen Teilen gehört.
„[V]ermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der, als Kugelfläche, sie [die Menschen] sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch neben einander dulden müssen, ursprünglich aber niemand an einem Orte der Erde zu sein mehr Recht hat, als der andere.“[76]
Aus dem Besuchsrecht darf allerdings kein Eroberungsrecht werden, auch nicht wenn eine Region von einem Volk bewohnt wird, welches keine Staatsstruktur im strengen Sinn hat. „Die Annäherung zu den nomadischen Stämmen als ein Recht anzusehen, sie zu plündern, ist also dem Naturrecht zuwider.“[77] Kant wendet sich direkt gegen den Imperialismus und Kolonialismus seiner Zeit. „[S]o geht die Ungerechtigkeit, die sie [die Kolonialmächte Europas] in dem Besuche fremder Länder und Völker [...] beweisen, bis zum Erschrecken weit.“[78] Als konkrete Beispiele unfairer Kolonialpolitik nennt Kant u. a. die Besiedlung Amerikas und Afrikas. Die Verurteilung dieser Straftaten auf Basis eines Weltbürgerrechts ist nach Kant in einer eng verzahnten Welt unerlässlich. Das folgende Zitat scheint in erhöhtem Maße auch für das moderne Zeitalter der Globalisierung zu gelten.
„Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex, sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt, und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der kontinuierlichen Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf.“[79]
Besonders im dritten Definitivartikel macht Kant somit seinem Ruf als „dezidierter Weltphilosoph“[80] alle Ehre. Jeglicher Nationalismus oder Eurozentrismus ist ihm fremd. Vielmehr ist seine politische Philosophie eine konsequente Umsetzung seiner universalistischen Moralphilosophie.
„Kant fundiert seinen Kosmopolitismus letztlich moralphilosophisch im kategorischen Imperativ, der fordert, man solle `die Menschheit` sowohl in der eigenen Person als auch in der eines jeden anderen nie bloß als Mittel zum Zweck gebrauchen […]. Dieses formale Kriterium schließt jede national, rassisch, religiös oder ideologisch motivierte Verengung aus, etwa in dem Sinn, daß man den `Wilden` die Qualität abspricht, Menschen oder Rechtssubjekte zu sein.“[81]
3. Die Vereinten Nationen und Kants Friedensschrift
3.1 Die UNO als erste globale Friedensinstitution
Die UNO kann als erste globale Friedensinstitution bezeichnet werden, da sie - im Gegensatz zu ihrem Vorläufer, dem so genannten Völkerbund - dem Prinzip der Universalität gerecht wird: Bis auf den Vatikanstaat, den kleinsten Staat der Welt, sind alle Nationen in der UNO, die somit 191 Mitglieder umfasst, vertreten.[82]
3.1.1 Entstehungsgeschichte
[83] Wie bereits angedeutet, ist die UNO nicht der erste Versuch, den zwischenstaatlichen Frieden durch eine weltumspannende Organisation zu befördern. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg, im Jahre 1919, wurde der Völkerbund (englisch: League of Nations; französisch Société des Nations) gegründet[84]. Dieser hatte 43 ursprüngliche Mitglieder und das Ziel „die Zusammenarbeit unter den Nationen und die Gewährleistung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit“[85] zu fördern. Allerdings krankte der Völkerbund daran, dass es ihm nicht gelang, die militärisch, politisch und ökonomisch wichtigsten Staaten einzubinden. So traten die Vereinigten Staaten von Amerika nie dem Völkerbund bei, obwohl seine Gründungsinitiative vom damaligen amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson (1856-1924), Mitglied der demokratischen Partei, ausging. Der Beitritt scheiterte im US-Kongress an den Gegenstimmen der Republikaner. Deutschland trat dem Völkerbund erst 1926 bei und kündigte 1933 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ebenso wie Japan die Mitgliedschaft. Die Sowjetunion trat 1934 ein, wurde aber 1939 wegen ihres Angriffs auf Finnland ausgeschlossen. Zudem war der Völkerbund zu sehr auf die europäischen Länder fixiert. Staaten anderer Kontinente konnten nicht hinreichend integriert werden, so dass der Völkerbund nie mehr als 57 Mitglieder gleichzeitig hatte.
Auch inhaltliche Fehler sind im Nachhinein zu konstatieren. So enthielt die Satzung des Völkerbundes kein generelles, sondern nur ein partielles Kriegsverbot, nämlich die Verpflichtung, bei einem zwischenstaatlichen Konflikt sich einem Streitverfahren zu unterwerfen. Blieb dieses „cooling-off-Verfahren“[86] erfolglos, hatten die Konfliktparteien nach einer Frist von drei Monaten das Recht, zum Kriege zu schreiten. Problematisch war zudem, dass nur Gewaltanwendungen, die im Rahmen eines Krieges ausgeübt wurden, unter dieses Verbot fielen. Dadurch wurde erstens eine präventive Politik zu Kriegsverhinderung erschwert; zweitens gestaltete sich die Abgrenzung von legitimer und kriegerischer Gewalt als schwierig.
Die Geschichte zeigte, dass die Konstruktion des Völkerbundes einen weiteren Weltkrieg nicht verhindern konnte, weshalb er am 18.4.1946 aufgelöst wurde. Doch trotz seiner Erfolglosigkeit leitete der Völkerbund einen Paradigmenwechsel in der internationalen Politik ein, von dem seine Nachfolgeorganisation, die UNO, profitieren konnte.
Aufbauend auf der Einsicht, dass der Weltfrieden nur institutionell und nicht durch ein bloßes Gleichgewicht der Mächte gesichert werden muss, versuchten die Architekten der UNO aus den strukturellen und inhaltlichen Fehlern des Völkerbundes zu lernen, ohne jedoch die Normen, welche ihm zugrunde gelegen hatten, grundsätzlich in Frage zu stellen. Als Initiatoren der UNO gelten Franklin Roosevelt (1882-1945), amerikanischer Präsident von 1933-1945, und der britische Premierminister Winston Churchill (1874-1965). Roosevelt verwendete den Begriff ´Vereinte Nationen´, der ab 1942 offizieller Name für das Kriegsbündnis der Alliierten (USA, UdSSR, Großbritannien, China und 22 weitere Staaten) gegen die Achsenmächte (Deutschland, Italien und Japan) wurde, das erste Mal in einem Briefwechsel mit seinem britischen Amtskollegen. Unter der Leitung der USA, der UdSSR und Großbritanniens arbeiteten diese Vereinten Nationen ab 1943 auf verschiedenen Konferenzen Pläne für eine globale Nachkriegsfriedensordnung aus. Die endgültige Satzung (Charta der Vereinten Nationen) wurde am 12.04.1945, also noch vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, von 51 Staaten einstimmig angenommen und trat am 24.10.1945 in Kraft.
Im Gegensatz zum Völkerbund waren somit die beiden Großmächte Nordamerika und die Sowjetunion von Anfang an fester Bestandteil der UNO. In einem kontinuierlichen Prozess wurden weitere Mitglieder aufgenommen, so dass sich die Mitgliederzahl der UNO innerhalb von 15 Jahren fast verdoppelte. Auch die Verliererstaaten des Zweiten Weltkriegs Italien (1955), Japan (1956) und Deutschland (1973) traten nach und nach ein. Durch den Beitritt zahlreicher Entwicklungsländer, teilweise ehemalige Kolonien, während der 60er und 70er Jahre sowie vieler Staaten aus dem Ostblock Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre konnte die UNO ihrem Anspruch, eine weltumspannende Organisation zu sein, gerecht werden.
Trotz der Krisen während des Kalten Krieges, Finanzproblemen, dem Nord-Süd-Konflikt zwischen den Industriestaaten und der so genannten Dritten Welt, um nur einige Probleme zu nennen, erwies sich die UNO als stabile Organisation, die nicht mehr aus der internationalen Politik wegzudenken ist.
„Angesichts […] , dass in den etwa 200 größeren zwischenstaatlichen Kriegen und Bürgerkriegen, Befreiungskriegen, Revolutionen und Konterrevolutionen, Staatsstreichen, Guerilla- und Konterguerillaaktionen seit 1945 unterschiedlichen Schätzungen zufolge zwischen 15 und 32 Millionen Menschen ihr Leben ließen […] mag die Behauptung als ausgesprochen paradox erscheinen, dass die Entwicklung der internationalen Beziehungen langfristig von einer spezifischen Tendenz gekennzeichnet wird: Nämlich der der Einhegung und Verrechtlichung des Krieges, der Zivilisierung militärischer Gewaltanwendung und der Wandlung des Friedens von einem labilen Zustand ruhender Gewalttätigkeit zu einem historischen Prozess, in dem sich Formen der internationalen Konfliktbearbeitung durchsetzen, die sich zunehmend von der Anwendung organisierter militärischer Gewalt befreien“[87]
3.1.2 Ziele und Grundsätze
[88] Die Ziele und Grundsätze der UNO finden sich im Wesentlichen in Kapitel eins der Charta. Diese 1945 verfasste Satzung der Vereinten Nationen hat Verfassungscharakter, ist aber keine Verfassung im engeren juristischen Sinn. Ihre Gültigkeit ist zeitlich unbegrenzt; Änderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Generalversammlung, in der alle UNO-Mitglieder vertreten sind. Die Charta besteht aus einer Präambel und 19 Kapiteln mit 111 Artikeln. Im Vergleich zur Satzung des Völkerbundes, die nur aus 26 Artikeln bestand, ist sie somit sehr ausführlich.
Auch inhaltlich setzt sich die UNO entscheidend vom Völkerbund ab, indem sie auf einen weit gefassten Friedensbegriff baut. Der Friedensbegriff der UNO, der in der Charta 52 Mal verwendet wird, schließt nicht nur die Verhinderung von Kriegen ein, sondern impliziert auch den Schutz der Menschenwürde und Menschenrechte sowie die Vision einer globalen sozialen Gerechtigkeit. Für die UNO ist die Friedenswahrung nach wie vor das Hauptziel, allerdings darf dieses Ziel nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss mit anderen Politikfeldern verknüpft werden, wie Edward Stettinius, der damalige Außenminister der USA, 1945 nach der Unterzeichnung der Charta betonte:
„Der Kampf für den Frieden muss an zwei Fronten geführt werden. An der einen Front geht es um Sicherheit und an der anderen um Ökonomie und soziale Gerechtigkeit. Nur ein Sieg an beiden Fronten wird der Welt einen dauerhaften Frieden bescheren“[89]
Aus diesem Grund nennt Artikel eins der Charta außer dem Ziel, den „Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen“ noch drei weitere Maßnahmen, die nicht direkt auf die Verhinderung von Kriegen zielen, sondern den Frieden indirekt befördern sollen: Zum einen die Entwicklung „freundschaftliche[r] […] Beziehungen“ zwischen den Ländern, zum anderen die Herbeiführung einer „internationalen Zusammenarbeit“ und schließlich die Funktion der UNO als Forum für globale Diskussionen.
Artikel zwei der Charta nennt sieben Grundsätze der Vereinten Nationen. Zentral ist insbesondere das generelle Gewaltverbot, das „jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt“ verbietet. Hervorzuheben ist auch der „Grundsatz der souveränen Gleichheit aller […] Mitglieder.“[90] Umstritten ist der siebte Grundsatz, welcher besagt, dass die UNO kein Recht habe, sich in innenpolitische Angelegenheiten einzumischen. Hier stellt sich die Frage, ob die UNO bei systematischen Menschenrechtsverletzungen innerhalb eines Landes das Recht zu einer so genannten humanitären Intervention habe und wo die Grenzlinie zu ziehen ist. In der Praxis ist leider festzustellen, dass diese Grenzlinie oftmals nach nationalen Interessen der Entscheidungsträger und nicht nach kodifizierten völkerrechtlichen Grundsätzen entschieden wird.[91]
„Die rechtliche Einordnung der Ziele und Grundsätze ist in mehrfacher Hinsicht unklar. Erstens ist der Grad der Verbindlichkeit bzw. die Folgen bei Verstößen nicht präzise beschrieben, zweitens ist eine Prioritätensetzung hinsichtlich der Ziele aus der Charta nicht direkt ableitbar und drittens ist die Kompetenzzuweisung an einzelne Organe und damit die Zuständigkeitsregelung interpretationsfähig. So ist die flexible Formulierung Chance und Gefahr zugleich.“[92]
Obwohl das Aufgabenspektrum der UNO sich in den letzten Jahrzehnten erweitert hat, etwa durch die globale Aufgabe des Umweltschutzes, der in der Charta von 1945 noch nicht erwähnt ist, wurden in der fast 60-jährigen Geschichte der Vereinten Nationen keine Änderungen im Katalog der Ziele und Grundsätze vorgenommen, was u. a. auch mit der oben erwähnten hohen parlamentarischen Hürde zusammenhängt.
3.1.3 Organisation
Im Folgenden sollen die wichtigsten Hauptorgane der Vereinten Nationen in groben Zügen dargestellt werden, ohne auf die zahlreichen Sonder- und Nebenorgane sowie die verschiedenen Spezialorganisationen, wie beispielsweise den Internationalen Währungsfonds (IWF) oder die Weltbankgruppe, einzugehen.
[93] Das zentrale UN-Organ ist die Generalversammlung (General Assembly), in der alle 191 Mitgliedsstaaten vertreten sind. Hier gilt der Gleichheitsgrundsatz „one state – one vote“, das heißt die Stimme Lichtensteins (32.000 Einwohner) zählt genau so viel wie die Chinas (ca. 1,3 Mrd. Einwohner). Die Generalversammlung wird in der Presse oft als „Weltparlament“ bezeichnet, was nicht ganz richtig ist, da sie keine verbindlichen Gesetze (hard law) verabschieden, sondern nur Empfehlungen (soft law) abgeben kann[94]. Obwohl die Missachtung dieser Empfehlungen nicht völkerrechtswidrig ist, sollte man den moralischen Druck, der von den Deklarationen der Generalversammlung ausgeht, nicht unterschätzen. So ist die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“, die 1948 von der Generalversammlung beschlossen wurde, bis heute das meistübersetzte internationale Dokument. Auch in der Berichterstattung der Medien nehmen die Stellungnahmen der Generalversammlung einen festen Platz ein.
Die „Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens“ (Art 24. der Charta) trägt der Sicherheitsrat (Security Council), welcher aus 15 Mitgliedsstaaten besteht, die durch je einen Repräsentanten vertreten werden. Fünf dieser Mitgliedsstaaten (USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, China) sind ständige Mitglieder, die restlichen zehn werden alle zwei Jahre ausgetauscht. Die ständigen Mitglieder haben ein Veto-Recht, was während des Kalten Krieges für eine Lähmung des Sicherheitsrats sorgte, weil sich die USA und die damalige Sowjetunion aus ideologischen Gründen gegenseitig blockierten. Seit Mitte der 80er Jahre hat der Sicherheitsrat durch die Kooperation der beiden Großmächte wieder seine Handlungsfähigkeit zurückerlangt. Trotzdem ist das Vetorecht nach wie vor umstritten, da es viele Länder für eine „doppelte Privilegierung“[95] der ständigen Mitglieder halten, die dem oben erwähnten Gleichheitsgrundsatz widerspreche. Aus diesem Grund fordern viele Nationen, darunter Deutschland, das als drittgrößter Beitragszahler keinen ständigen Sitz im Sicherheitsrat hat, eine Reform des Sicherheitsrats. „Die Mehrheit der VN-Staaten hält die Zusammensetzung und die Privilegien der fünf ständigen Mitglieder für undemokratisch und angesichts der weltpolitischen Realitäten des neuen Jahrtausends auch für anachronistisch.“[96] Weil der Sicherheitsrat im Gegensatz zur Generalversammlung für die betroffenen Länder verbindliche Entscheidungen treffen kann, ist er das machtpolitisch wichtigste UN-Organ. So kann der Sicherheitsrat bei Nichtbefolgung seiner Anordnungen wirtschaftliche oder militärische Sanktionen verhängen.
Das Sekretariat, bestehend aus dem Generalsekretär und ca. 8.900 Bediensteten aus 170 Mitgliedsstaaten, ist das Hauptverwaltungsorgan der UN. Der Generalsekretär erfüllt neben seiner Funktion als oberster Verwaltungsbeamter auch eine politische Funktion als „Moderator […] der internationalen Politik.“[97] Gewählt wird er von der Generalversammlung auf Vorschlag des Sicherheitsrats für eine Amtszeit von fünf Jahren. Seit 1997 steht Kofi Annan aus Ghana an der Spitze des Sekretariats; seine Amtzeit wurde vorzeitig bis 2006 verlängert. Für seine engagierte Amtsführung bekam der erste Schwarzafrikaner auf diesem Posten 2001 den Friedensnobelpreis.
3.2 Die UNO-Politik im Lichte Kant s
Nachdem nun Kants philosophische Friedensidee und die politische Friedensinstitution der Vereinten Nationen vorgestellt wurden, sollen in diesem Abschnitt die beiden Themenkomplexe miteinander verbunden und abgeglichen werden. Leitfrage ist die im Titel dieser Arbeit vorgestellte Frage, ob und inwiefern Kant als Vordenker der Vereinten Nationen bezeichnet werden kann. Dabei wird es nicht um die empirische Frage gehen, ob die Initiatoren der Vereinten Nationen oder des Völkerbundes Kants Friedensschrift tatsächlich gelesen haben. Vielmehr wird untersucht, wo sich kantisches Gedankengut in der UN-Charta und der praktischen Politik der UNO wieder findet. Darüber hinaus sollen auch die Differenzen herausgearbeitet und diskutiert werden.
Bei diesem Vergleich muss beachtet werden, dass Kants Friedensschrift keine Charta, sondern ein „philosophischer Entwurf“ ist, wie ihr Untertitel andeutet. Kant gibt allgemeine normative Grundsätze vor, überlässt aber die praktische Umsetzung den Politikern, Juristen und Politologen. Aus diesem Grund scheint es sinnvoll zu sein, ausgehend von Kants Präliminarartikeln zunächst die Umsetzung in zwei konkreten Politikfeldern, nämlich dem Souveränitätsschutz für Staaten und der Entkolonialisierungspolitik, zu untersuchen, um dann in einem zweiten Schritt anhand der Definitivartikel grundsätzliche Überlegungen zu Kants Friedensschrift und den Vereinten Nationen zu entwickeln.
Kants fünfter Präliminarartikel verbietet die gewaltsame Intervention in souveräne Staaten (vgl. Abschnitt 2.1.1). Dieses Verbot findet sich in der Charta wieder und war über einen langen Zeitraum unumstritten. In der Praxis hat sich allerdings die UNO seit Beginn der 1990er Jahre von diesem Grundsatz entfernt, da mehr und mehr kriegerische Konflikte innerhalb eines Landes und nicht mehr zwischen verschiedenen Staaten geführt werden. So können u. a. die UN-Einsätze im Irak (1991) und im Kosovo (1999) als Einmischung in innere Angelegenheiten bezeichnet werden. Begründet werden diese Missionen durch das Argument, dass die Menschenrechtsverletzungen, die in den genannten Ländern begangen wurden kein nationales, sondern ein globales Problem seien, die den Weltfrieden gefährden.
Bei einer anderen Leseart des fünften Präliminaratikels lassen sich auch solche Einsätze legitimieren. So kann argumentiert werden, dass sich Kants Interventionsverbot nur auf die zwischenstaatliche Ebene beziehe, ohne eine Intervention der Völkergemeinschaft zu verbieten.[98] Zum anderen, und dieses Argument erscheint einleuchtender, befänden sich Länder, in denen Menschenrechtsverletzungen und Anarchie vorherrscht, im Naturzustand, so dass sie nicht als souveräne Staaten, auf die sich das Verbot bezieht, gelten.[99] Das Verbot darf allerdings nicht soweit aufgeweicht werden, dass es nur noch Republiken vor Interventionen schützen soll, wie es der Frankfurter Philosoph Friedrich Kambartel fordert.[100] Das Recht, einen Krieg zu führen, um einen unliebsamen Diktator zu stürzen, ohne dass eine konkrete Bedrohung von ihm ausgeht, würde zur Beliebigkeit führen. U. a. aus diesem Grund verweigerte der Sicherheitsrat 2003 der USA die Legitimation eines militärischen Eingriffs im Irak, was Amerika allerdings nicht hinderte sich über diesen Beschluss hinwegzusetzen.
Kants zweiter Präliminarartikel und dritter Definitivartikel kritisieren den europäischen Kolonialismus, der zu seiner Zeit bis zum ersten Weltkrieg weit verbreitet war. Neben dem Verbot die „territoriale Unversehrtheit“ eines Staates zu verletzen (Artikel 2), was einem Verbot des Kolonialismus gleichkommt, findet sich in der UN-Charta die Forderung, die „Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung“ zu fördern (Artikel 73). Die Kolonialmächte werden verpflichtet in ihren Kolonien, „als heiligen Auftrag […] die Selbstregierung zu entwickeln, die politischen Bestrebungen dieser Völker gebührend zu berücksichtigen und sie bei der fortschreitenden Entwicklung ihrer freien politischen Einrichtungen zu unterstützen […].[101] Diese Chartabestimmung bildete die Grundlage für die Entkolonialisierungspolitik der UN. Die Umwandlung der Kolonien in souveräne Staaten ab 1945 geschah in einem allmählichen, aber kontinuierlichen Reformprozess, um Kants Terminologie zu benutzen. So wurden nach und nach u. a. Indien (1947), Indonesien (1949), Vietnam (1954), der Sudan (1956) und Ghana (1957) unabhängige Staaten.
Kants Forderung nach Republikanisierung und der Einrichtung eines Völkerbundes (erster und zweiter Definitivartikel) ist heute zumindest prinzipiell umgesetzt. Allerdings gibt es im Detail einige Differenzen, die es zu diskutieren gilt. So kritisiert Kambartel, dass auch Nichtrepubliken in die UNO aufgenommen wurden und dass diese genauso behandelt werden wie Republiken, was dem Geist der Friedensschrift widerspreche.[102] Er geht sogar so weit zu behaupten, dass deswegen „die Vereinten Nationen entgegen der üblichen Deutung keine völkerrechtliche Realisierung des Kantischen Entwurfs“[103] seien. Sein Vorschlag ist, dass Nichtrepubliken nur assoziierte UN-Mitglieder werden dürfen.
In der Tat ist die innere Verfassung eines Staates kein Kriterium für einen Beitritt zur UNO. „Mitglied der Vereinten Nationen können alle […] friedliebenden Staaten werden, welche die Verpflichtung aus dieser Charta übernehmen.“[104] Allerdings sagt Kant an keiner Stelle explizit, dass der Völkerbund nur aus Republiken bestehen dürfe und betont, dass auch Nichtrepubliken „eine dem Geiste eines repräsentativen Systems gemäße Regierungsart“[105] annehmen können. Eine friedliche Außenpolitik, wie sie die Charta als Bedingung für eine Mitgliedschaft fordert, scheint ein guter Indikator für einen republikanischen Geist zu sein. So lässt sich neben Kants These von der Friedliebigkeit der Republiken auch ein ähnliches Argument von Aristoteles anführen. „Aristoteles [..] formuliert eine interessante Umkehrung von Kants These: Wer fremde Staaten besiegen wolle, neige zur Tyrannis zu Hause […], eine Eroberungspolitik unterminiere also die Politik, die Demokratie bzw. Republik im eigenen Land.“[106]
Aber auch wenn in der Praxis eine Minderheit von UNO-Mitgliedern der Charta-Forderung nach Friedliebigkeit nicht nachkommt[107], also eine aggressive Außenpolitik betreibt, und auch im Inneren tatsächlich nicht republikanisch organisiert ist, scheint Kambartels Konklusion, die Negation der geistigen Verbindung von Kants Entwurf und der Entwicklung der UNO, zu weit zu gehen. Im Übrigen gibt es auch gute Gründe mit undemokratischen Regierungen zusammenzuarbeiten, um die Universalität der UNO zu gewährleisten. „[D]er zerbrechliche Friede zwischen den Staaten könnte einer gefährlichen Belastungsprobe ausgesetzt werden, wenn man die Unterscheidung von demokratisch-rechtsstaatlichen und undemokratischen im Völkerrecht berücksichtigen würde.“[108]
Berechtigt erscheint die Kritik vieler Wissenschaftler und Politiker an der fehlenden demokratischen Legitimation der UNO. Insbesondere der Sicherheitsrat entspricht nicht den republikanischen Prinzipien. „Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats gleichen mehr einer Versammlung erblicher Monarchen als republikanischen Vertretern.“[109] Zwar ist die asymmetrische Konstruktion des Sicherheitsrats vor dem Hintergrund der UNO-Gründungsgeschichte nachzuvollziehen, allerdings besteht angesichts der enormen Vergrößerung der UNO und den globalen Veränderungen seit 1945, etwa der Dekolonisation, auf diesem Gebiet Reformbedarf.
„Die Modernisierung des wichtigsten Hauptorgans der Vereinten Nationen stellt eine der größten Herausforderungen für die Weltorganisation und zugleich einen entscheidenden Test für die Reformfähigkeit überhaupt dar, weil in diesem Vorhaben alle Schwierigkeiten und Hindernisse der institutionellen Umgestaltung der Organisation wie in einem Brennglas gebündelt erscheinen.“[110]
Der Reformprozess, welcher im Wesentlichen darauf abzielt, die Anzahl der ständigen Mitglieder (je nach Reformentwurf mit oder ohne Vetorecht) möglichst fair zu erweitern, gestaltet sich aus zweierlei Gründen als schwierig. Zum einen wollen die „Permanent Five“ ungern ihre derzeitige Machtposition aufgeben. Zum anderen ist umstritten, welche Staaten ein Recht auf einen ständigen Sitz haben. Ginge es nach der Höhe der Beitragszahlungen, stünde Deutschland und Japan, die zusammen mit der USA über 55% des UN-Haushalts finanzieren, ein ständiger Sitz zu. Wäre die Bevölkerungsgröße das entscheidende Kriterium, wäre Indien mit fast einer Milliarde Einwohnern ein legitimer Kandidat. Geographisch gesehen hätten die bisher nicht vertretenen Kontinente Afrika und Lateinamerika das Recht, einen Vertreter in den Sicherheitsrat zu entsenden.
Kants Forderung nach einer globalen Friedensinstitution (Zweiter Definitivartikel) ist durch die Gründung der UNO prinzipiell umgesetzt worden. Allerdings gehen die Kompetenzen der UNO über das Kantische Ideal des Friedensbundes hinaus. Kant weist dem „Föderalism freier Staaten“ ausschließlich die Aufgabe der Friedenssicherung zu, während sich die UNO zusätzlich – im Gegensatz zum gescheitertem Völkerbund - auch um globale soziale und ökonomische Probleme sorgt.
„Er [Kant] fordert nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein moralisch definiertes Recht, das ist eine Gerechtigkeit, bezogen auf politische Institutionen und Organisationen; er verlangt politische Gerechtigkeit. […] Jede Mehranforderung, die man heute im Namen der sog. sozialen Gerechtigkeit oder der Solidarität erhebt, schließt Kant aus […]“[111]
Dagegen findet sich in der UN-Charta das Ziel, die „internationale Zusammenarbeit“ und den „wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt“ zu fördern. Gehen diese Kompetenzen zu weit, wie Höffe[112] behauptet? Wäre es besser sich von der Vision einer globalen sozialen Gerechtigkeit zu verabschieden und die Wohlfahrtsstaatlichkeit ausschließlich den Nationalstaaten zu überlassen?
In der Tat ist das weite Aufgabenspektrum der UNO mit dem Kantischen Modell eines minimalistischen Nachtwächterstaats nicht kompatibel. Allerdings gibt es gute Gründe in diesem einen Punkt Kants Konzeption zu erweitern, was sich mit einer Aussage von Kant selber begründen lässt. So stellt Kant im ersten Zusatz der Friedenschrift die These auf, dass internationale Wirtschaftsbeziehungen dem Frieden förderlich seien.
„Es ist der Handelsgeist, der mit dem Krieg nicht zusammen bestehen kann […]. Weil nämlich unter allen, der Staatsmacht untergeordneten, Mächten (Mitteln) die Geldmacht wohl die zuverlässigste sein möchte, so sehen sich die Staaten […] gedrungen, den edlen Frieden zu befördern, und, wo auch immer in der Welt Krieg auszubrechen droht, ihn durch Vermittlungen abzuwehren, gleich ob sie deshalb im beständigen Bündnisse ständen […].“[113]
Freilich ist die Kritik, dass tendenziell die Industriestaaten stärker vom globalen Handel profitieren als Entwicklungsländer nicht von der Hand zu weisen, aber wer soll diese globalen Ungleichheiten ausgleichen können, wenn nicht die UNO? Die institutionelle und rechtliche Etablierung gleicher Wettbewerbs-chancen sowie die entwicklungspolitische Unterstützung der unterentwickelten Volkswirtschaften sollte deswegen weiterhin in ihrem Aufgabenbereich verbleiben.[114]
Abschließend lässt sich sagen, dass sich die Kantische Friedensidee wie ein roter Faden durch die UN-Charta zieht, obwohl sich diese an keiner Stelle explizit auf Kant beruft. Auch wenn es - wie gezeigt wurde - Differenzen zur Praxis gibt, kann die UN-Charta als „juristische Ausformulierung Kantischer Gedanken“[115] bezeichnet werden. „Kants Friedensschrift bildet einen wesentlichen Teil der Theoriegeschichte von Völkerbund und Vereinten Nationen.“[116]
Bis auf die erwähnten Einschränkungen wurden die drei Definitivartikel prinzipiell umgesetzt. Die Präliminarartikel - ausgenommen der vierte (Verbot der Staatsschulden zur Finanzierung der Armee), welcher nicht gerade als zentralster Artikel bezeichnet werden kann – wurden zumindest institutionalisiert, wenn auch teilweise mit bescheidenem Erfolg in der Umsetzung, insbesondere beim Abbau stehender Heere (dritter Präliminarartikel). Trotzdem gibt es jährlich neue kriegerische Auseinandersetzungen. Aus diesem Grund plädieren Kritiker der Vereinten Nationen, die sich bislang ausschließlich auf die militärische Macht ihrer Mitgliedsstaaten stützen, für eine UN-eigene Streitmacht, um ihren Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen und um im Extremfall schneller und effektiver intervenieren zu können. Dieses Argument ist aus der Kantischen Perspektive abzulehnen. Vielmehr ist auf die konsequente und vollständige Umsetzung des dritten Präliminartikels zu setzen oder - bescheidener formuliert - zu hoffen.
„Wer davon [der Militarisierung der UNO] das Heil, den globalen Frieden, erwartet, übersieht aber die Gefahr, dass diese Macht allzu leicht missbraucht wird. Dagegen ist die Gefahr kaum zu fürchten, wenn die Kantischen Vorbedingungen erfüllt werden, namentlich der Dritte Präliminarartikel. Besser als die Einrichtung einer überlegenen militärischen Macht ist das Abschaffen dessen, was `stehende Heere` auf heute bezogen meinen. Aufzulösen sind die stets verfügbaren Waffen(systeme) für ein sofort einsetzbares Militär. Nicht von einer militärisch mächtigen Weltorganisation ist der globale Friede zu erwarten, sondern von einem radikalen Abrüsten.“[117]
4. Fazit
Wie gezeigt wurde gehört Kant zu den wichtigsten Vordenkern der Vereinten Nationen. Sein Verdienst besteht zum einen in der Entwicklung eines konsistenten philosophischen Friedensentwurfs. Zum anderen leitete seine Friedensschrift eine breite Friedensdiskussion in Deutschland und im Ausland ein (noch vor Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die deutsche Ausgabe ins Französische, Englische und Dänische übersetzt), an der sich allein während der Romantik 75 namhafte Autoren wie Fichte, Schlegel und Hegel sowie Jean Paul, Herder, Novalis und Hölderlin beteiligten.
Dass es 150 Jahre nach der Veröffentlichung der Friedensschrift zur Gründung der Vereinten Nationen kam, gibt Hoffnung, dass der ewige Frieden „keine leere Idee, sondern eine Aufgabe die, nach und nach aufgelöst, ihrem Ziele […] beständig näher kommt[..]“[118] ist, auch wenn es zur Realisierung der Vereinten Nationen und ihrem Vorgänger, dem Völkerbund, je eines Weltkrieges bedurfte.
Zwar ist das Ideal, ein globaler Frieden, der für alle Zeiten stabil bleibt, „eine unausführbare Idee“[119]. Aber eine Annäherung, sogar in größer werdenden Schritten, ist möglich. In diesem Sinn ist die Präposition „zum“ im Titel der Friedensschrift zu verstehen: Es soll ein Weg zum ewigen Frieden aufgezeigt werden, der das normative Ziel der internationalen Politik darstellt.[120]
Trotz der teilweise heftigen Kritik an der UNO steht außer Zweifel, dass diese Organisation ein Schritt in die richtige Richtung ist. Auch wenn die UNO in vielen Bereichen ihren Ansprüchen hinterherhinkt und zurecht eine Reform der Organisation gefordert wird, gibt es keine vernünftige politische Alternative zu den Vereinten Nationen.
Durch die Globalisierung werden nicht nur immer mehr Wirtschaftsgüter im- und exportiert, auch die zahlreichen globalen Bedrohungen machen keinen Halt mehr vor nationalen Grenzen.
„Die Gefährdung durch ökologische Ungleichgewichte, durch Asymmetrien des Wohlstands und der wirtschaftlichen Macht, durch Großtechnologien, durch Waffenhandel, insbesondere die Verbreitung von ABC-Waffen, durch Terrorismus, Drogenkriminalität usw. liegt auf der Hand. Wer nicht a fortiori an der Lernfähigkeit des internationalen Systems verzweifelt, muss seine Hoffnungen darauf setzen, dass die Globalisierung dieser Gefahren die Welt im ganzen längst objektiv zu einer unfreiwilligen Risikogemeinschaft zusammengeschlossen hat.“[121]
Deshalb ist „eine Art Weltinnenpolitik, die über den Horizont von Kirchtürmen, aber auch nationalen Grenzen weit hinausreicht“[122] notwendig, wie die so genannte Nord-Süd-Kommission unter dem Vorsitz des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt schon vor mehr als 20 Jahren feststellte. In eine ähnliche Kerbe schlug der aktuelle deutsche Außenminister Joschka Fischer auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahre 1999.
„Die Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung wird im internationalen Staatensystem von morgen allein der Multilateralismus geben. Unsere Welt wird immer plural sein, und deswegen wird jede Form von Unilateralismus auf Dauer nicht funktionieren können. Deshalb wird das 21. Jahrhundert mit seinen über sechs Milliarden Menschen und deren Staaten handlungsfähige Vereinte Nationen brauchen.“[123]
Scheitert das Projekt, einen einigermaßen stabilen Weltfrieden zu schaffen, impliziert dies ein Versagen der Politik auf der ganzen Linie.
„Jetzt ist die durch Macht und Größe der Menschheit relativ klein gewordene Erde das Terrain, auf dem sich gemeinsam nur leben lässt, wenn dies in Frieden geschieht. Der Frieden ist heute eine so elementare Bedingung der Politik geworden, dass diese als ganze scheitern könnte, wenn es ihr nicht gelingt, ihn zu sichern. Was jetzt dieser Bedingung widerspricht, ist nicht mehr einfach nur schlechte Politik, sondern ein Verbrechen.“[124]
Unter diesen Bedingungen scheint es vernünftig zu sein (auch) auf die „Maximen der Philosophen“[125] zu hören.
„Es spricht für die Qualität des Friedensdenkens von Kant, seine unveraltete Frische, dass seine Argumentation bis heute ihre Aktualität behalten hat. Daher bleibt ´Zum ewigen Frieden´ eine Grundschrift der Weltfriedensbewegung, und die Friedensbewegung tut gut daran, sie in ihren Köpfen stets mitzuführen.“[126]
Literaturverzeichnis
Beutin, Wolfgang (2004): Kants Projekt ´zum ewigen Frieden` -´ keine leere Idee, sondern eine Aufgabe ´, www.uni-kassel.de/fb10/frieden/themen/Theorie/beutin.html, herunter geladen am 01.11.04.
Bialas, Volker / Häßler, Hans-Jürgen (Hg.) (1996): 200 Jahre Kants Entwurf ´Zum ewigen Frieden`, Würzburg.
Brandt, Reinhard (1995a): Vom Weltbürgerrecht; in: Höffe (1995).
Brandt, Reinhard (1995b): Das Problem der Erlaubnisgesetze im Spätwerk Kants; in: Höffe (1995).
Cavallar, Georg (1992): Pax Kantiana: Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs „Zum ewigen Frieden“(1795) von Immanuel Kant, Wien.
Gareis, Sven / Varwick, Johannes (2003): Die Vereinten Nationen, Bonn.
Gerhardt, Volker (1996): Eine kritische Theorie der Politik; in Kodalle (1996).
Habermas, Jürgen (1996): Kants Idee des ewigen Friedens – aus dem historischen Abstand von zweihundert Jahren; in: Lutz-Bachmann/Bohmann (1996).
Hobbes, Thomas (1651): Leviathan, Stuttgart.
Höffe, Otfried (Hg.) (1995): Zum ewigen Frieden. Klassiker auslegen, Berlin.
Höffe, Otfried (1995a): Vorwort; in: Höffe (1995).
Höffe, Otfried (1995b): Der Friede - ein vernachlässigtes Ideal; in: Höffe (1995).
Höffe, Otfried (1995c): Völkerbund oder Weltrepublik?; in: Höffe (1995).
Höffe, Otfried (1995d): Ausblick: Die Vereinten Nationen im Lichte Kants; in: Höffe (1995).
Kambartel, Friedrich (1996): Kants Entwurf und das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Staatsangelegenheiten; in: Bachmann/Bohmann (1996).
Kant, Immanuel (1795): Zum ewigen Frieden; in: Weischedel, Wilhelm (1977).
Kant, Immanuel (1793): Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis; in: Weischedel, Wilhelm (1977).
Kant, Immanuel (1785): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Stuttgart.
Kant, Immanuel (1784): Idee zu einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht; in: Weischedel (1977).
Kyora, Stefan (1996): Kants Argumente für einen schwachen Völkerbund heute; in: Bialas/Häßler (1996).
Kersting, Wolfgang (1996): „Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein“; in: Höffe (1995).
Kodalle, Klaus-Michael (Hg.) (1996): Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, Würzburg.
Kodalle, Klaus-Michael (Hg.) (1996a): Die aktuelle Barbarei; in: Kodalle (1996).
Lutz-Bachmann, Matthias / Bohman, James (Hg.) (1996): Frieden durch Recht, Frankfurt am Main.
Merkel, Reinhard / Wittmann, Roland (Hg.) (1996): Zum ewigen Frieden. Grundlagen, Aktualität und Aussichten einer Idee von Immanuel Kant, Frankfurt am Main.
Merkel, Reinhard (1996): „Lauter Leidige Tröster“. Kants Friedensschrift und die Idee eines Völkerstrafgerichtshofs; in: Merkel / Wittmann (1996).
Patzig, Günther (1996): Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“; in: Merkel / Wittmann (1996).
Saner, Hans (1995): Die negativen Bedingungen des Friedens; in: Höffe (1995).
Unser, Günther (1997): Die UNO. Aufgaben und Strukturen der Vereinten Nationen, München.
Väryrynen, Kari (1996): Die Achtung der Natur bei Kant. Ethische und ästhetische Skizzen zum Frieden mit der Natur; in: Bialas/Häßler (1996).
Weischedel, Wilhelm (Hg.) (1977): Immanuel Kant. Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik 1, Frankfurt am Main.
Woyke, Wichard (2000): Handwörterbuch der internationalen Politik, Bonn.
[...]
[1] Charta der Vereinten Nationen (1945), zitiert nach Unser (1997), S. 359.
[2] Cavallar (1992),S. 253.
[3] Kant (1784), S. 42.
[4] Rousseau, zitiert nach Cavallar (1992), S. 222.
[5] Kant (1784), S. 42.
[6] Kant (1795), S. 201.
[7] Vgl. Brandt (1995a), S. 133ff.
[8] Kant (1795), S. 196.
[9] Kant (1795), S. 196.
[10] Kant (1795), S. 196.
[11] Vgl. Saner (1995), S. 50.
[12] Cavallar (1992), S. 105.
[13] Kant (1795), S. 200.
[14] Kant (1795), S. 200.
[15] Vgl. Cavallar (1992), 130f.
[16] Cavallar (1992), S. 130.
[17] Schiller (1800), zitiert nach Cavallar (1992), S. 128.
[18] Vgl. „Träumender Realismus“, FAZ vom 17.04.04.
[19] Kant (1795), S. 199.
[20] Kant (1795), S. 199.
[21] Saner (1995), S. 58.
[22] Merkel (1996), S. 323.
[23] Woyke (2000), S. 242.
[24] Bouterwek, zitiert nach Kant (1795), S. 225.
[25] Kant (1795), S. 196.
[26] Kant (1795), S. 197.
[27] Kant (1785), S. 79.
[28] Kant (1795), S. 197f.
[29] Kant (1795), S. 197.
[30] Vgl. Saner (1995), S. 62.
[31] Vgl. Saner (1995), S. 61. Heutzutage liegt der Anteil der Militärausgaben am globalen Sozialprodukt bei etwa zwei Prozent. Vgl. Gareis/Varwick (2003), S. 151.
[32] Kant (1795), S. 198.
[33] Charta der Vereinten Nationen (1945), zitiert nach Unser ( 1997), S. 366.
[34] Vgl. Unser (1997), S. 41f.
[35] Kant (1795), S. 198.
[36] Kant (1795), S. 198f.
[37] Patzig (1996), S. 18.
[38] Kant (1795), S. 203.
[39] Hobbes (1651), S. 115.
[40] Hobbes (1651), S. 115.
[41] Kersting (1995), S. 87.
[42] Kant ( 1795), S. 204.
[43] Kant (1795), S. 204.
[44] Kant (1795), S. 204.
[45] Friedrich II. zitiert nach Kant (1795), S. 207.
[46] Kant (1795), S. 205.
[47] Kant (1795), S. 205.
[48] Kant (1795), S. 206.
[49] Cavallar (1992), S. 136.
[50] Montesquieu (1748), zitiert nach Cavallar (1992), S. 157.
[51] Schlegel (1796), zitiert nach Cavallar (1992), S. 173.
[52] Vgl. Kersting (1995), S. 95ff. sowie Cavallar (1992), S. 173ff.
[53] Cavallar (1992), S. 161.
[54] Vgl. Kersting (1995), S. 98.
[55] Kant (1795), S. 207.
[56] Kant, zitiert nach Cavallar (1992), S. 19.
[57] Vgl. Cavallar (1992), S. 19ff.
[58] Kant (1795), S. 207.
[59] Kant (1795), S. 208.
[60] Vgl. Höffe (1995c), S. 113.
[61] Kant (1795), S. 208f.
[62] Kant (1795), S. 209.
[63] Kant (1795), S. 210.
[64] Kant (1795), S. 210.
[65] Kant (1795), S. 210.
[66] Kant ( 1795), S. 211.
[67] Kant (1793), S. 172.
[68] Kant (1795), S. 225.
[69] Vgl. Höffe (1995c), S. 115f.
[70] Vgl. Höffe (1995c), S. 115ff.
[71] Kant (1795), S 213.
[72] Vgl. Höffe (1995c), S. 123.
[73] Kant (1793), S. 168.
[74] Kant (1795), S. 213.
[75] Kant (1795), S. 213.
[76] Kant (1795), S. 214.
[77] Kant (1795), S. 214.
[78] Kant (1795), S. 214.
[79] Kant (1795), S. 216f.
[80] Brandt (1995b), S. 133.
[81] Cavallar (1992), S. 245.
[82] Taiwan und die Demokratische Arabische Republik Sahara sind ebenfalls keine UNO-Mitglieder, allerdings gelten die beiden Länder nicht als international anerkannte Staaten.
[83] Die folgenden Ausführung lehnen sich an Unser (1997), S. 6-24 sowie an Gareis/Varwick (2003), S. 99-104 an.
[84] Das deutsche Wort Völkerbund taucht im Übrigen zum ersten Mal bei Kant auf. Vgl. Unser (1997), S. 4.
[85] Satzung des Völkerbundes (1919), zitiert nach Unser (1997), S. 9.
[86] Gareis/Varwick (2003), S. 102.
[87] Woyke (2000), S. 241f.
[88] Die folgenden Ausführungen lehnen sich an Unser (1997), S. 25-35 sowie Gareis/Varwick (2003), S. 41-50 an.
[89] Stettinus (1945), zitiert nach Gareis/Varwick (2003), S. 241.
[90] Dieser Grundsatz bezieht sich auf die rechtliche Gleichheit. Dass die Staaten (macht-)politisch ungleich sind, zeigt Abschnitt 3.1.3.
[91] Vgl. Unser (1997), S. 33.
[92] Woyke (2000), S. 498.
[93] Die folgenden Ausführungen lehnen sich an Unser (1997), S. 36-143 sowie Gareis/Varwick (2003), S. 50-65 an.
[94] Eine Ausnahme bilden UN-interne Beschlüsse, etwa im Bereich des Haushalts.
[95] Gareis/Varwick (2003), S. 57.
[96] Woyke (2000), S. 501.
[97] Gareis/Varwick (2003), S. 63.
[98] Vgl. Kambartel (1996), S. 246.
[99] Vgl. Kyora (1996), S. 100f.
[100] Vgl. Kambartel (1996), S. 246ff.
[101] Charta der Vereinten Nationen (1945), zitiert nach Unser (1997), S. 376.
[102] Vgl. Kambartel (1996), S. 240ff.
[103] Kambartel (1996), S. 243.
[104] Charta der Vereinten Nationen (Artikel 4), zitiert nach Unser (1997), S. 361.
[105] Kant (1795), S. 207.
[106] Höffe (1995d), S. 248.
[107] Hier könnte man eventuell kritisieren, dass diese Länder nicht aus der Staatengemeinschaft ausgeschlossen werden. Einem UN-Staat wurde trotz kriegerischer Handlungen noch nie die Mitgliedschaft gekündigt.
[108] Kodalle (1996), S. 149.
[109] Väyrynen (1996), S. 168.
[110] Gareis/Varwick (2003), S. 299.
[111] Höffe (1995), S. 245f.
[112] Vgl. Höffe (1995d), S. 257ff.
[113] Kant (1795), S. 226.
[114] Vgl. Gareis/Varwick (2003), S. 261.
[115] Höffe (1995d), S. 250.
[116] Höffe (1995c), S. 114.
[117] Höffe (1995d), S. 256.
[118] Kant (1795), S. 251.
[119] Kant, zitiert nach Cavallar (1992), S. 215.
[120] Vgl. Cavallar (1992), S. 461.
[121] Habermas (1996), S. 24.
[122] Abschlussbericht der Nord-Süd-Kommission (1980), zitiert nach Gareis/Varwick (2003), S. 332.
[123] Fischer (1999), zitiert nach Gareis/Varwick (2003), S. 331.
[124] Gerhardt (1996), S. 19.
[125] Kant (1795), S. 227.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine umfassende Analyse der Friedensschrift "Zum ewigen Frieden" von Immanuel Kant und ihrer ideellen Verbindung zur politischen Realisierung durch die Gründung der Vereinten Nationen (UNO). Er untersucht, ob Kant als Vordenker der UNO bezeichnet werden kann.
Was sind die Präliminarartikel nach Kant?
Die Präliminarartikel sind Vorbedingungen für den Frieden, die Kant in sechs negativen Formulierungen aufstellt: fairer Friedensschluss ohne geheime Vorbehalte, Verbot des Staatenerwerbs durch Erbschaft, Tausch oder Schenkung, allmähliche Abschaffung stehender Heere, Verbot von Staatsschulden zu Rüstungszwecken, Verbot der gewaltsamen Einmischung in die Innenpolitik anderer Staaten und Einhaltung bestimmter Grundsätze auch während des Krieges.
Was sind Kants Definitivartikel?
Die Definitivartikel sind rechtliche Grundsätze, die den Frieden sichern sollen: republikanische Verfassung in jedem Staat, Völkerrecht auf der Grundlage eines Föderalismus freier Staaten und Beschränkung des Weltbürgerrechts auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität.
Was bedeutet Kants Forderung nach einer republikanischen Verfassung?
Kant fordert eine republikanische Verfassung, die auf rechtlicher Freiheit und Gleichheit basiert, eine Gewaltentrennung zwischen Exekutive und Legislative vorsieht und in der das Staatsoberhaupt als "oberster Diener des Staats" fungiert. Dies soll Angriffskriege unwahrscheinlicher machen, da die Bürger zustimmen müssen und die Kosten tragen.
Wie sieht Kants Ideal eines Völkerbundes aus?
Kant befürwortet einen Völkerbund, der mehr als ein bloßes Gleichgewicht der Mächte, aber weniger als ein Weltstaat ist. Es handelt sich um einen Staatenbund, der sich auf die zwischenstaatliche Streitschlichtung konzentriert und den Frieden sichert, ohne sich in die inneren Angelegenheiten der Mitgliedsstaaten einzumischen.
Was bedeutet das Weltbürgerrecht nach Kant?
Kant weist jedem Individuum das Recht auf Hospitalität zu, d.h. das Recht, in einem fremden Land nicht feindselig behandelt zu werden, solange es sich friedlich verhält. Dieses Besuchsrecht ist kein Gastrecht, sondern basiert auf dem gemeinschaftlichen Besitz der Erdoberfläche.
Inwiefern ist die UNO eine Umsetzung von Kants Ideen?
Die UNO wird als erste globale Friedensinstitution betrachtet, die dem Prinzip der Universalität entspricht. Sie teilt viele Ziele mit Kants Friedensschrift, insbesondere die Friedenssicherung durch Völkerrecht und internationale Zusammenarbeit. Die UNO versucht - anders als der Völkerbund - auch soziale und ökonomische Gerechtigkeit zu fördern.
Welche Kritikpunkte gibt es an der UNO aus kantischer Sicht?
Kritisiert wird, dass die UNO auch Nichtrepubliken aufnimmt und behandelt, und dass der Sicherheitsrat undemokratisch und asymmetrisch aufgebaut ist. Zudem gehen die Kompetenzen der UNO über Kants Ideal eines minimalistischen Friedensbundes hinaus.
Welche Rolle spielt der Handel in Kants Friedenskonzept?
Kant sieht im Handelsgeist einen Faktor, der den Frieden fördert, da die Staaten gezwungen sind, den Frieden zu wahren, um wirtschaftliche Vorteile zu sichern.
Was ist das Fazit der Analyse?
Kants Friedensidee zieht sich wie ein roter Faden durch die UN-Charta. Auch wenn es Unterschiede zur Praxis gibt, kann die UN-Charta als "juristische Ausformulierung Kantischer Gedanken" bezeichnet werden. Die Arbeit schliesst daraus, dass globale Gefahren zunehmend die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit bekräftigen und einen stabilen Frieden erfordern.
- Quote paper
- Thomas Domjahn (Author), 2004, Immanuel Kant: Vordenker der Vereinten Nationen? Eine kritische Würdigung der Schrift 'Zum ewigen Frieden', Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/109545