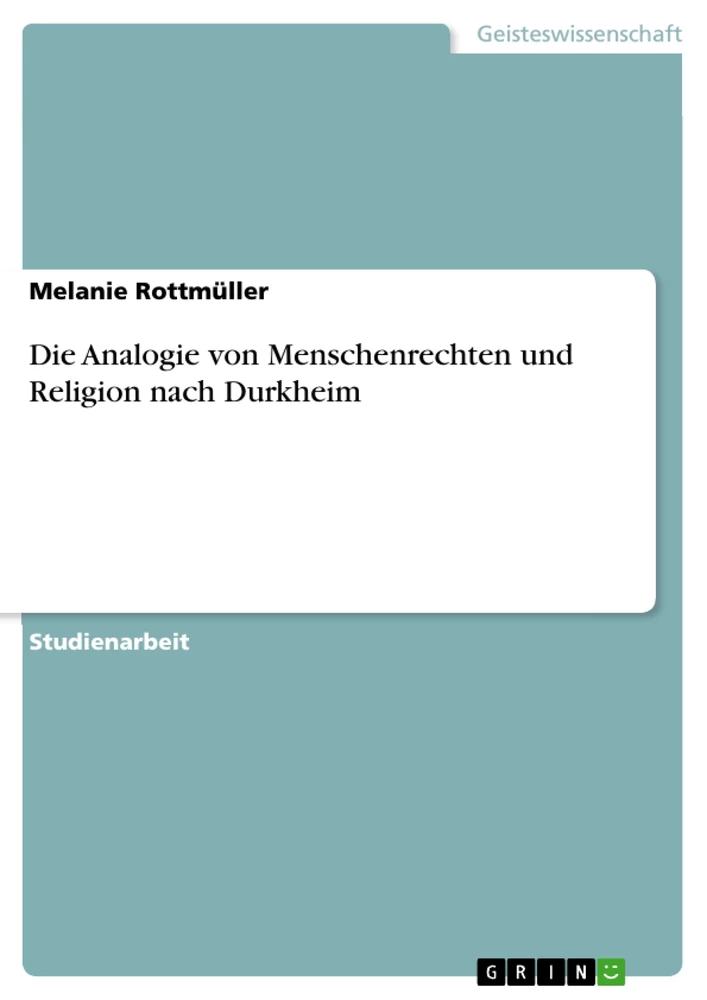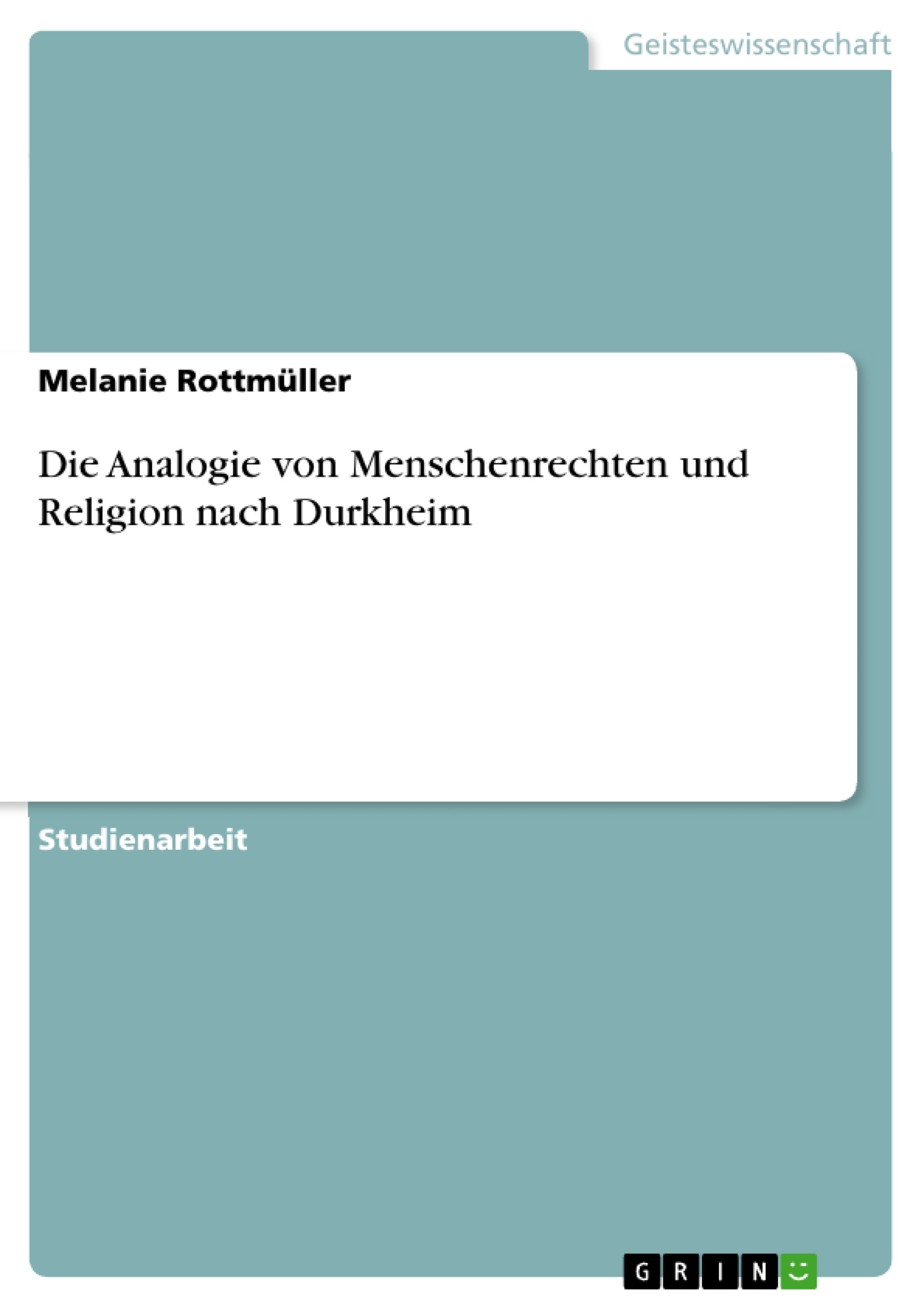Die soziale Ordnung wurde in früheren religiöseren Zeiten durch Religion garantiert. Heute allerdings verliert der Glaube an Bedeutung und ein fest etabliertes Reglement, wie es die Religion zu früheren Zeiten war, scheint nicht mehr existent zu sein. Doch ergab es sich im Jahre 1789, dass die Prinzipien der Französischen Revolution schriftlich fixiert wurden und fortan eine globale Ordnung bedingen sollten, indem sie zum Kernbestand des Menschenrechtsethos wurden. Für Durkheim war klar, das Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, der „Kult des Individuums“ im Spiegel der Zeit und des sozialen Wandels aktualisiert werden müssten. Gerade deshalb verwies er immer wieder auf die Menschenrechte als Religion. Diese haben die selben Funktionen wie Religion und können somit auch zur sozialen Ordnung beitragen. Das teilweise Fehlen dieser Ordnung bzw. die Pathologien, wie Durkheim sie nannte, stammen aus zu schnellen sozialen Wandel. Die Entwicklung der organischen Arbeitsteilung hinke demnach der Modernisierung der Gesellschaft nach, was nichts anderes bedeutet, als dass die bereits bestehenden kulturellen Grundlagen der modernen Gesellschaft noch nicht vollständig etabliert sind. Dennoch kann man die Menschenrechte als säkularisierte Religion sehen, die nach ihrer endgültigen globalen Etablierung, die wie man immer wieder sieht, noch lange nicht vollendet ist, wohl in der Lage sein werden eine soziale Ordnung einzurichten und sich selbst zu reproduzieren. Dies kann geschehen, wenn die Menschenrechte weltweit gerechtfertigt werden und somit legitimiert werden. Hierfür müssen sie sich in der Praxis bewähren und in die Traditionen der Völker Einzug finden. Das Problem hierbei liegt wohl zum Beispiel bei den machtbesessenen Diktatoren vieler Entwicklungsländer. Denn gerade jene, die die Menschenrechte immer wieder verletzen, würden durch die Festhaltung und Einhaltung derer, ihre Machtposition zu Nichte machen und sich mit der Bevölkerung gleichstellen.
Die globale Etablierung der Menschenrechte folgt also zunächst dem Verständnis aller. Wenn sich die Bevölkerung der Welt einig ist und die Vorteile einer gemeinsamen Ordnung ohne Vorherrschaft Einzelner erkennt, wird es auch möglich sein, die Menschenrechte zu legitimieren und sie als säkularisierte Religion weltweit anzuerkennen.
Inhaltsverzeichnis
I. Religion und Menschenrechte zur Sicherung der sozialen Ordnung
II. Die Analogie von Menschenrechten und Religion
1. Eigenschaften der Religion
a. Die Definition Durkheims
a. Fehlgeschlagene Definitionsversuche
β. Elementarphänomene der Religion und Definition
b. Funktionen von Religion
a. Integrationsfunktion
β. Moralische Funktion
y. Glaubensfunktion
2. Die Menschenrechte
a. Menschenrechte als Religion der Moderne?
b. Funktionen der Menschenrechte
III. Menschenrechte – eine säkularisierte Religion
Religion und Menschenrechte zur Sicherung der sozialen Ordnung
Durch seine Untersuchung der Religion der primitiven Stammesgesellschaften, versuchte Emile Durkheim in seinem letzten bedeutenden Werk, „Die elementaren Formen des religiösen Lebens“, die Wurzeln der sozialen Ordnung zu erforschen. Nachdem die Funktion der Religion darin besteht, „[...] die unantastbaren, heiligen Dinge von den profanen Lebensbereichen zu trennen, was nichts anderes heißt, als bestimmte moralische Ideen als stabile Wurzeln der sozialen Ordnung dauerhaft zu sichern.“[1] ist die Analogie zu den Menschenrechten, als „[...] Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft [...]“[2] nicht zu verkennen, da die „unveräußerlichen Menschenrechte [... der] Kern der normativen Ordnung moderner Gesellschaften“[3] sind.
Um diese Analogie zu verdeutlichen, soll im folgenden untersucht werden, was Religion ist und welche Funktionen sie in Bezug auf die soziale Ordnung einer Gesellschaft hat. Des Weiteren sollen die Funktionen der Menschenrechte dargestellt werden und diese mit den Funktionen der Religion abgeglichen werden, um als Ziel dieser Arbeit die Menschenrechte Religion der modernen Gesellschaft nennen zu können.
Die Analogie von Menschenrechten und Religion
Eigenschaften der Religion
Nach Durkheim ist Religion neben ihrer Bedeutung als Glaubenssystem, also als kulturelles System, auch ein soziales System. Nämlich insofern, als dass sie von der Gesellschaft als geordnete Praxis organisiert wird.[4]
Die Definition Durkheims
Um Religion zu definieren versuchte Durkheim zunächst sie als Gesamtheit zu beschreiben und sie über die Idee des Übernatürlichen und die des Göttlichen zu erklären.
Fehlgeschlagenen Definitionsversuche
Das Übernatürliche allerdings, als das Außerordentliche und Unvorhersehbare, kann nicht mit dem Begriff des Religiösen, dass vor Allem die Aufgabe hat zu erklären, was an den Dingen beständig und regelmäßig ist, zusammenfallen.[5]
Dass Religion weiterhin über das Göttliche hinausgeht und folglich nicht ausschließlich in Bezug darauf definiert werden kann, erkannte Durkheim aus der Tatsache heraus, dass es Religionen ohne Gottheit oder Geisteridee gibt.[6]
Beide Versuche scheiterten, da die Religion „[...] eine Summe von Teilen, d.h. ein mehr oder weniger komplexes System von Mythen, Dogmen, Riten und Zeremonien [ist.]“[7] und man ein Ganzes eben nur in bezug auf seine Teile definieren kann.[8]
Elementarphänomene der Religion und Definition
Aus dieser Erkenntnis heraus, versuchte Durkheim die Elementarphänomene der Religion zu identifizieren. Er erkannte eine „[...] Klassifizierung der realen oder idealen Dinge [...] in
zwei entgegengesetzte Gattungen [...], die man im allgemeinen durch zwei unterschiedliche Ausdrücke bezeichnet hat, nämlich durch profan und heilig.“[9] Diese „ [...] zweiseitige Teilung des bekannten und erkennbaren Universums in zwei Arten [...], die alles Existierende umfasst, die sich aber gegenseitig radikal ausschließen. Heilige Dinge sind, was die Verbote schützen und isolieren. Profane Dinge sind, worauf sich diese Verbote beziehen und die von den heiligen Dingen Abstand halten müssen. Religiöse Überzeugungen sind Vorstellungen, welche die Natur der heiligen Dinge und die Beziehungen ausdrücken, die sie untereinander oder mit profanen Dingen halten. Riten schließlich sind Verhaltensregeln, die dem Menschen vorschreiben, wie er sich den heiligen Dingen gegenüber zu benehmen hat.“ [10]
Als zweites Elementarphänomen der Religion erwählte Durkheim nicht ohne Grund die Gemeinschaft, nämlich die Kirche, den die stellt die Trennlinie zwischen Religion und Magie dar. Die Kirche ist nämlich „ [...] eine moralische Gemeinschaft, die aus allen Anhängern eines gemeinsamen Glaubens besteht [...]. Eine derartige Gemeinschaft fehlt der Magie normalerweise.“[11] Diese Gemeinschaft teilt die Überzeugungen von Heiligkeit und lebt Ver- und Gebote gemeinsam aus. Durch diese gemeinsame Vorstellung von der Welt kann das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gemeinschaft, sowie deren Normen und Werte an die nächsten Generationen weitergegeben werden und die Gemeinschaft, also die Kirche, aufrecht erhalten werden.[12]
Auf diesen Elementarphänomenen aufbauend, erstellt Durkheim eine Definition von Religion. Diese besagt, „ "Eine Religion ist ein solidarisches System von Überzeugungen und Praktiken,
die sich auf heilige, d.h. abgesonderte und verbotene Dinge, Überzeugungen und Praktiken beziehen, die in einer und derselben moralischen Gemeinschaft, die man Kirche nennt, alle vereinen, die ihr angehören“[13]
Funktionen der Religion
Durkheims funktionalistischer Religionsbegriff geht von drei Aufgaben der Religion aus: Die Integrationsfunktion, die moralische Funktion und die Glaubensfunktion. Diese sind eng miteinander verknüpft, wobei die Übergänge fließend sind.[14]
Integrationsfunktion
Die wichtigste Funktion der Religion ist nach Durkheim die Integration in die Gesellschaft. Durch das gemeinsame Praktizieren der Religion, wird der Zusammenhalt der Gesellschaft geschaffen und immer wieder reproduziert. Die Religion ermöglicht es den Mitgliedern der Gesellschaft sich zu identifizieren und sich gegenüber anderen abzugrenzen.[15]
Die moralische Funktion
Das gemeinsame Ausleben der Religion aber, muss sicher gestellt werden, damit es dauerhaft funktioniert. Dies geschieht über Regeln, die auf den moralischen Vorgaben der Religion basieren. Die vorherrschenden Auffassungen über Recht und Unrecht, werden durch gemeinsame Vorstellungen, über religiöse Dinge und wie diese zuschützen wären, innerhalb von Gesellschaften, hervorgebracht. Durch solche, das Heilige schützende, Verbote und das Leben im Einklang mit der natürlichen Ordnung ermöglichende Gebote, wird Ordnung im Leben der Gemeinschaft geschaffen. Durch das Ausleben der Regeln in Ritualen und Bräuchen wird diese Ordnung verfestigt und vereinheitlicht.[16]
Glaubensfunktion
Um die Werte einer Religion zu rechtfertigen und an die nächsten Generationen zu vermitteln, müssen diese legitimiert und tradiert werden, indem sie sich in der Praxis bewähren, denn erst dadurch gewinnt die Religion an Bestand. So ist es leicht möglich neue Gemeinschaftsmitglieder einzubinden, indem sie die Werte aufnehmen und reproduzieren, um sie später selbst an die nachfolgende Generation weiterzugeben.[17]
Die Menschenrechte
Die zentrale Problemstellung der Soziologiekonzeption Durkheims besteht in der Frage nach dem Verhältnis von individueller Autonomie und sozialer Ordnung.[18] Also, der Frage, wie soziale Ordnung trotz individueller Autonomie möglich ist. Das dies eben auf Grund der Funktionen der Religion geschieht wurde eben und in Durkheims Werken zur Moral aufgezeigt.
„Durkheims Begründung der Soziologie ist mir seiner kritischen Reflexion des normativen Gehalts der Menschenrechte aufs Engste verschränkt [...]“[19], denn gerade daraus gewinnt er die eben erwähnte Problemstellung. All seine Werke verinnerlichen seinen Wunsch, die Prinzipien der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, eben den „Kult des Individuums“, im Kontext der veränderten historischen Bedingungen zu aktualisieren. Die Entwicklungen der Moderne geschehen nach Durkheim auf Grund von sozialem Wandel, wobei Individualisierung, Pluralisierung und
Säkularisierung bedeutende Elemente dieses Prozesses darstellen, welche die Menschen aus ihren traditionellen Lebenszusammenhängen reißen und ihnen höhere Handlungsfreiheit zumuten.[20]
Menschenrechte als Religion der Moderne?
Wenn wir aber eben noch herausgestellt haben, dass soziale Ordnung auf Religion basiert, wie ist diese dann in unserer eben säkularisierten Welt möglich? Ist es möglich, dass die durch die UN konzipierten Menschenrechte die Funktionen der Religion übernehmen oder sogar die selben Funktionen innehaben?
Durkheim formuliert hierzu folgendes: „Ihre Autorität gewinnen sie [die Menschenrechte] nicht daher, dass sie mit der Religion übereinstimmen, sondern daher dass sie nationalen Bestrebungen entsprechen. Man glaubt an sie nicht wie an Lehrsätze, sondern wie an Glaubensartikel. Sie sind weder von der Wissenschaft noch für sie gemacht worden; sondern sie resultieren aus der Praxis des Lebens selbst. In einem Wort, sie sind eine Religion, die ihre Märtyrer und ihre Apostel hatte, die nachhaltig die Massen ergriffen hat und die entschiedenermaßen große Dinge hat entstehen lassen.“[21]
Funktionen der Menschenrechte
Die Funktionen der Menschenrechte lassen sich mit Bezugnahme auf Durkheims „Über soziale Arbeitsteilung“ ohne säkularen Einfluss rekonstruieren.
Vergleichbar mit der Integrationsfunktion der Religion ist das soziale Band, dass durch Arbeitsteilung, neben Individualisierungsprozessen und moralischer Pluralisierung geschaffen wird. Dieses Band basiert weder auf Interessenausgleich, noch auf staatlichen Repressionen, sondern besteht in einer spontanen Solidarität. Individualisierung in der organischen Solidarität geschieht durch die Spezialisierung einzelner auf berufliche Funktionen. Dadurch wird die individuelle Handlungsautonomie vom allgemein verpflichtenden Kollektivbewusstsein entbunden. Gerade aus dieser Individualisierung entspringt die Pluralisierung moralischer Normen, denn der Einzelne orientiert sich mehr am jeweiligen Berufsethos als am Kollektiv. Allerdings setzt dieser Prozess der Abschwächung des Kollektivbewusstseins Säkularisierung voraus, denn, wie bei den Funktionen der Religion beschrieben, ist das Kollektivbewusstsein gerade in religiös bestimmten Gesellschaften besonders stark.
Die Moralische Funktion der Religion, die das individuelle Handeln reglementiert, wird durch die Vertragssolidarität gewährleistet. Durch diese entspricht die Funktion der Arbeitsteilung der Moral und moderner Gesellschaften entstehen durch einen Prozess moralischer Transformation. Gerade aus diesem Grund ist insbesondere der in der Moderne entstandene Individualismus und die Säkularisierung nicht schädlich für die Etablierung der Menschenrechte als Religion, obwohl schädlich für die Religion im säkularen Sinn. Denn gerade der universalistische Individualismus ruft das Kollektivbewusstsein moderner Gesellschaften hervor, denn das „Menschsein“ selbst wird zur Grundlage kollektiver Repräsentationen und eben das Individuum wird Gegenstand einer Art Religion. Dadurch wird wiederum die Integrationsfunktion aufrecht erhalten und erweitert sich zu einem Mechanismus der Koordination individueller Handlungsorientierungen, was erneut in der moralischen Funktion von Religion gründet.
Die Glaubenfunktion erfüllt sich letztendlich aus genau dem selben Grund. Die kollektiven Vorstellungen einer „idealen Humanität“ nämlich bringen die Individuen in einer einzigen Ideenwelt zusammen. Was nichts anderes bedeutet, als dass die sozialen Bindungen durch einen Bezug auf gemeinsame kulturelle Werte – nämlich die Menschenrechte – immer wieder reproduziert und somit legitimiert werden.[22]
Menschenrechte – eine säkularisierte Religion
Die soziale Ordnung wurde in früheren religiöseren Zeiten durch die Religion garantiert. Heute allerdings verliert der Glaube an Bedeutung und ein fest etabliertes Reglement, wie es die Religion zu früheren Zeiten war, scheint nicht mehr existent zu sein. Doch ergab es sich im Jahre 1789, dass die Prinzipien der Französischen Revolution schriftlich fixiert wurden und fortan eine globale Ordnung bedingen sollten, indem sie zum Kernbestand des Menschenrechtsethos wurden. Für Durkheim war klar, das Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, der „Kult des Individuums“ im Spiegel der Zeit und des sozialen Wandels aktualisiert werden müssten. Gerade deshalb verwies er immer wieder auf die Menschenrechte als Religion. Diese haben, wie eben aufgezeigt, die selben Funktionen wie Religion und können somit auch zur sozialen Ordnung beitragen.
Das teilweise Fehlen dieser Ordnung bzw. die Pathologien, wie Durkheim sie nannte, stamme aus dem zu schnellen sozialen Wandel. Die Entwicklung der organischen Arbeitsteilung hinke demnach der
Modernisierung der Gesellschaft nach, was nichts anderes bedeutet, als dass die bereits bestehenden kulturellen Grundlagen der modernen Gesellschaft noch nicht vollständig etabliert sind.[23]
Dennoch kann man die Menschenrechte als säkularisierte Religion sehen, die nach ihrer endgültigen globalen Etablierung, die wie man immer wieder sieht, noch lange nicht vollendet ist, wohl in der Lage sein werden eine soziale Ordnung einzurichten und sich selbst immer wieder zu reproduzieren.
Dies kann geschehen, wenn die Menschenrechte weltweit gerechtfertigt werden und somit legitimiert werden, hierfür müssen sie sich in der Praxis bewähren und in die Traditionen der Völker Einzug finden. Das Problem hierbei liegt wohl zum Beispiel bei den machtbesessenen Diktatoren vieler Entwicklungsländer. Denn gerade jene, die die Menschenrechte immer wieder verletzen, würden durch die Festhaltung und Einhaltung derer, ihre Machtposition zu Nichte machen und sich mit der Bevölkerung gleichstellen.
Die globale Etablierung der Menschenrechte folgt also zunächst dem Verständnis aller. Wenn sich die Bevölkerung der Welt einig ist und die Vorteile einer gemeinsamen Ordnung ohne Vorherrschaft Einzelner erkennt, wird es auch möglich sein, die Menschenrechte zu legitimieren und sie als säkularisierte Religion weltweit anzuerkennen.
Literatur:
- Durkheim, Emile: Die elementaren Formen des religiösen Lebens; Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main; 1981
- König, Matthias: Menschenrechte bei Durkheim und Weber. Normative Dimensionen des soziologischen Diskurses der Moderne; Campus Verlag; Frankfurt am Main; 2002
- Metscher, Klaus: Menschenrechte – die säkulare Religion: www.igfm.de/mr/mr1999/z9943komm.htm
- Münch , Richard: Soziologische Theorie, Band1: Grundlegung durch die Klassiker; Campus Verlag; Frankfurt am Main; 2002
- Münch, Richard: Theorie des Handelns: Zur Rekonstruktion der Beiträge von Talcott Parsens, Emile Durkheim und Max Weber; Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main; 1982
[...]
[1] nach Münch , Richard: Soziologische Theorie, Band1: Grundlegung durch die Klassiker; Campus Verlag; Frankfurt am Main; 2002 (Im folgenden zitiert als „Münch 2002“) , S 89, Z. 6ff
[2] nach. www.igfm.de/mr/mr1999/z9943komm.htm
[3] nach Münch, Richard: Theorie des Handelns: Zur Rekonstruktion der Beiträge von Talcott Parsens, Emile Durkheim und Max Weber; Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main; 1982 (Im folgenden zitiert als „Münch 1982“), S.317, Z. 33f
[4] vgl. Münch 2002, S.88, Z.29ff
[5] vgl. Durkheim, S.51, Z.17ff
[6] vgl. ebenda, S.60, Z.27ff
[7] nach Durkheim, Emile: Die elementaren Formen des religiösen Lebens; Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main; 1981 (Im folgenden zitiert als „Durkheim“), S.61, Z.6
[8] vgl. Durkheim, S. 47 – S.61, Z.10
[9] nach Durkheim, S.61, Z.12ff
[10] nach Durkheim, S.67, Z.2ff
[11] nach Durkheim, S.73, Z. 6ff
[12] vgl. Durkheim, S.70f
[13] nach Durkheim, S.75, Z.15ff
[14] vgl. Durkheim, S.128ff
[15] vgl. Durkheim, S.128ff
[16] vgl. Durkheim, S.128ff
[17] vgl. Durkheim, S.128ff
[18] vgl. König, Matthias: Menschenrechte bei Durkheim und Weber. Normative Dimensionen des soziologischen Diskurses der Moderne; Campus Verlag; Frankfurt am Main; 2002 (im folgenden zitiert als: „ König“), S.19
[19] nach König, S.19, Z.9ff
[20] vgl. König, S. 16
[21] nach König, S.37, Z.1ff
[22] vgl. König, S.38 - 50
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit "Religion und Menschenrechte zur Sicherung der sozialen Ordnung"?
Die Arbeit untersucht die Analogie zwischen Religion und Menschenrechten, insbesondere im Hinblick auf ihre Funktion zur Sicherung der sozialen Ordnung. Sie analysiert, inwiefern Menschenrechte als eine Art säkularisierte Religion der Moderne betrachtet werden können, die ähnliche Funktionen wie traditionelle Religionen erfüllen.
Welche Rolle spielt Emile Durkheim in dieser Analyse?
Emile Durkheim ist ein zentraler Bezugspunkt der Arbeit. Seine Theorien über Religion, soziale Ordnung und die Funktion von Kollektivbewusstsein werden verwendet, um die Analogie zwischen Religion und Menschenrechten zu verdeutlichen. Insbesondere wird sein Werk "Die elementaren Formen des religiösen Lebens" herangezogen.
Was sind die Schlüsseleigenschaften von Religion nach Durkheim?
Durkheim definiert Religion als ein solidarisches System von Überzeugungen und Praktiken, die sich auf heilige, d.h. abgesonderte und verbotene Dinge beziehen. Er betont die Bedeutung der Gemeinschaft (Kirche) und die Unterscheidung zwischen Heiligem und Profanem.
Welche Funktionen der Religion werden in der Arbeit hervorgehoben?
Die Arbeit nennt drei Hauptfunktionen der Religion nach Durkheim: die Integrationsfunktion (Schaffung von Zusammenhalt in der Gesellschaft), die moralische Funktion (Etablierung von Regeln und Normen) und die Glaubensfunktion (Legitimierung und Tradierung von Werten).
Inwiefern ähneln die Menschenrechte den Religionen in Bezug auf ihre Funktionen?
Die Arbeit argumentiert, dass die Menschenrechte ähnliche Funktionen wie Religionen erfüllen: Sie integrieren Individuen in eine Gesellschaft, indem sie ein gemeinsames Wertesystem (den "Kult des Individuums") fördern. Sie etablieren moralische Normen und reglementieren individuelles Handeln durch Vertragssolidarität und sie legitimieren diese Normen durch kollektive Vorstellungen einer "idealen Humanität".
Was bedeutet "säkularisierte Religion" im Kontext dieser Arbeit?
Der Begriff "säkularisierte Religion" bezieht sich auf die Idee, dass die Menschenrechte in der modernen, säkularen Gesellschaft die Rolle und Funktionen traditioneller Religionen übernehmen. Sie bieten einen Rahmen für moralische Orientierung, soziale Integration und kollektive Identität.
Welche Rolle spielt die Arbeitsteilung nach Durkheim in Bezug auf die Menschenrechte?
Die Arbeitsteilung wird als Mechanismus gesehen, der neben Individualisierungsprozessen auch soziale Bindungen schafft. Die daraus resultierende organische Solidarität und Vertragssolidarität tragen zur Etablierung und Aufrechterhaltung der Menschenrechte bei.
Was sind die Hindernisse für die globale Etablierung der Menschenrechte laut der Arbeit?
Ein Hindernis ist die mangelnde Akzeptanz und Rechtfertigung der Menschenrechte in der Praxis. Die Arbeit nennt beispielhaft machthungrige Diktatoren, die ihre Macht durch die Einhaltung der Menschenrechte verlieren würden. Es bedarf eines globalen Verständnisses und einer gemeinsamen Ordnung ohne Vorherrschaft Einzelner, um die Menschenrechte zu legitimieren und als säkularisierte Religion weltweit anzuerkennen.
- Quote paper
- Melanie Rottmüller (Author), 2005, Die Analogie von Menschenrechten und Religion nach Durkheim, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/109359