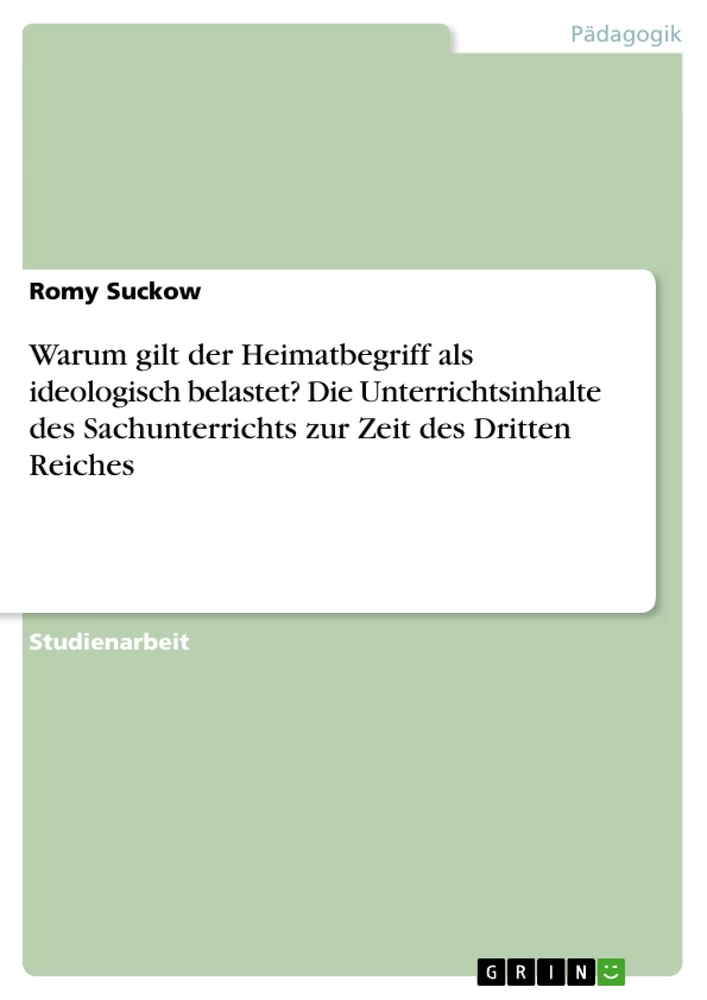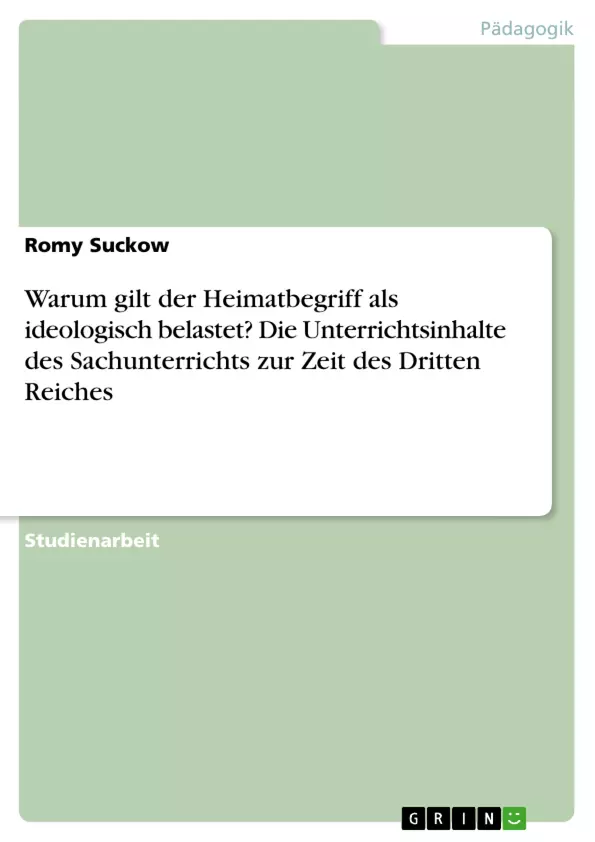Warum gilt der Heimatbegriff als ideologisch belastet? –
Die Unterrichtsinhalte des Sachunterrichts zur Zeit des Dritten Reiches
1.Vorbemerkung zum Heimatbegriff
Der Heimatbegriff bezeichnet subjektiv von einzelnen Menschen oder kollektiv von Gruppen, Stämmen, Völkern, Nationen erlebte territoriale Einheit, zu der ein Gefühl besonders enger Verbundenheit besteht. Im allgemeinen Sprachge brauch ist Heimat zunächst auf den Ort (auch als Landschaft verstanden) bezogen, in den der Mensch hineingeboren wird, wo die frühen Sozialisationserlebnisse stattfinden, die weithin Identität, Charakter, Mentalität, Einstellungen und schließlich auch Weltauf fassungen prägen. Insoweit kommen dem Begriff grundlegend eine äußere, auf den Erfahrungsraum zielende, und eine auf die Modellierung der Gefühle und Einstellungen zielende innere Dimension zu, die (zumal der Begriff Heimat zunächst mit der Erfahrung der Kindheit verbunden ist) dem Begriff eine meist stark gefühlsbetonte, ästhetische, nicht zuletzt ideologische Komponente verleihen 1.
Heimat an sich bezeichnet demzufolge nichts Schlechtes. Die eigene Heimat wurde jedoch zur Zeit des Unterrichts im Dritten Reich gegenüber anderen Heimaten abgegrenzt.
Die Konzeptionen der Heimatkunde ist unterschiedlich und immer verknüpft mit der Zeitgeschichte und den gerade vorherrschenden Vorstellungen des Begriffs der Heimat.
Die eigenen Heimat wurde zeitweise als das Größte dargestellt. Die Kinder sollten sich mit der eigenen Heimat identifizieren, und zwar ausschließlich mit der eigenen. Dies trug zur Ausbildung einer nazistischen Denkweise bei, wie sie den Deutschen teilweise heute noch angehaftet wird bzw. teilweise noch besteht. Der Heimatbegriff wurde also mehr oder minder auf die eigene Umgebung reduziert und somit hat der Begriff für das heutige Unterrichtsfach Sachunterricht bzw. Sachkunde (nur wenige Bundesländer haben den Begriff Heimat noch im Unterrichtsnamen enthalten) eine negative Konnotation bekommen. Das bedeutet nicht, dass der Heimatbegriff in der heutigen Zeit nur aus Das alte Bild der Heimat, in dem geschichtliche Blutströme und die geheime Macht des Bodens eine große Rolle spielten, hat einem nüchterneren, aber auch freundlicheren Bild Platz gemacht. Die pathetische Schwere hat sich von der Heimat abgelöst; Heimat ist gewissermaßen leichter geworden. Das schließt Ernst und Tiefe nicht völlig aus, wohl aber falsches Pathos. Was von außen kommt, muss nicht wegpurifiziert werden. Nicht alles, was neu ist, hat den Heimatanspruch verwirkt. Eben deshalb aber hat auch das Alte, das Überlieferte eine unproblematischere Berechtigung zurückgewonnen.
Die Schule muss versuchen, eine richtige Relation und Mischung von Alt und Neu, eigen und fremd, Heimat und Welt herzustellen (vgl. Bausinger S.42).
2. Die Unterrichtsinhalte nach der Weimarer Republik bis zur Gegenwart
2.1. Die Unterrichtsinhalte vor 1933
Um zu erklären, warum der Heimatbegriff für den Sachunterricht als ideologisch belastet gilt, ist ein historischer Rückblick nötig.
In der geschichtlichen Entwicklung der Heimatkunde dringen nach dem Ersten Weltkrieg unterschiedliche Interpretationsmuster der Heimat in die didaktische und pädagogische Reflexion des Unterrichtsfaches mit ein.
1921 sahen die Lehrpläne für die Grundschule heimatlichen Anschauungsunterricht vor, der der Vorbereitung des späteren erdkundlichen, naturkundlichen und geschichtlichen Unterrichts dienen sollte. Dabei fanden Gesinnungsbildende Intentionen fanden kaum Niederschlag. Das Ziel der Heimatkunde war es, anhand eines anschaulichen, auf die engere heimatliche Umgebung rückbezogenen Unterrichts Wissensstoff in einer leben- digen Ganzheit, u. a. durch Anschauung, Wanderung und Erlebnis, zu zeigen.
2.2. Der Heimatkundeunterricht zur Zeit des Dritten Reiches
Der Heimatkundeunterricht wurde in den Dienst einer nationalso- zialistisch politisierten Pädagogik gestellt. Für ihre machtpolitischen Zwecke war eine „Pädagogik“ in Form einer Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen allumfassenden Okkupation ein wichtiges Instrument, das half, die Jugend möglichst unter Ausschaltung jeglicher kritischer Gedanken in die „völkische Lebensgemeinschaft“ zu integrieren. Der „Volksgemeinschaft“ haben alle zu dienen ( vgl.Schubert, S. 189).
Die Grundschule mit ihrem Heimatkundeunterricht wurde instrumentalisiert. Die Heimatkundekonzeption der 20er Jahre wurde von den Nationalsozialisten zwar aufgegriffen, aber nicht bruchlos übernommen, sondern im nationalsozialistischen Sinne verändert.
Themenbereiche der kindlichen Lebenswelt wurden so umgemünzt, dass sie in das Konzept des nationalsozialistisch orientierten Unterrichts passten.
So wurde z.B. der Themenbereich „der Wald“ nicht mehr primär als ein den Kindern vertrauter Teil ihrer Lebenswelt in seiner ökologischen Bedeutung behandelt, sondern zum „Gelände“ wehrsportlicher Übungen unter dem Aspekt der paramilitärischen Ausbildung der Kinder verändert.
Die Bäume und Pflanzen des Waldes werden nicht nur in ihren biologischen und ökologischen Zusammenhängen in kindgemäßer Form behandelt, sondern hinsichtlich ihrer Tarnungsmöglichkeiten und ihrer „strategischen“ Bedeutung untersucht (vgl. Schubert, S.195).
Die Heimat wurde im Denkrahmen der geisteswissenschaftlichen Pädagogik zum Erziehungs- und Bildungswert aufgestuft und unter emotionaler Aufladung mit existen tieller Bedeutsamkeit für die individuelle wie kollektive Identitätsgewinnung ausgestattet. Die schulische Heimatkunde verpflichtete sich auf Gesinnungsschulung, denn sie hat die gefühlsmäßige Bindung des Schülers an seinen Nahraum einschließlich der dort vorfindbaren Lebensverhältnisse anzustreben und zwar in Gestalt der Erziehung zur Heimatliebe. Mit dieser normativen Ausrichtung erfüllt das Fach in schultheoretischer Hinsicht die Sozialisationsfunktion der Schule, denn es geht nicht primär um Reflexion über die Erscheinungen und Verhältnisse in der Heimat, sondern um distanzlose Identifikation mit ihnen, um die Einfügung des Einzelnen in bestehende Lokalverhält nisse. Heimat ist daher auch nicht austauschbar, sondern insistiert auf Einzigartigkeit und darin Inbegriffen auf Differenz zum Fremden sowohl im kleinformatigen wie im großformatigen — auf Nation und Vaterland bezogenen — Ausmaße (Vgl. Götz, S.52).
Heimatkunden früherer Prägung haben nie nach Heimat gesucht, auf Heimat gehofft, sondern eindeutig gezeigt und damit auch abgegrenzt, wo Heimat war (vgl. Greverus 1979, S. 14). Heimat und Liebe zur Heimat wurden von den jeweiligen territorialen Machthabern geplant und verordnet. Heimatkunde verkam so zu einer affirmativen, die gesellschaftlichen Verhältnisse bedingungslos stabilisierenden Erziehung (Vgl. Daum, S.79).
2.3. Vom Unterricht der Gesinnungsbildung hin zu den heutigen Inhalten des Sachunterrichts
Der auf Gesinnungsbildung hin angelegte Umgang mit der Heimat ist in unterschiedlicher Gewichtung in didaktischen Positionen - nicht in allen natürlich- seit der obligatorischen Einführung des Grundschulfaches bis in die 1960er-Jahre hinein zu finden und wurde unter ideologischem Aufwand für eine regimetreue Erziehung im Dritten Reich genutzt (vgl. Rodehüser 1989; Götz 1996).
Auch heute soll den Kindern ein gewisses Heimatgefühl vermittelt werden. Dies ge- schieht im Gegensatz zur Zeit des Dritten Reiches jedoch ohne einen ausschließlich ideologischen Hintergrund, welcher die eigene Heimat von den anderen Heimaten ab- grenzt und höherwertig betrachtet.
Die ideologische Verabsolutierung der Heimat wird heute abgelehnt, zugleich der diffuse Auftrag der "Gemütsbildung" stark eingeschränkt. Die räumliche Umwelt ist nicht mehr allein Mittelpunkt des Unterrichts, Ziel ist jetzt "ein bewusstes Auffassen von Erscheinungen und Vorgängen in der Natur, im Zusammenleben der Menschen früher und heute, in der Wirtschaft, der Arbeit und Technik, in dem vom Menschen gestalteten Raum und in der Hygiene [...]" 2 .
Das Lernen kann im Sachunterricht zu einem zukunftsgerichteten und produktiven Heimatgefühl beitragen, wenn es auf das Zusammenleben mit anderen gerichtet ist, mit älteren Menschen, mit Kindern in anderen Lebensbedingungen in anderen Ländern, mit Fremden im eigenen Land, mit behinderten Menschen. Sich selbst wohl fühlen mit an- deren und Kraft und Phantasie entwickeln, etwas mit ihnen gemeinsam zu tun, kann man nur, wenn man sich selbst mag. „Heimat ist, wo ich jemand sein kann, nämlich ich selber" (Meyer-Abich 2001, S. 17).
_Volker Schwier und Maik Jablonski , die sich mit der Frage nach dem Heimatbegriff beschäftigen, plädieren dafür, den Begriff Heimat durch den Begriff Lebenswelt zu ersetzen.
Der heutige Sachunterricht ist an der Lebenswelt der Kinder orientiert. Didaktiker wie "Lebensweltorientierter" Sachunterricht in emanzipatorischer Absicht fragt
a)nach der subjektiven Sinnprovinz des Individuums;
b) der Bedeutung des traditionellen und selbstverständlichen Handelns von Gruppen;
c) den sozial-kulturell geformten Wahrnehmungs- und Erfahrungswelten einer Gesellschaft.
E. Daum hat weniger Probleme mit dem Heimatbegriff an sich. Er ist nur dafür, das Verständnis von Heimat zu ändern. Heimat sollte sich nicht nur aus die eigene beschränken, es sollte im Rahmen des Sachunterrichts auch möglich sein „über den Zaun“ zu sehen.
Die eigene Heimat kann und soll in unserer Gesellschaft Verhaltenssicherheit, Vertrautheit und Wohlbefinden stiften. Sie muss aber zugleich auch gegenüber dem Fremden und Andersartigen offen sein, was zur Zeit des Dritten Reiches ganz und gar nicht der Fall war. Wie anders ließe sich auf friedliche Weise mit Gastarbeitern aus
verschiedenen Nationen, wie mit Asylsuchenden und Aussiedlern zusammenleben?
Fast schon jede Schule ist heute in dieser Hinsicht herausgefordert. Heimatsuchende haben an unsere Tür geklopft und verdienen gastliche Aufnahme und liebevolle Zuwendung (vgl.Daum, S.80).
Gegenwärtig soll der Begriff „Heimat“ nicht nur verteufelt werden, man muss nur richtig mit dem Begriff bei der didaktischen Vermittlung umgehen.
Nicht die Ablehnung oder Ersetzung des Begriffes in der didaktischen Konzeption des Faches, sondern deren Neubewertung, man kann wohl im Rückblick sagen Revaluie-
rung, sogar des Terminus „Heimat". Auch im Sachunterricht der Zukunft, so der über-
wiegende Tenor der Diskussionen 2001, soll Heimat als kennzeichnendes Wort, als bedeutsamer Inhalt und als Zielvorstellung des Sachunterrichts beibehalten werden, wenn auch in einem zeitgemäßen, modernen, erweiterten Verständnis. (Vgl. Engelhardt & Stoltenberg, S. 10).
Bibliographie
Daum, E. (2002): Wo ist Heimat? In W. Engelhardt & U. Stoltenberg (Hrsg.), Die Welt zur Heimat machen?, S. 73-82. Heilbrunn: Klinkhardt. (Reihe: Probleme und Perspektiven des Sachunterrichts, 12)
Engelhardt, W. & Stoltenberg, U. (2002): Die Welt zur Heimat machen? In W. Engelhardt & U. Stoltenberg (Hrsg.), Die Welt zur Heimat machen?, S. 9-26. Heilbrunn: Klinkhardt. (Reihe: Probleme und Perspektiven des Sachunterrichts, 12)
Götz, M. (2002)Der unterrichtliche Umgang mit Heimat in der Geschichte der Heimatkunde der Grundschule. In W. Engelhardt & U. Stoltenberg (Hrsg.), Die Welt zur Heimat machen?, S. 51-56. Heilbrunn: Klinkhardt. (Reihe: Probleme und Perspektiven des Sachunterrichts, 12)
Greverus, Ina-Maria (1979): Auf der Suche nach Heimat. München, Beck Verlag.
Schubert, Ulrich (1987): Das Schulfach Heimatkunde im Spiegel von Lehrerhandbüchern der 20er Jahre. Hildesheim, Georg Olms Verlag,.
Elektronische Medien/Internetseiten:
"Heimatkunde,"Microsoft® Encarta® Enzyklopädie 2000. © 1993-1999 Microsoft Corporation.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt der Heimatbegriff als ideologisch belastet im Kontext des Sachunterrichts?
Der Heimatbegriff gilt als ideologisch belastet, weil er während der Zeit des Dritten Reiches missbraucht wurde, um eine nationalistische und ausgrenzende Denkweise zu fördern. Der Unterricht wurde instrumentalisiert, um Kinder ausschließlich mit der eigenen Heimat zu identifizieren und eine nazistische Ideologie zu verankern. Die eigene Heimat wurde gegenüber anderen abgegrenzt und höherwertig dargestellt.
Was waren die Unterrichtsinhalte des Sachunterrichts vor 1933 (Weimarer Republik)?
Vor 1933, in der Weimarer Republik, sahen die Lehrpläne für die Grundschule heimatlichen Anschauungsunterricht vor. Dieser sollte die spätere Erd-, Natur- und Geschichtskunde vorbereiten. Gesinnungsbildende Intentionen spielten eine geringe Rolle. Ziel war es, Wissen anhand der heimatlichen Umgebung anschaulich zu vermitteln.
Wie veränderte sich der Heimatkundeunterricht zur Zeit des Dritten Reiches?
Der Heimatkundeunterricht wurde im Dritten Reich in den Dienst einer nationalsozialistisch politisierten Pädagogik gestellt. Themenbereiche der kindlichen Lebenswelt wurden so umgemünzt, dass sie in das Konzept des nationalsozialistisch orientierten Unterrichts passten. Die Heimat wurde emotional aufgeladen und zur Gesinnungsschulung genutzt, um eine distanzlose Identifikation mit den lokalen Verhältnissen zu erreichen.
Wie hat sich der Unterricht von der Gesinnungsbildung zu den heutigen Inhalten des Sachunterrichts entwickelt?
Nach dem Dritten Reich wurde die ideologische Verabsolutierung der Heimat abgelehnt und der Auftrag der "Gemütsbildung" eingeschränkt. Der Fokus verlagerte sich auf ein bewusstes Auffassen von Natur, Zusammenleben, Wirtschaft, Arbeit, Technik und Hygiene. Ziel ist es, ein zukunftsgerichtetes und produktives Heimatgefühl zu entwickeln, das auf Zusammenleben und Offenheit gegenüber anderen ausgerichtet ist.
Was ist das Ziel des heutigen Sachunterrichts bezüglich des Heimatbegriffs?
Der heutige Sachunterricht soll ein Heimatgefühl vermitteln, jedoch ohne ideologischen Hintergrund, der die eigene Heimat von anderen abgrenzt und höherwertig betrachtet. Es soll eine offene Auseinandersetzung mit der eigenen und fremden Lebenswelten gefördert werden. Der Begriff "Heimat" soll in einem zeitgemäßen, modernen und erweiterten Verständnis beibehalten werden.
Welche Alternativen zum Heimatbegriff werden diskutiert?
Einige Didaktiker, wie Volker Schwier und Maik Jablonski, plädieren dafür, den Begriff Heimat durch den Begriff Lebenswelt zu ersetzen, um den Fokus auf die subjektive Sinnprovinz des Individuums, die Bedeutung traditionellen Handelns und die sozial-kulturell geformten Wahrnehmungswelten zu legen.
Wie soll mit dem Heimatbegriff im heutigen Unterricht umgegangen werden?
Der Heimatbegriff soll nicht verteufelt werden, sondern richtig in der didaktischen Vermittlung eingesetzt werden. Eigene Heimat soll Verhaltenssicherheit, Vertrautheit und Wohlbefinden stiften, aber zugleich auch gegenüber dem Fremden und Andersartigen offen sein. Es geht um eine Neubewertung und Erweiterung des Begriffs, sodass er ein Kennzeichen, ein bedeutsamer Inhalt und eine Zielvorstellung des Sachunterrichts bleibt.
- Arbeit zitieren
- Romy Suckow (Autor:in), 2004, Warum gilt der Heimatbegriff als ideologisch belastet? Die Unterrichtsinhalte des Sachunterrichts zur Zeit des Dritten Reiches, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/109080