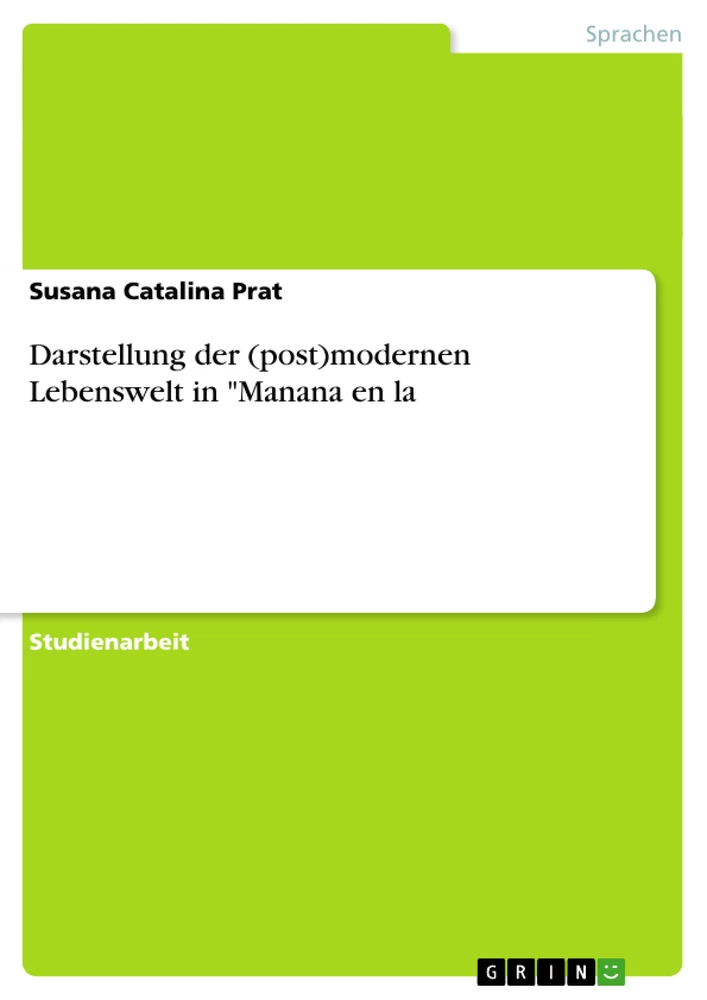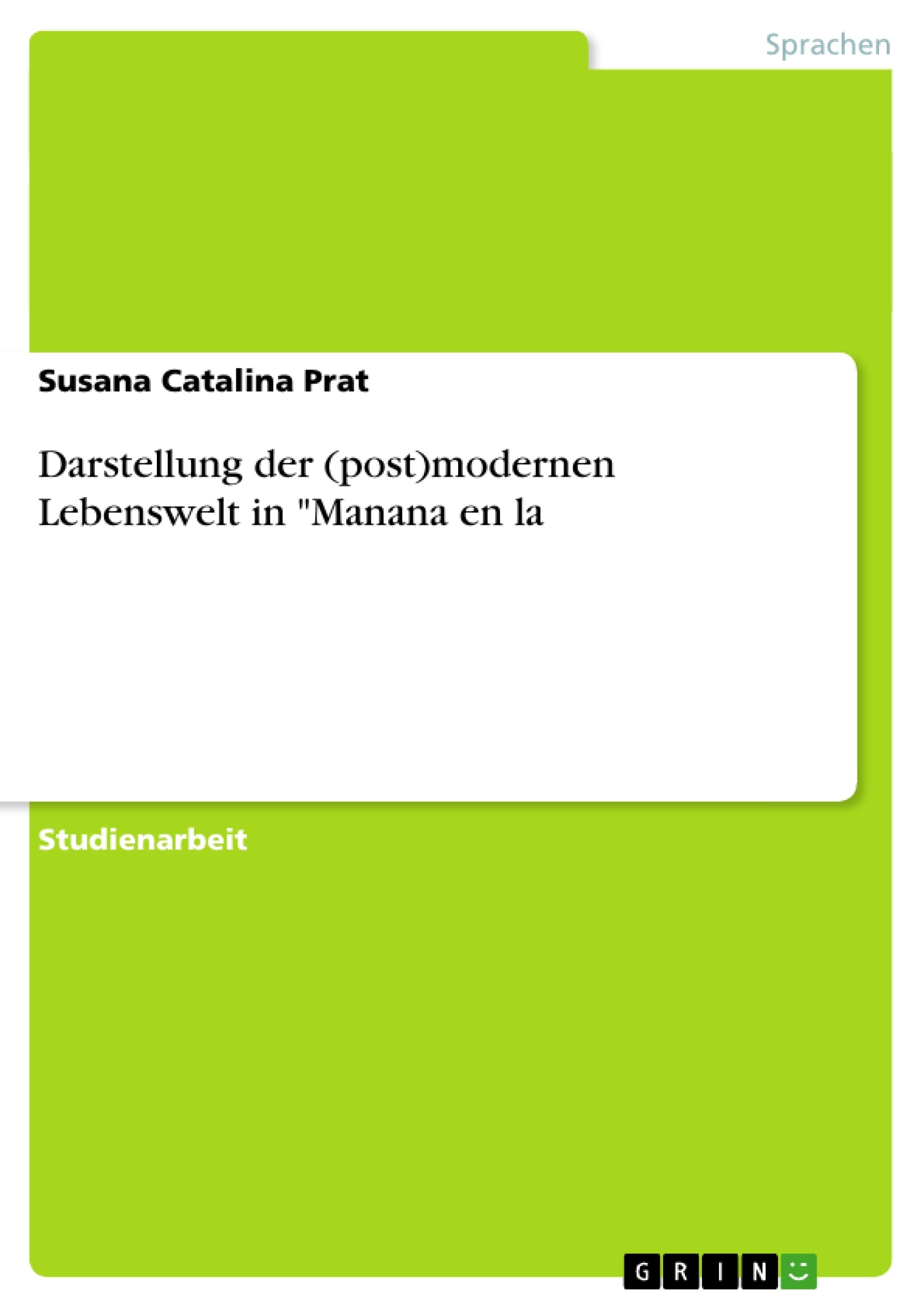Inhalt
1. Einleitung
2. Stadttexte - Textstädte
2.1 Referentielle Stadtkonstitution
2.2 Semantische Stadtkonstitution
2.3 Modalisierung
2.4 Textstädte, Funktionen diskursiver Stadtkonstitutionen
2.5 Tod der Stadt/ Ende des Stadttexts?
3. Orte und Nicht-Orte
4. Die (post)moderne Stadtdarstellung in “Mañana en la batalla piensa en mí”
5. Unterschied zwischen moderner und postmoderner Stadt
Bibliographie
1. Einleitung
Die Postmoderne hat eine Reihe von typischen Romanen hervorgebracht, die sich größtenteils mit der Stadtdarstellung und der Identitäslosigkeit der Protagonisten befasst.
In dieser Arbeit möchte ich darstellen, wie Javier Marías in seinem Roman "Mañana en la batalla piensa en mí" anhand von Beschreibungen sogenannter "Nichtorte" (Augé1) eine postmoderne Lebenswelt, genauer gesagt, eine postmoderne Stadtdarstellung, nämlich die Madrids beschreibt. Es stellt sich also die Frage, ob dieser Roman nun wirklich typische postmoderne Strukturen und Merkmale aufweist und wenn ja, in wieweit diese die Geschichte und auch die Auffassung des Lesers beeinflussen. Eine andere Frage ist auch, ob dieser Text spezifisch an eine besondere
Stadt gebunden ist, oder ob sich diese Geschichte in irgendeiner anderen Stadt so abspielen könnte. Wäre es zum Beispiel möglich, Marta in Barcelona in Victors Armen sterben zu lassen, oder gar in einer anderen nichtspanischen Stadt? Und spielt die andere, im Text kurz dargestellte Stadt London eine wichtige Rolle, oder ist auch diese durch zum Beispiel Berlin oder Paris ersetzbar?
Warum diese Ersetzbarkeit so von Bedeutung ist, soll unter anderem auch in dieser Hausarbeit geklärt werden.
Hierfür sind vor allem die Texte Mahlers "Stadttexte - Textstädte2" und Augés "Orte
und Nichtorte" von Bedeutung.
2. Stadttexte - Textstädte
Nach Mahler "eignet sich jede Stadt eine Textur, eine jeweils spezifische Semiotik, in der sich Zeichen neben Zeichen stellen, Bedeutung tragen, gewinnen oder verlieren und so das Handeln ihrer Benutzer - Bewohner wie Besucher - prägen, an3". Jede Stadt hat also ihre eigene Syntaktik, ihre charakteristische "Stadtsemantik", ihre urbane Pragmatik4. Was Mahler damit ausdrücken will, ist recht einfach. Jede Stadt hat ein gewisses Grundgerüst, das der Besucher zuerst abgeht. Jede Stadt besitzt die ihr typische Altstadt, nebenan die Fußgängerzone mit Einkaufsmöglichkeiten und daneben am besten der Bahnhof. Wer sich also in einer neuen Stadt orientieren möchte, hält sich zunächst an solche Zeichen und weist ihnen ihre Bedeutung zu: interessant, teuer, verschlafen etc. und richtet sein Handeln passend darauf ein: Hier kann ich essen, schlafen, leben; hier bleibe ich nicht lang etc. Die Kunst besteht darin,
die Stadt lesen und verstehen zu können, um sich in ihr wohlzufühlen. Allerdings ist die Stadt nicht nur selbst ein Text, jede Stadt hat auch ihre Texte. Mahler unterscheidet hier in zwei Arten von Texten - zuerst einmal in einen Text der Stadt, wie zum Beispiel Reiseberichte oder Städteführer, auf den es ihm hier aber nicht ankommt und in Texte über die (literarisch fiktive) Stadt. Er nennt diese Texte auch textuelle Stadtlektüren oder Stadttexte. Darunter versteht er "all jene Texte, in denen die Stadt ein - über referentielle bzw. semantische Rekurrenzen abgestüztes - dominantes Thema ist, also nicht Hintergrund, Schauplatz, setting für ein anderes
dominantes Thema, sondern unkürzbarer Bestandteil des Texts.5" Dieses Kriterium
thematischer Gebundenheit suggeriert nun, dass die Stadt schon vorher so wie sie beschrieben wird existent war, Mahler nennt dies eine "Vorgängigkeit" der Stadt; das heißt, es wird so getan, als ob diese im Text dargestellte und beschriebene Stadt bereits vorher existierte und nun nur nachgeahmt und abgebildet würde. Dies ist eindeutig die Illusion der Mimesis. Mahler stellt nun den umgekehrten Weg dar: die jeweilige Stadt war nicht bereits vorher da, sondern wurde erst durch den Text hervorgebracht und produziert. Die Resultate dieses Imaginationsprozesses nennt er im Gegensatz zu den Stadttexten, Textstädte. Allerdings stehen Stadttexte Textstädten nicht unbedingt oppositionell gegenüber. Vielmehr bringen literarische Stadttexte immer Textstädte hervor. Stadttexte sind also diejenigen Texte, deren sprachliche Strukturen und Strategien dominant darauf ausgerichtet sind, Textstädte zu produzieren.
Jeder isolierte Text beginnt mit einem sogenannten "informatorischen Vakuum". Er ist also situationslos und der Leser muss zuerst eine Situation herstellen. Dies geschieht dadurch, dass der Text eine Reihe von Informationen gibt, wo, wie und wann sich alles "abspielt", wer die Protagonisten sind, um welche Konflikt es geht etc. Entsprechend bald entscheidet sich dann der Leser, ob es sich beim gelesenen Text um einen Stadttext handelt. Hierfür ist die Technik der Referentialisierung wichtig.
2.1 Referentielle Stadtkonstitution
Eine erste Signalisierung enthält oftmals der Titel. Bei "El invierno en Lisboa" von Muñoz Molina ist es klar, dass der Text, zumindest ein Teil des Textes sich in der portugiesischen Hauptstadt abspielt. Doch auch wenn nicht gleich der Titel auf eine bestimmte Stadt hinweist, so reicht es doch aus, am Anfang auf sie zu verweisen und sie klar zu benennen, damit sich der Leser sein Bild formt. In "Mañana el la batalla piensa en mí" wird der Name der Stadt Madrid und auch Londons auf S. 28 genannt:
"También dormiría el marido desentendido en Londres (... ) por qué no llamaba buscando consuelo a Madrid, a casa, para encontrarse allí...6" Somit stellt sich der Leser schon einmal auf eine Geschichte ein, die in der spanischen Hauptstadt spielt. Mit der Nennung der Stadt allein, sind dennoch nicht alle Referentialisierungs- möglichkeiten ausgeschöpft. Jeder Leser stellt sich unter "Madrid" ein anderes Stadtbild vor, auch wenn es sich vordergründig um die gleiche Stadt dreht.
Vier Seiten weiter, auf S. 32 werden genauere Straßenzüge Madrids genannt, "...cruzando Reina Victoria y caminando un poco por General Rodrigo para desentenderme, antes de coger un taxi," Die genannten Straßen bilden noch kein typisches Stadtbild, doch sie grenzen den Rahmen immerhin schon etwas ein. Es handelt sich um belebte Straßen im Norden Madrids, einer normalen Wohngegend, woraus zu schließen ist, dass es sich vorerst um "normale" Protagonisten handelt.
Wenn eine Textstadt konstituiert wird, kann der Text sie nie vollständig beschreiben, viele der Merkmale bleiben im Dunkeln. Bei Nennung einer realen Stadt kann der Leser diese "Leerstellen"7 mit seinem Weltwissen und seinen Erfahrungen füllen. Im vorliegenden Fall spielt die Geschichte in Madrid; aber nur weniges wird abgerufen, was wir von Madrid kennen - dies kann der Leser durch sein Vorwissen über Madrid ersetzen. Bei einer völlig fiktiven Stadt sind die Leerstellen nur durch rein subjektive Vorstellungen des Lesers zu füllen.
Diese Art der Referentialisierung ist eine weit verbreitete Methode, da sie bekannte Bilder beim Leser abruft ohne sie zu nennen und somit einen Rahmen vorgibt. Eine prototypische Stadtkonstitution für Madrid wäre die Puerta del Sol, die Plaza de España, der Prado oder der Königspalast (der hier allerdings auch genannt wird). Andere prototypische Stadtkonstitutionen, abgesehen von den Bauwerken und Sehenswürdigkeiten, sind zum Beispiel Naturbesonderheiten. In diesem Roman allerdings, der in Madrid spielt, spielen Naturbesonderheiten eine kleinere Rolle, da weder Madrid noch London besondere Naturbesonderheiten haben. Sicherlich verweist Marías bei seiner Londonschilderung zwar auf den strömenden Regen, allerdings ist strömender Regen nicht gerade typisch für Groß Britannien, eher leichter Nieselregen und dieser Sturm ist hier wohl eher als semantisches Mittel um Eduardos Wut deutlich zu machen, eingesetzt worden. Generell kann man sagen, dass europäische Großstädte nicht unbedingt viel prototypische Naturbesonderheiten bieten. Europäische Naturbesonderheiten sind eher auf dem Land zu finden, wie zum Beispiel eine Dürre in Andalusien. Hier würde jedoch keine Großstadt betroffen sein, sondern eher die Bauern auf den Feldern.
Im Gegensatz zu dieser offenen Referentialisierung, bei der die Stadt genannt wird und alle möglichen Besonderheiten abgerufen werden, gibt es noch die verdeckte
[...]
1 Augé, Marc: Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris 1992
2 Mahler, Andreas: Stadttexte - " Textstädte. Formen und Funktionen diskursiver Stadtkonstitution", in: Mahler, Andreas (Hg.), Stadt-Bilder, Allegorie, Mimesis, Imagination, Heidelberg 1999, S.11-36
3 Mahler, S.11
4 Vgl. Roland Barthes nach Mahler, S.11
5 Mahler, S.12
6 Seitenangaben beziehen sich jeweils auf folgende Ausgabe: Marías, Javier: Mañana en la batalla piensa en mí, Madrid 1994
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung der postmodernen Stadt in Javier Marías' Roman "Mañana en la batalla piensa en mí", insbesondere anhand von Beschreibungen von "Nichtorten" nach Marc Augé.
Welche Fragen werden in der Einleitung aufgeworfen?
Die Einleitung fragt, ob der Roman typische postmoderne Strukturen aufweist, wie diese die Geschichte und die Leserauffassung beeinflussen, ob der Text spezifisch an Madrid gebunden ist oder in einer anderen Stadt spielen könnte, und warum die potentielle Ersetzbarkeit des Schauplatzes von Bedeutung ist.
Welche Texte sind für die Analyse besonders wichtig?
Die Texte von Andreas Mahler, "Stadttexte - Textstädte", und Marc Augé, "Orte und Nichtorte", sind für die Analyse von Bedeutung.
Was versteht Mahler unter "Stadttexte" und "Textstädte"?
Laut Mahler sind "Stadttexte" Texte, in denen die Stadt ein dominantes Thema ist. "Textstädte" sind Städte, die erst durch den Text hervorgebracht und produziert werden, im Gegensatz zur Illusion der Mimesis, bei der die Stadt als bereits existent dargestellt wird.
Was ist referentielle Stadtkonstitution?
Referentielle Stadtkonstitution bezieht sich auf die Art und Weise, wie eine Stadt im Text durch die Nennung von Namen, Orten oder Merkmalen konstruiert wird, wodurch der Leser sein eigenes Bild der Stadt formen kann.
Wie wird Madrid im Roman referentiell konstituiert?
Madrid wird durch die Nennung des Stadtnamens, bestimmter Straßenzüge wie Reina Victoria und General Rodrigo sowie des Königspalastes referentiell konstituiert. Der Leser kann "Leerstellen" durch sein Vorwissen über Madrid füllen.
Was ist der Unterschied zwischen offener und verdeckter Referentialisierung?
Offene Referentialisierung nennt die Stadt und ruft bekannte Bilder ab, während verdeckte Referentialisierung dies nicht tut.
- Arbeit zitieren
- Susana Catalina Prat (Autor:in), 2004, Darstellung der (post)modernen Lebenswelt in "Manana en la, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/108980