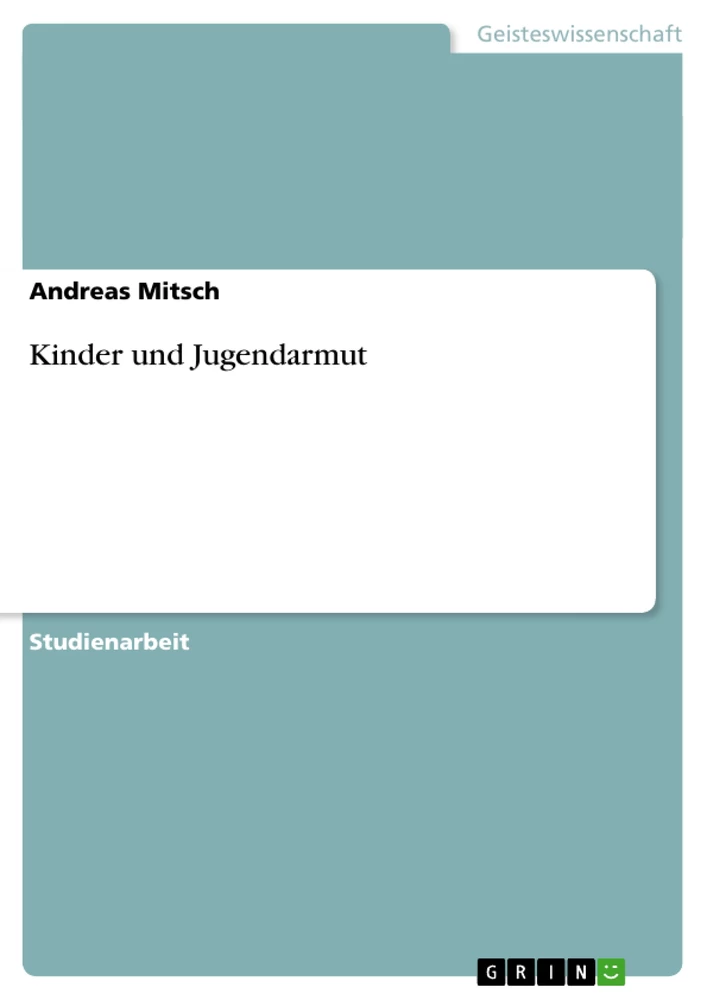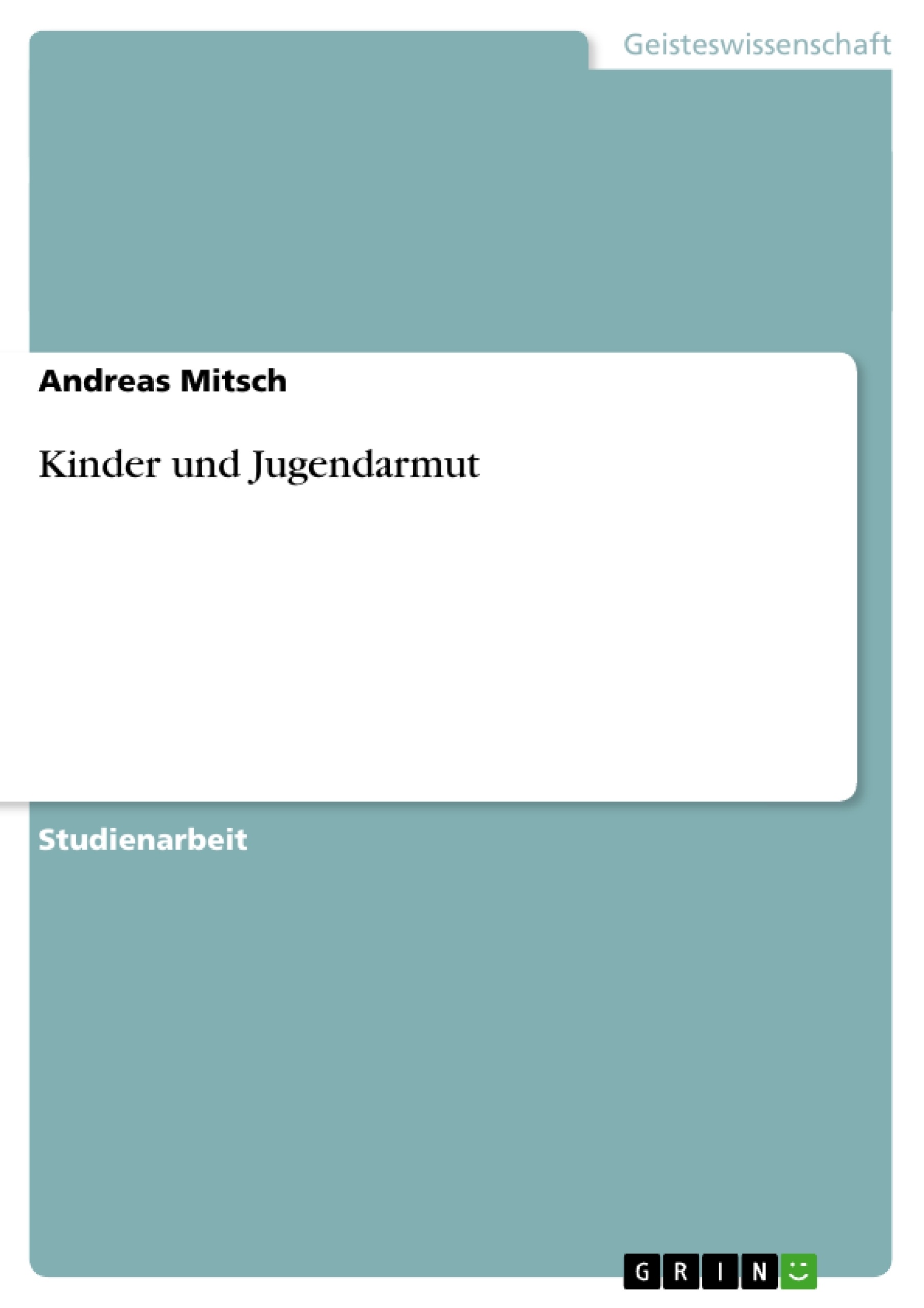Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Formen der Armut und deren Definition
2.1 Absolute Armut
2.2 Relative Armut
2.3 Nichtmaterielle Armut
3. Entwicklung der Armut
4. Bekämpfte und verdeckte Armut
5. Signale für Kinderarmut
6. Ursachen für Kinderarmut
7. Auswirkungen von Kinderarmut
7.1 Kindersterblichkeit und Gesundheit
7.2 Psychische Störungen
7.3 Soziale Handicaps
7.4 Bildung
8. Wie will die Bundesregierung mit Hilfe der Agenda 2010 der Kinderarmut und ihren Auswirkungen entgegentreten?
8.1 Ausbau der Kinderbetreuung
8.2 Kinderzuschlag für geringverdienende Eltern
8.3 Steuerentlastungen für Alleinerziehende
8.4 Vorteile für Jugendliche
9. Aussagen und Expertenmeinungen über die Auswirkungen der Agenda 2010 auf Kinder
10. Schlussbemerkung
11. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Kinderarmut in Deutschland lange totgeschwiegen und doch gibt es sie, auch hier mitten unter uns. Man erkennt sie aber nicht sofort, denn hungerleidende Straßenkinder wie wir sie aus der dritten Welt kennen, leben in Deutschland nicht. Arme Kinder laufen auch nicht mit zerrissener Kleidung herum und sie haben fast alle ein Dach über dem Kopf und meist auch ausreichend Nahrung zur Verfügung.
Ich wollte mich mit diesem Thema auseinandersetzen weil ich finde, dass Kinderarmut eine schreiende Ungerechtigkeit verkörpert. Denn für diese armen Kinder werden Weichen gestellt die früher oder später aufs Abstellgleis führen. Also d.h., diese unschuldigen Kinder, denn Kinder sind in meinen Augen immer unschuldig, bekommen Vorraussetzungen auferlegt mit denen sie einfach keine oder keine große Chance haben, später mal ein „normales“ Leben führen zu können. Mit einem normalen Leben meine ich, ein Leben welches den gesellschaftlichen Werten und Normen entspricht oder wenigstens annähernd gerecht wird.
2. Formen der Armut und deren Definition
Meine Suche nach einer Definition von Kinderarmut in verschiedensten Büchern und im Internet blieb erfolglos. Dies ist, meiner Meinung nach, zum einen darin begründet, dass es für den Begriff Armut keine allgemeingültige Definition gibt. Da diese soziale Bewertung und Begriffsbestimmung regional, gesellschaftlich und geschichtlich variiert (vgl. Kaller 2001, S.36). Zum andern verschmilzt die Armut der Eltern mit deren Kindern, d.h. sind die Eltern arm so sind deren Kinder gleichzeitig davon betroffen.
Aus diesem Grund werde ich nun die wichtigsten allgemeinen Armutsdefinitionen aufführen.
2.1 Absolute Armut
Bei dieser Form der Armut stehen nicht die Mittel zur Verfügung, welche die Befriedigung primärer Bedürfnisse, wie z.B. Nahrung, Kleidung und Wohnung gewährleisten können.
Dieser Typ der Armut ist verstärkt in Entwicklungsländern anzutreffen. Er ist ein besonders bedrohliches Problem für Kinder, welches sich u.a. in einer hohen Kindersterblichkeit durch Unterernährung zeigt (vgl. Joos 1998, S.20).
Absolute Armut lässt sich nur in verschwindend geringem Maße in den westlichen Industrieländern nachweisen. Daher ist ein relativer Armutsbegriff hier wichtiger als ein absoluter (vgl. Kaller 2001, S.36).
2.2 Relative Armut
Laut EU sind Personen als relativ arm zu bezeichnen, deren Haushalt über höchstens 50% des durchschnittlichen Haushaltseinkommens des jeweiligen Landes verfügt (vgl. Kaller 2001, S.37).
Gemessen an diesem 50% Kriterium waren im Jahr 2000 ca. 9,1% der Bevölkerung Deutschlands arm, davon 32% Kinder und Jugendliche im Alter von bis zu 20 Jahren. Wird die 50% Schwelle auf 75% (prekärer Wohlstand) erhöht so kann man 34,3% aller Bundesbürger als arm bezeichnen (Datenreport 2002, S.587).
Werden genannte „Zahlen- und Verhältnisdefinitionen“ außer Acht gelassen, liegt relative Armut sozialwissenschaftlich definiert dann vor, „wenn Teile der Bevölkerung über so wenig Einkommen und/oder Vermögen verfügen, dass sie das Maß an Lebenschancen, Lebenskomfort und Selbstrespekt, das die Gemeinschaft, der sie angehören, als normal ansieht, entbehren müssen“(zit. Bolte 2001, S.37).
Des weiteren möchte ich die freiwillige Armut hier erwähnen, welche die eigene Entscheidung zum Verzicht auf einen bestimmten Lebensstandard aus Glaubens- und Überzeugungsgründen erklärt.
2.3 Nichtmaterielle Armut
Erweitert man die Sichtweise und schaut über die rein materielle Armutsdefinition hinaus, so werden andere Facetten von Armut sichtbar. Zu nennen sind hier u.a. die Zeitarmut. Die Erziehenden haben einfach zu wenig Zeit oder nehmen sich zu wenig Zeit sich mit ihren Kindern zu beschäftigen. Als zweite Form nichtmaterieller Armut möchte ich die Beziehungsarmut aufführen. Hiervon sind Kinder betroffen die körperliche und/oder seelische Gewalt erleiden. Aber auch Kinder die z.B. in Alleinerziehenden Haushalten oder bei Stieffamilien leben und frühzeitig zum Erwachsenwerden gedrängt werden (vgl. www.kija.at Stand 03.2004).
3. Entwicklung der Armut
Weil eine nationale Armutsberichterstattung fehlt, liefert die Statistik der Sozialhilfe die einzigsten Datenreihen zur Armutsentwicklung über große Zeiträume. Diese Statistiken können zur Auswertung der Armutsentwicklung genommen werden, da nur die Personen in der Bundesrepublik Deutschland als arm gelten, die einen Anspruch auf Sozialhilfe besitzen (vgl. u.a. Joos 1998, S.21).
Das steigende Wirtschaftswachstum führte Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre zu einer Verbesserung der Beschäftigungssituation und demzufolge auch zu einer Wohlstandsmehrung in der Bevölkerung. Diese glückliche Situation führte dazu, dass die Zahl der Sozialhilfeempfänger von 1,6 Millionen im Jahre 1950 auf 510.000 im Jahre 1969 sank. Dieser positive Trend kehrte sich, allen Erwartungen entgegen, um und in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten rutschten ohne Unterbrechung immer mehr Menschen in die Sozialhilfe ab. Schon 1982 wurde die Millionengrenze durchbrochen und genau zehn Jahre später verzeichnete die Sozialhilfestatistik zwei Millionen Sozialhilfeempfänger. Der höchste Stand an Sozialhilfehilfeempfängern war mit 2,89 Millionen im Jahre 1997 zu verzeichnen (vgl. Geißler 2002, S.249).
Im Jahr 2001 bezogen in Deutschland rund 2,7 Millionen Bundesbürger laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, d.h. Sozialhilfe im engeren Sinne. Davon waren 37% Kinder im Alter von 0 bis 17 Jahre.
Von 1,4 Millionen Haushalten, die im Jahre 2002 Sozialhilfe empfangen haben, waren 23,5% alleinerziehende Frauen und 9,7% Ehepaare mit Kindern. Im Vergleich dazu waren 21,6% aller Sozialhilfe beziehenden Haushalte von alleinstehenden Frauen und 7,6% von Ehepaaren ohne Kindern, bewohnt. ( Faltblatt, Sozialhilfestatistik 2003 ).
Diese Daten zeigen eindeutig, dass Kinder das Armutsrisiko erhöhen. Sie zeigen aber nicht die tatsächliche Anzahl an armer Bevölkerung, sondern nur die Anzahl an Bundesbürgern die in bekämpfter Armut leben.
4. Bekämpfte und verdeckte Armut
Aus Sicht der Regierung gibt die Sozialhilfe einen Überblick über die bekämpfte Armut. Mit diesem Begriff soll betont werden, dass „Menschen, die Leistungen der Sozialhilfe beziehen nicht mehr als arm zu bezeichnen sind. Die Leistungen der Sozialhilfe definieren normativ die amtliche Armutsgrenze“ (Adamy 1998, S.8).
Ich denke, hätte Adamy das Buch drei Jahre später veröffentlicht so würde diese Aussage sicherlich nicht in dem Buch zu finden sein. Da laut Statistischem Bundesamt das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen im Jahr 2000 bei 1.193 Euro lag und im Gegensatz dazu jedem Sozialhilfeempfänger im gleichen Jahr nur 477 Euro zu Verfügung standen. Aus diesen Werten wird erkenntlich, dass Sozialhilfeempfänger nur über 40% des durchschnittlichen Nettoeinkommens verfügen. Diese 40% Schwelle wird laut EU als strenge Armut bezeichnet.
Wie schon im Punkt 3 erwähnt, sind die Zahlen der Sozialhilfestatistik aber mit Vorsicht zu genießen, da sie nicht die wirkliche Zahl Derer wiederspiegelt, die einen Anspruch auf Sozialhilfe besitzen, sprich arm sind. Dies ist u.a. darin begründet, dass nicht jeder der einen Anspruch auf Sozialhilfe hat, diesen auch wahrnimmt und ist insofern als verdeckt arm zu bezeichnen. Schätzungen zufolge nimmt jede dritte Person welche einen Anspruch auf Sozialhilfe hat, diesen nicht wahr (vgl. Joos 1998, S.21), nach Neumann sogar jeder Zweite (vgl. Geißler 2003, S.249).
Gründe für diese Nichtinanspruchnahme sind zum einen Unwissenheit darüber, dass ihnen in solch einer Armutssituation Sozialhilfe zusteht, zum anderen gehen viele Bürger nicht zum Sozialamt weil sie sich schämen, sie denken dann Almosenempfänger zu sein, oder sie möchten auch verhindern, dass Verwandte zu finanziellen Mithilfe durch das Sozialamt verpflichtet werden (vgl. Geißler 2003, S.249).
5. Signale für Kinderarmut
Im folgenden möchte ich ein paar Anzeichen beleuchten die auf eine mögliche Armutssituation hinweisen können.
Ein Anzeichen für Armut kann sein, wenn Kinder, besonders Montags, die im Kindergarten angebotenen Speisen in kürzester Zeit verzehren. Dies zeigt, dass diese Kinder besonders nach dem Wochenende hungrig sind. Daraus kann eine gewisse Mangelernährung abgeleitet werden die einer Armutssituation entspringt. Ein weiterer Hinweis auf eine mögliche Armutssituation kann sein, wenn Kinder plötzlich Einladungen zu Kindergeburtstagen ablehnen oder vom Hortbesuch abgemeldet werden. Der Grund hierfür kann darin liegen, dass die Eltern einfach kein Geld zum Kauf von Geschenken oder für den Beitrag zum Hortbesuch zur Verfügung haben.
LehrerInnen haben zum Beispiel beobachtet, dass zunehmend Kinder seltener Frühstück mitbringen und mittags bei der Schulspeisung nach Essensresten fragen. Größtenteils tragen diese Schüler einfache aber saubere und ordentliche Kleidung, jedoch keine Markenware. Wenn Schüler an Ausflügen und Klassenfahrten nicht teil nehmen und dafür Entschuldigungen wegen Bauch- oder Zahnschmerzen vorlegen so kann dies ein weiterer Hinweis auf einen möglichen Mangel sein. Da viele Eltern den wahren Grund, nämlich fehlendes Fahrgeld, aus Scham verschweigen.
Des weiteren beobachten Kinderärzte, dass die in den Praxen aufgestellten Kleiderspendenboxen und angebotenen Nahrungsproben zunehmend in Anspruch genommen werden. Die Kinderärzte werden auch verstärkt darum gebeten Atteste nachträglich für das Fehlen an Schulausflügen auszustellen (vgl. www.oerbb.de, Stand 03.2004).
6. Ursachen für Kinderarmut
Kinderarmut erscheint in vielen Facetten und sie ist letztendlich fast immer auf die Armut der Familie zurückzuführen in der die Kinder leben.
Arbeitslosigkeit und Niedrigeinkommen sind in erster Linie die auslösenden Faktoren für die Verarmung der Familien (vgl. www.kija.at, Stand 03.2004). Dabei muss erwähnt werden, dass gerade Kinder ein erhöhtes Risiko für diese beiden Faktoren darstellen. Diese Aussage kann ich treffen, da zum einen die im Punkt: “Entwicklung der Armut“ aufgeführten Daten der Sozialhilfestatistik für sich sprechen. Zum anderen habe ich zwei Beispiele dafür in meinem Bekanntenkreis zu benennen, wo junge Mütter nach Beendigung ihres Mutterschaftsurlaubs in ihrem alten Job nicht weiterarbeiten durften. Eine der beiden ist immer noch arbeitslos, nun schon mit dem zweiten Kind und die Andere geht halbtags als Verkäuferin arbeiten. Beide sind zum Glück nicht alleinerziehend.
Die Zunahme alleinerziehender Familien trägt ebenfalls zur Steigerung der Kinderarmut mit bei. Mittlerweile gibt es schon in 17% aller Familien der Bundesrepublik nur einen Vater oder eine Mutter. Von diesen eben genannten Familien lebt etwa ein Drittel an der Armutsgrenze (vgl. Klocke 2001, S15). Aufgrund der Arbeitsmarktlage und der Belastung durch Kinderbetreuung haben diese 17% häufig nicht die Möglichkeit, das Familieneinkommen mit Erwerbsarbeit sicherzustellen. Das wiederspiegelt sich auch in den aktuellen Zahlen der Bundesregierung. Die soviel sagen, dass 4,2% aller Haushalte Einelternhaushalte sind und von diesen 30,6% in relativer Armut und 67% in prekärem Wohlstand leben. Alleinerziehende tragen somit das größte Armutsrisiko im Vergleich zu Paarhaushalten ohne Kind wo nur 3,7% in relativer Armut und 18,5% in prekärem Wohlstand lebt (vgl. Datenreport 2002, S.590).
Des weiteren benötigen Kinder für ihren Lebensunterhalt beträchtliche finanzielle Aufwendungen. Zu den Lebenshaltungskosten müssen ebenfalls noch die nur schwer zu errechnenden Opportunitätskosten der Kinderbetreuung gerechnet werden, zu denen entgangenes Erwerbseinkommen bei Aufgabe oder Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, verlorene Karrierechancen oder der Verlust von Sozialleistungsansprüchen zählen. Haushalte mit Kindern stehen dadurch vor dem doppelten Problem, den zusätzlichen Einkommensbedarf für Kinder bei gleichzeitig eingeschränkten Erwerbsmöglichkeiten abzudecken (vgl. Andreß 2001, S.30).
7. Auswirkungen von Kinderarmut
Im folgenden werden einige Auswirkungen von Armut bei Kindern beschrieben, die - wenn auch nicht immer ausschließlich- auf Einkommensarmut zurückgeführt werden können.
Kindersterblichkeit und Gesundheit
Arme Kinder sind öfter krank, nässen länger ein, leiden häufiger unter psychosomatischen Erscheinungen wie Ekzemen oder Magen-Darm-Problemen, als Kinder aus nicht einkommensarmen Familien (Hunfeld 1998, S.91).
Sozial-Epidemiologie, die sich mit der empirischen Erfassung und Erklärung von Unterschieden im Gesundheitszustand zwischen den Bevölkerungsgruppen befasst, ist in Deutschland ein vernachlässigtes Forschungsfeld, so dass zur Beleuchtung von Zusammenhängen zwischen Armut und Gesundheit zum Teil auf über 35 Jahre alte Erhebungen zurückgegriffen werden muss. Alle Untersuchungen belegen jedoch einen deutlichen Zusammenhang zwischen Unterversorgungslagen bei der Bildung der Eltern und der Gesundheit der Kinder (Mielck 2001, S230/231).
So zeigen Untersuchungen, dass bei Frauen mit Sonderschulausbildung dreimal mehr Totgeburten vorkommen als bei Frauen mit Abitur. Ein ähnliches Verhältnis ist bei der Kindersterblichkeit in der ersten Woche zu verzeichnen (vgl. Tab.).
Schulbildung und Perinatale Mortalität
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1: Totgeborene und in den ersten sieben Lebenstagen Gestorbene pro 1000 Geborene
Quelle: Mielck 2001, S.232
Den Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und Gesundheit bei Schulkindern zeigt die folgende Tabelle. Zur Bestimmung der sozialen Schicht wurden ein Index aus: Ausbildung und Beruf der Eltern, Anzahl der PKW in der Familie, Anzahl der durchgeführten Urlaube pro Jahr und aus der Tatsache ob jedes Kind ein eigenes Zimmer hatte oder nicht, gebildet.
Soziale Schicht und Gesundheit bei Kindern
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Daten: Befragung von 3328 Schülern (11-15Jahre) 1994 in Nordrhein-Westfalen
Quelle: Mielck 2001, S.237
Darüber hinaus ist die Zahngesundheit von Unterschichtkindern erheblich schlechter als von Oberschichtkindern. Ebenso sind Kinder aus einkommensarmen Schichten von schweren Asthmaanfällen stärker betroffen. Der Gesundheitszustand von Haupt- und RealschülerInnen ist erheblich schlechter als der von GymnasiastInnen, gemessen an Krankenhausaufenthalten, Unfällen und der Zahl notwendiger ärztlicher Behandlungen.
Als Erklärungen für diesen Zusammenhang von Armut und der erhöhten gesundheitlichen Beeinträchtigung von Kindern wird zum einen das Gesundheitsverhalten der Eltern und Kinder sowie die mangelnde Wahrnehmung von Früherkennungsuntersuchungen angeführt, zum anderen wird auf die höheren Kosten einer gesunden Lebensweise verwiesen, welche beispielsweise durch eine gesunde und ausgewogene Ernährungsweise, eine unbelastete Wohngegend und regelmäßige Urlaube entstehen (vgl. Mielck 2001, S.237 ff).
7.2 Psychische Störungen
Das Risiko, dass Eltern die lange Zeit in Armut leben sich aufgeben, ist sehr hoch. Kommt es zu solch einer Selbstaufgabe tritt im gleichen Zug meistens eine mangelnde Fürsorge auf, die sich negativ auf die gesamte Entwicklung des Kindes auswirkt.
Diese Eltern sprechen wenig mit ihren Kindern, der Fernseher wird zum Gesprächsersatz und es kommt zu einer nicht altersgerechten Sprachentwicklung.
Die mangelnde Fürsorge der Eltern zeigt aber nicht nur Auswirkungen auf die sprachliche Entwicklung sondern auf die gesamte Psyche des Kindes. Diese Kinder leiden verhältnismäßig viel an Schlaf- und Essstörungen, sie zeigen oft emotionale Störungen und Auffälligkeiten, sie weisen häufig Konzentrationsschwierigkeiten beim Spielen und Lernen auf und sind trotz einschulreifem Alter vielfach noch nicht schulreif (vgl. www.oerbb.de, Stand 03.2004, S.5 ).
7.3 Soziale Handicaps
Sozial benachteiligte Kinder werden oft ausgegrenzt und haben dem zufolge weniger soziale Kontakte zu Gleichaltrigen. Dies liegt u.a. darin begründet, da sie keine oder nur wenig Einladungen zu Kindergeburtstagen aussprechen und wahrnehmen können. Außerdem können die Kinder selten Vereinen beitreten da das Geld für die Mitgliedsbeiträge fehlt. Reisen und Ausflüge werden nicht unternommen, da trotz Vergünstigungen für Kinder, das Geld für einen Besuch im Zoo oder im Museum fehlt (vgl. www.oerbb.de, Stand 03.2004, S.6 ).
Arme Familien müssen in preiswerten meist kleinen Wohnungen leben, die aber häufig nur in Massensiedlungen am Rande großer Städte zu finden sind. Dieses Leben ist entweder eine strukturell (Mietpreise) oder behördlich (Einweisung durch Kommune) erzwungene Ausgrenzung. Aus dieser räumlichen Ausgrenzung entsteht durch das dort vorherrschende Umfeld eine soziale Ausgrenzung (vgl. www.drk.de, Stand 03.2004, S.13).
7.4 Bildung
Wie eben genannt leben arme Kinder oft in beengten Wohnverhältnissen. Dadurch haben sie meist kein eigenes Zimmer zur Verfügung wo in Ruhe Schularbeiten erledigt werden könnten. Aus diesem Mangel geraten Schularbeiten meist ins Hintertreffen. Das kann zur Folge haben, dass kein Schulabschluss erreicht wird und deshalb auch kaum Aussichten auf einen Ausbildungsplatz vorhanden sind (vgl. www.drk.de, Stand 03.2004, S.13 ).
Es besteht außerdem ein deutlicher Zusammenhang zwischen sozialer Stellung und der Aufnahme eines Studiums. Nach den von der Sozialerhebung gebildeten vier sozialen Herkunftsgruppen (niedrig, mittel, gehoben, hoch) hat sich die Zusammensetzung der Studierenden von 1982 bis 2000 stark geändert. Der Anteil an Studierenden der höchsten Herkunftsgruppe hat sich von 17% auf 33% fast verdoppelt. Wo hingegen sich die Anteile der beiden unteren Schichten sichtlich verringerten. In Zahlen verdeutlicht ging der Anteil der mittleren Schicht von 34% auf 28% zurück und der Anteil der unteren Herkunftsgruppe halbierte sich fast in den 18 Jahren von 23% auf 13% (www.studentenwerke.de, Stand 03.2004, S.9).
8. Wie will die Bundesregierung mit Hilfe der Agenda 2010 der Kinderarmut und ihren Auswirkungen entgegentreten?
Die Bundesregierung will Voraussetzungen schaffen, damit sich wieder mehr Menschen in Deutschland für Kinder entscheiden, da die Zahl der Geburtenraten seit Jahren rückläufig ist. Dazu gehört neben verbesserten Kinderbetreuungs- möglichkeiten und der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch eine zielgenaue finanzielle Förderung von Familien.
8.1 Ausbau der Kinderbetreuung
Ein Kernpunkt der Familienpolitik der Bundesregierung wird es sein, das Angebot in der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren auszubauen. Finanziert wird dies von den Ländern und Kommunen. Die dafür benötigten Mittel werden aus Einsparungen gewonnen, die bei der Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe entstehen werden. Konkret sollen ab 2005 jährlich bis zu 1,5 Milliarden Euro in den Betreuungsaufbau investiert werden. Ziel ist es im Jahr 2010 eine bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung zu gewährleisten. Die rechtlichen Grundlagen der Finanzierung werden in Art. 29 und 30 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt geschaffen (vgl. www.bmfsfj.de, Stand 03.2004).
8.2 Kinderzuschlag für geringverdienende Eltern
Gering verdienende Eltern, die mit ihren Einkünften zwar ihren eigenen Unterhalt finanzieren können, nicht aber den Unterhalt ihrer Kinder, erhalten künftig einen Kinderzuschlag von bis zu 140 Euro pro Monat. Das über dem Elternbedarf liegende Erwerbseinkommen wird zu 70 Prozent auf den Zuschlag angerechnet.
Von diesem Zuschlag der am 1. Januar 2005 in Kraft tritt und maximal drei Jahre gezahlt wird, werden ca. 150.000 Kinder profitieren (vgl. www.bmfsfj.de, Stand 03.2004).
8.3 Steuerentlastungen für Alleinerziehende
Echte Alleinerziehende (Eltern die in keiner festen Partnerschaft leben) sind einer höheren finanziellen Belastung als Paare mit Kinder ausgesetzt. Deshalb gilt für Sie ab Beginn diesen Jahres ein dauerhafter Steuerfreibetrag in Höhe von 1.300 Euro pro Jahr. So entsteht eine Steuerersparnis in Höhe von 300 Mio. Euro von der ca. 957.000 Alleinerziehende profitieren. Dieser neue Entlastungsbetrag soll den Haushaltsbedingten Mehraufwand berücksichtigen und gleichzeitig Ausgleich, für den seit diesem Jahr weggefallenen Haushaltsfreibetrag sein (vgl. www.bmfsfj.de , Stand 03.2004).
8.4 Vorteile für Jugendliche
Gemäß der Leitlinie, „Fördern Fordern“ sollen alle erwerbsfähigen arbeitslosen Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren in eine Arbeit, eine Ausbildung, eine Arbeitsgelegenheit oder eine entsprechende Maßnahme vermittelt werden.
Jeder Jugendliche erhält ein entsprechendes Angebot von einem JobCenter der Agentur für Arbeit. Wird dieses abgelehnt oder eine angebotene Arbeit, Ausbildung oder andere Maßnahme abgebrochen so hat dies Konsequenzen auf den Leistungsanspruch. Dies sieht so aus, dass unter 25-Jährige eine 3-Monatige Sperre erhalten, für über 25-Jährige wird in einem solchen Fall das Arbeitslosengeld II um 30 Prozent gekürzt.
Spezielle Fallmanager der Agentur für Arbeit betreuen und beraten die arbeitslosen Jugendlichen und bieten bei Bedarf Qualifizierungen an, welche die Jugendlichen wieder in Lohn und Brot bringen sollen (vgl. www.bmfsfj.de , Stand 03.2004).
9. Aussagen und Expertenmeinungen über die Auswirkungen der Agenda 2010 auf Kinder
Aussagen und Meinungen hinsichtlich der Auswirkungen von Agenda 2010 auf Kinder. Mitgeteilt von Experten in einem Radiobeitrag des Deutschlandradio Berlin am 26.12.2003.
Heinz Hilgers, Präsident des Kinderschutzbundes, befürchtet durch die Agenda 2010 einen drastischen Anstieg der Kinderarmut. Er vertritt die Meinung, dass sich die Zahl der Kinder die von Sozialhilfe oder auf diesem Niveau leben, von etwa 1 Million auf 1,5 Millionen erhöht und das ist der höchste Stand seit dem 2.Weltkrieg. Außerdem teilte er mit, dass sich in den letzten 30 Jahren die Zahl der Kinder die von Sozialhilfe leben verdreifacht hat wobei gleichzeitig die Kinderzahl sank. Für die Stadt Bremen bedeutet dies letztendlich, dass ein Drittel der Kinder von Sozialhilfe leben wird (vgl. www.dradio.de, Stand 03.2004).
Manfred Ragati, Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, geht davon aus, dass der Arbeitsmarkt derzeit nicht die Ressourcen hat Arbeitsplätze zu schaffen. Viele die dann im Arbeitslosengeld II sind, werden sich nach der Übergangsphase auf Höhe der Sozialhilfe sehen, d.h. sie werden keine Arbeit finden (vgl. www.dradio.de, Stand 03.2004).
Bundesfamilienministerin Renate Schmidt verteidigt die Einführung des Arbeitslosengeld II. Aus ihrer Sicht werden 220.000 Menschen bei der Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe ins Arbeitslosengeld II kommen. Aber nicht all diese Menschen werden dadurch weniger im Portemonnaie haben. Viele bekommen dadurch mehr finanzielle Unterstützung, da sie weniger Arbeitslosenhilfe bezogen als ihnen Sozialhilfe zustand.
Die Bundesregierung hat das Problem Kinderarmut aber erkannt und hat ein konkretes Instrument zu deren Bekämpfung angekündigt. Dieses Instrument heißt Kinderzuschlag, welcher in dieser Arbeit schon näher beleuchtet wurde (vgl. www.dradio.de, Stand 03.2004).
Heinz Hilgers glaubt nicht, dass der geplante Kinderzuschlag helfen werde. Da nur Familien davon profitieren die einen Billigjob haben. Außerdem werden von jeden verdienten zehn Euro die über der Bedarfsgrenze liegen sieben Euro abgezogen und das Ganze ist nur auf zwei Jahre beschränkt obwohl die Erziehung eines Kindes mindestens 18 Jahre dauert (vgl. www.dradio.de, Stand 03.2004).
Christoph Butterwegge, Professor für Politik an der Universität Köln, ist der Meinung, dass die Bundesregierung einerseits die richtigen Schritte, hinsichtlich auf den Ausbau der Kinderbetreuung geht. Andererseits wird man den Menschen Kürzungen zumuten, die von der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau absinken. Dieses Loch möchte die Bundesregierung mit Hilfe des Kinderzuschlags kompensieren. Das erinnert daran, den Betroffenen in die eine Tasche etwas zustecken und ihnen aus der anderen Tasche umso mehr herauszunehmen. Er ist der Meinung, dass die Armut durch Agenda 2010 zunehmen werde (vgl. www.dradio.de, Stand 03.2004).
Ich befürchte ebenfalls, dass durch die Agenda 2010 die Armut in Deutschland zunehmen wird. Da dies in meinen Augen keinesfalls eine Reform ist, sondern nur eine Gesetzesänderung welche die Beschneidung sozialer Hilfen legalisiert.
10. Schlussbemerkung
In Bezug auf das Armutsproblem, müsste es in allen Bereichen der Gesellschaft den Versuch geben, ein Klima zu schaffen, welches der Armut entgegenwirkt. Solange aber Konkurrenz und Leistung hochgehalten werden und Armut als so eine Art funktionale Bestrafung derjenigen angesehen wird, die zu faul oder zu unfähig sind, solange ein solches Klima herrscht, wird sich politisch nichts verändern lassen. Also d.h. es müsste ein Bewusstseinswandel stattfinden, durch die ganze Gesellschaft hindurch. Nur wenn das stattfindet, hätte man eine Chance Armut wirklich zu bekämpfen und das auch mit Erfolg (vgl. www.dradio.de, Stand 03.2004).
11. Literaturverzeichniss
Adamy, W., Steffen, J.: Abseits des Wohlstandes, Primus Verlag, Darmstadt 1998
Andreß, H. J.; Lipsmeier, G.: Kosten von Kindern – Auswirkungen auf die Einkommensposition und den Lebensstandart der betroffenen Haushalte, in Klocke, A.; Hurrelmann, K.: Kinder und Jugendliche in Armut, Westdeutscher Verlag 2001
Bolte, K. M.: Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik, in Kaller, P. (Hrsg.): Lexikon Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Sozialrecht, Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim 2001
Datenreport der Bundesregierung 2002
Geißler, J.: Die Sozialstruktur Deutschlands, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 2002
Hunfeld, F.: ,,Und plötzlich bist Du arm". Geschichten aus dem neuen Deutschland, Rowohlt Verlag, Reinbeck bei Hamburg 1998
Joos, M.; Meyer, W.: Die Entwicklung der relativen Einkommensarmut bei Kinder in Deutschland 1990 bis 1995, in Mansel, J.; Neubauer, G. (Hrsg.): Armut und soziale Ungerechtigkeit bei Kindern; Leske + Budrich Verlag, Opladen 1998
Kaller, P.: Lexikon Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Sozialrecht, Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim 2001
Klocke, A.; Hurrelmann, K.: Kinder und Jugendliche in Armut, Westdeutscher Verlag 2001
Mielck, A.: Armut und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen: Ergebnisse der sozial- epidemiologischen Forschung in Deutschland, in Klocke, A.; Hurrelmann, K.: Kinder und Jugendliche in Armut, Westdeutscher Verlag 2001
Quellen
Bmfsfj: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Presse/pressemitteilungen,did=6466.html
Faltblatt, Sozialhilfestatistik 2003, Statistisches Bundesamt http://www.destatis.de/presse/deutsch/pk/2003/soz_faltblatt_i.pdf
Dradio: Deutschlandradio Berlin http://www.dradio.de/dlf/sendungen/hintergrundpolitik/223800/
DRK: Deutsches Rotes Kreuz http://www.drk.de/jrk/unterrichtsmaterialien/kinder_jugendarmut/UE%202003-Inhalt.pdf
Kija: Kinder und Jugendanwaltschaften Österreichs http://www.google.de/search?q=cache:TLXE9K3K6tYJ:www.kija.at/archiv/kinderarmut/kinderarm.html++Definition+Kinderarmut+und+Armutsmessung&hl=de&ie=UTF-8
Oerbb: Ökumenische Kirchenrat Berlin- Brandenburg http://www.oerbb.de/ORBBHome/Okumenetexte/Texte_des_ORBB/Signale_der_Kinderarmut.pdf
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Dokuments?
Das Dokument befasst sich hauptsächlich mit Kinderarmut in Deutschland, ihren verschiedenen Formen, Ursachen, Auswirkungen und den Maßnahmen, die die Bundesregierung zur Bekämpfung dieser Armut ergreift. Es werden auch Expertenmeinungen über die Auswirkungen der Agenda 2010 auf Kinder diskutiert.
Welche Formen der Armut werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet zwischen absoluter Armut, relativer Armut und nichtmaterieller Armut. Absolute Armut bezieht sich auf den Mangel an grundlegenden Mitteln zur Befriedigung primärer Bedürfnisse. Relative Armut wird definiert als ein Haushaltseinkommen unterhalb eines bestimmten Prozentsatzes des durchschnittlichen Haushaltseinkommens. Nichtmaterielle Armut umfasst Zeitarmut und Beziehungsarmut.
Was sind die Hauptursachen für Kinderarmut laut dem Dokument?
Die Hauptursachen für Kinderarmut sind Arbeitslosigkeit, Niedrigeinkommen und die Zunahme alleinerziehender Familien. Die finanziellen Aufwendungen für Kinder und die Opportunitätskosten der Kinderbetreuung tragen ebenfalls zur Verarmung von Familien bei.
Welche Auswirkungen hat Kinderarmut auf die betroffenen Kinder?
Kinderarmut hat vielfältige negative Auswirkungen auf die betroffenen Kinder, darunter eine höhere Kindersterblichkeit, gesundheitliche Probleme, psychische Störungen, soziale Handicaps und negative Auswirkungen auf ihre Bildungschancen.
Wie will die Bundesregierung mit der Agenda 2010 der Kinderarmut entgegentreten?
Die Bundesregierung plant den Ausbau der Kinderbetreuung, die Einführung eines Kinderzuschlags für geringverdienende Eltern, Steuerentlastungen für Alleinerziehende und Maßnahmen zur Förderung von Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt. Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern und zielgenaue finanzielle Förderungen anzubieten.
Was sind die Expertenmeinungen über die Auswirkungen der Agenda 2010 auf Kinder?
Expertenmeinungen sind gemischt. Einige befürchten einen Anstieg der Kinderarmut durch die Agenda 2010, während andere die Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung der Kinderarmut begrüßen. Es gibt Bedenken, dass der Kinderzuschlag nicht ausreichend ist und die Kürzungen sozialer Hilfen die Armut verstärken könnten.
Was versteht man unter bekämpfter und verdeckter Armut?
Bekämpfte Armut bezieht sich auf Personen, die Sozialhilfeleistungen beziehen. Verdeckte Armut umfasst diejenigen, die Anspruch auf Sozialhilfe hätten, diese aber nicht in Anspruch nehmen, beispielsweise aus Unwissenheit oder Scham.
Welche Signale können auf Kinderarmut hinweisen?
Anzeichen für Kinderarmut können sein, wenn Kinder im Kindergarten sehr schnell essen, Einladungen zu Kindergeburtstagen ablehnen, seltener Frühstück mitbringen, oder nicht an Klassenfahrten teilnehmen. Auch die Inanspruchnahme von Kleiderspendenboxen und Nahrungsproben kann ein Indiz sein.
- Quote paper
- Andreas Mitsch (Author), 2003, Kinder und Jugendarmut, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/108877