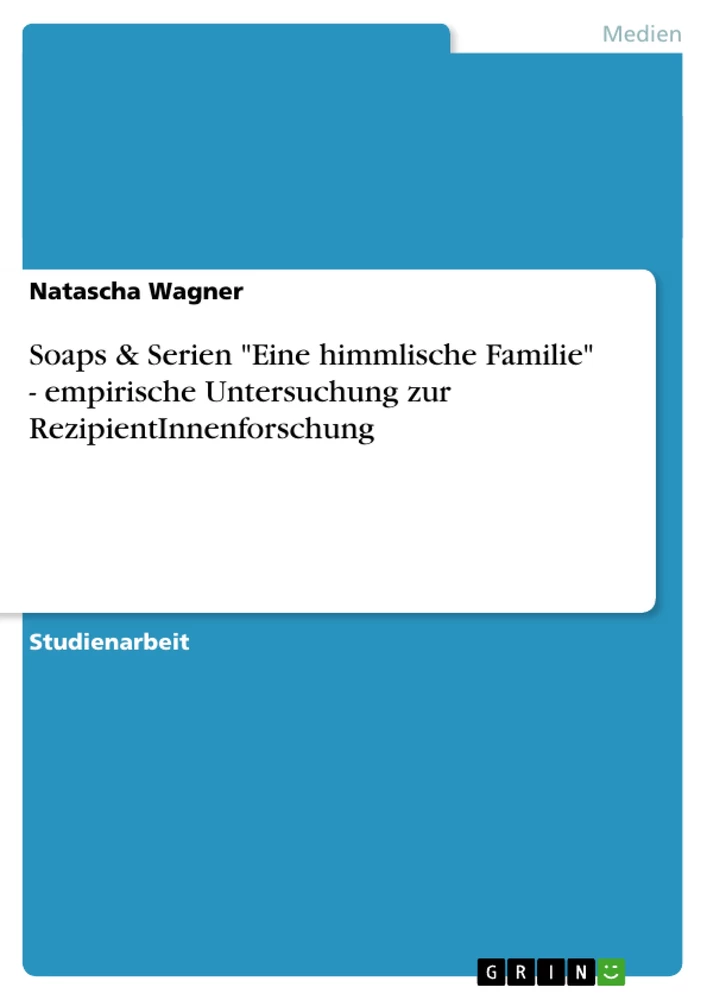Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1. Teil
2. Hintergrund und Geschichte
2.1 „Domestic Novel”, “Radio Soap opera”, “Daytime Serials”, “Daily soap” und “Prime time soap”
3. Soaps - Entscheidende Kriterien
3.1 Haupthandlungsstränge der Soap Opera
4. Andere Seriengenres
5. TV- Serien Allgemein
5.1. Identifikationsmöglichkeiten und Motivation
6. Gesellschaft im Wandel
7. Die TV-Familienserie „Eine Himmlische Familie“
7.1 Formale Details
7.2 Produzent Aaron Spelling
8. Das Genre der Familienserie
2. Teil
9. Überblick der Geschichte des qualitativen Denkens:
10. Zur Theorie qualitativer Forschung
11. Forschungsdesign
11.1 Zielgruppe der Befragten:
11.2 Zugang und Erkenntnisinteresse:
11.3 Auswertungsgrundlagen
12. Ergebnisse
13. Conclusio
14. Literaturverzeichnis
3. Teil
15. Anhang
Interviewleitfaden
Interview 1
Interview 2
Interview 3
Interview 4
Interview 5
Interview 6
1. Einleitung
Medien im allgemeinen und Fernsehen im speziellen spielen in unserer westlichen Gesellschaft eine bedeutende Rolle. Das Fernsehen mit seinen unzähligen Angeboten ist zu einem fixen Bestandteil unseres Lebens, und vor allem unserer Freizeitgestaltung, geworden. Den Untersuchungsgegenstand in der folgenden Seminararbeit bildet das Genre der Familienserien, welches am Beispiel der US- amerikanischen Familienserie „eine Himmlische Familie“ genauer untersucht wurde. Der Grund für diese Wahl war, dass wir selbst fanatische Konsumentinnen der oben erwähnten Serie sind, obwohl wir sie einheitlich als eine sehr konservative Vertreterin dieses Genres bewerten und uns deshalb immer wieder die Frage stellen, warum wir uns diese Serie täglich bzw. wann immer möglich zu Gemüte führen. Aus dieser sehr persönlichen Erfahrung im bezug auf die Rezeption der Serie „eine himmlische Familie“ hat sich auch unser Untersuchungsziel gebildet. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Motive der Serienrezeption von jungen Frauen im bezug auf die himmlische Familie zu durchleuchten und inwieweit diese Serie in die alltäglichen Gespräche im Freundes- und Bekanntenreis Einzug hält.
Als konkrete Methode dienten Leitfadeninterviews, deren Zweck es war, subjektive Bedeutungszuschreibungen und Erfahrungen zu erfassen und die Interviews vergleichbar zu gestalten.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir die gesamte Proseminararbeit in 3 große Bereiche aufgeteilt. Der erste Teil dieser Proseminararbeit beschäftigt sich mit der Entwicklungsgeschichte der TV-Serien und den spezifischen Merkmalen der Familienserien. Im zweiten Teil werden die Grundlagen und Aspekte qualitativer Methoden näher erläutert, unsere daraus resultierendes Forschungsdesign vorgestellt und die Untersuchungsergebnisse präsentiert. Des weiteren beinhaltet dieser Teil das Conclusio und das Literaturverzeichnis. Im Anschluss daran beinhaltet der 3. Teil den Leitfaden und die durchgeführten Interviews.
2. Hintergrund und Geschichte
Unmittelbare Vorläufer der anglo-amerikanischen Fernsehserie sind die Radio Soap Operas. Die erste Radioserie „Amos’n’Andy“ wurde von der NBC ab 1929 sechs Mal die Woche in fünfzehn minütigen Folgen gesendet. (vgl. Kaspar, S. 6) Der fulminante Erfolg dieser Serie bewirkte, dass Werbetreibende auf diese Art der Unterhaltung aufmerksam wurden und sie als Werbeträger entdeckten. Die Geschichten handelten hauptsächlich von weiblichen Heldinnen. Der Akzent lag auf einem moralischen Impetus. Die Frau hatte häuslich, mütterlich und anspruchslos zu sein.
Diese ersten Radioserien entstanden in den 30-er Jahren im kommerziellen Rundfunksystem der Vereinigten Staaten. Die Finanzierung wurde von Haushaltswarenfirmen wie Proctor und Gamble und anderen Waschmittelherstellern übernommen, daher entwickelte sich auch der Spitzname „Soap Operas“. In den Geschichten wurde die Lösbarkeit aller häuslichen Probleme einfach und eindeutig an die Produkte der Sponsoren geknüpft. (Hauptzielgruppe: Hausfrauen, da diese das größte Produktinteresse an den von den Firmenproduzierten Waren hatten.)
Die erste richtige Seifenoper war „Betty und Bob“, die in den USA in den Jahren 1932 bis 1939 täglich fünfzehn Minuten lang im Radio gesendet wurde. Die Entwicklung dieser Unterhaltungsform stieg rasant an und erreichte ihren Höhepunkt im Jahr 1940. Damals liefen insgesamt 64 verschiedene Serien zur gleichen Zeit. (vgl. Kaspar, S. 6)
Mit Einführung des Fernsehens wechselten auch die Soaps in das neue Medium. Das Fernsehen übernahm den fundamentalen Charakter der Radiosoap gleichermaßen wie die unterbrechende Werbung. Der Erfolg stellte sich aber erst ein, nachdem die Dauer der Episoden von traditionell 15 auf 30 Minuten verlängert worden war. „The Guiding Light“ war die einzige Radioserie, die den Sprung ins Fernsehen schaffte und ist die längste, seit 1933 ununterbrochen fortgesetzte Serie, die 1952 ins amerikanische Fernsehen kam. (vgl. Tebbich, S.2)
Geht man in der Geschichte noch weiter zurück, stößt man auf literarische Vorformen. Serien und Geschichten in serieller Form sind keine Erfindung der modernen Medien, sondern finden ihre ersten Vorläufer bereits in der trivialen Literatur des letzten Jhd. (traditionelle Familien- und Liebesromane).
In Bezug auf das Theater ist vor allem. die Commedia dell’Arte, mit ihrem festen Stamm an Charaktertypen und dem beschränkten Arsenal an Themen und Handlungsmustern zu nennen.
2.1 „Domestic Novel”, “Radio Soap opera”, “Daytime Serials”, “Daily soap” und “Prime time soap”
Als literarische Grundlage für die spätere Soap Opera in den USA dienten die „Domestic Novels“. Dabei handelt es sich um Serienromane aus dem 19. Jahrhundert mit detailliertem Inhalt. Es sind Geschichten in deren Mittelpunkt weibliche Heldinnen standen, allerdings gab es einen starken moralischen Akzent, die Heldinnen waren häuslich, mütterlich und anspruchslos.
Aus den „Domestic Novels“ entwickelten sich die „Radio Soap Operas“, in deren Mittelpunkt ebenfalls die weiblichen Protagonisten standen.
Die Radio Soaps wechselten dann ins Fernsehen und waren zunächst „Daytime Serials“. Der Inhalt konzentriert sich hier auf die patriarchal strukturierte Familie, die nur geringfügigen innerfamiliären Schwierigkeiten ausgesetzt ist und immer wieder zu einem Happy-End findet. Die Familie als immer funktionstüchtige, stabile Einheit, als gesunder Organismus wird idealisiert. (vgl. Hummel, S.3)
Daraus entwickelte sich in weiterer Folge die „Daily soap“. Auch hier steht die Frauenfigur im Mittelpunkt. Die Daily soap läuft im Nachmittagsprogramm und ihre Zielgruppe sind Frauen zwischen 20 und 45 Jahren.
Der nächst Schritt war die Verlagerung der Soaps ins Hauptabendprogramm um ein breiteres Publikum anzusprechen.
Die „Prime time soap“ läuft im Abendprogramm. Hier soll auch das männliche Publikum vermehrt angesprochen werden. Männliche Protagonisten stehen stärker im Mittelpunkt als in Daytime-serials, die Inhalte verlagern sich vom ausschließlichen Familiengeschehen in Business und Geschäftsbranchen. Die Familienahngelegenheiten werden viel pikanter und die Liebesgeschichten aggressiver. Die glamouröse Welt der Schönen und Reichen steht im Vordergrund. Es gibt meistens einen Bösewicht, der immer wieder Unruhe bringt und die Geschichten spannend macht. Größere Produktionsbudgets stehen zur Verfügung und die Drehorte sind weiträumiger. Eine der ersten und erfolgreichsten Prime time soaps ist „Dallas“ oder auch „Dynasty“
3. Soaps - Entscheidende Kriterien
- Offenes Ende der Episoden
Die einzelnen Episoden sind nicht abgeschlossen, es handelt sich also nicht um einzelne abgeschlossene Geschichten, sondern um einen
- Endloscharakter der Handlung
- Am Ende jeder Episode ein „Cliffhanger“
Dabei handelt es sich um einen spannenden, emotional angespannten Moment, der eingefroren wird und Neugier auf die nächste Folge schürt. Den Ausgang der Situation erfahren die Zuschauer erst in der nächsten Folge.
- „Zopfdramaturgie“
Die Zopfdramaturgie bedeutet eine Überschneidung der einzelnen Handlungsstränge für die so wichtige Handlungsverlangsamende Multiperspektivik.
- „Teaser“
Ähnlich wie der „Cliffhanger“ am Ende jeder Folge, gehört der „Teaser“ vor Beginn jeder neuen Folge zur Grundausstattung einer jeden Soap Opera. Die Bezeichnung „Teaser“ hat sich in der Soap-Branche etabliert als Aneinanderreihung von kurzen Szenen aus vorherigen Folgen, die unmittelbar vor Serienbeginn abgespielt werden. Dadurch hat der Zuschauer die Möglichkeit in die Geschehnisse der Handlung nahtlos einzusteigen. Als „teaser werden bevorzugt Schlüsselszenen gezeigt.
3.1 Haupthandlungsstränge der Soap Opera
Um jederzeit in eine Soap einsteigen zu können, gilt das Prinzip der niemals endenden Geschichten. Das Wichtigste ist, dass dem Rezipienten niemals langweilig wird, und dass er vor allem immer wieder einschaltet.
„Nathan Katzmann hat umfassend die vier Haupthandlungsstränge der Soap Opera herausgearbeitet:
1. Kriminelle und andere unwillkommene Aktivitäten
(z.B. Erpressung und Bigamie)
2. Soziale Probleme
(z.B. Trinksucht oder Auseinanderleben in der Familie)
3. Medizinische Entwicklungen
(z.B. Schwangerschaft, Geisteskrankheit)
4. Liebes- und Eheprobleme
(z.B. Liebesverhältnisse in Schwierigkeiten, eheliche Untreue)“ (Kaspar, S.9-10)
Katzmann stellt also zusammenfassend fest, dass die Welt der Soap Operas keine heile Welt darstellt, sondern eher voll von Sorgen und Nöten ist. Mann kann also nicht wirklich von einer vorgegaukelten Traumwelt sprechen. Da die Soap Opera aber bestimmt ist von Gesprächen über familiäre Beziehungen, kann man darauf schließen, dass der Mittelpunkt der Soap-Welt bestimmt wird von der Familie und ihren Problemen. (vgl. ebenda, S. 10)
4. Andere Seriengenres
sind z. B. Krimi- und Actionserien (Columbo, Nightrider),
oder Sitcoms (z.B. Al Bundy, Susan),
bei denen jede Folge eine abgeschlossene narrative Einheit bildet und sich alles in Wohlgefallen auflöst.
5. TV-Serien Allgemein
„Das Gesetz der Serie.
Was im Fernsehen erfolgreich wird,
wird gewöhnlich folgenreich.“ ( Kaspar, S. 15)
Serien gehören zum fiktionalen Angebot der Programmlandschaft.
Sie sind auf Grund formaler, serieller Erkennungs- und Verknüpfungsmerkmale leicht im Programmfluss zu identifizieren. Ihre Merkmale sind:
- Gleichbleibender Vor- und Abspann
- Kennmelodie
- Einsatz gleicher musikalischer Motive zur Akzentuierung ähnlicher emotionaler Situationen
- Immer gleiche Hauptfiguren (teilweise sogar immer gleich gekleidet)
- Teilweise immer gleiche Location
Diese Merkmale folgen dem Gesetz der Wiederholung um den Widererkennungsfaktor möglichst hoch zu halten.
5.1. Identifikationsmöglichkeiten und Motivation
Die fiktive Alltagsnähe lädt zur Identifikation und zum Vergleich mit den Protagonisten ein, wobei die Vielzahl an Personen, Beziehungen und Geschehnissen es dem Rezipienten ermöglichen, ganz unterschiedliche Positionen einzunehmen. Durch die Vielfalt der angebotenen Verhaltensmuster in einer Serie kann sich der Zuschauer in seinen eigenen Ansichten bestätigt fühlen, sie ablehnen oder sich durch sie inspirieren lassen.
Durch die vielen Identifizierungsangebote wird eine enge emotionale Bindung des Zuschauers an die Serie forciert.
Junge Menschen leben vermehrt als Singles in der Großstadt. Daily Soaps ersetzen oft soziale Kontakte. Diese Serien werden nicht geschaut, sondern gelebt. Außerdem erscheinen die eigenen Probleme gegenüber denen in der Serie nur mehr halb so schlimm. (vgl. Kaspar, S. 19)
Eine attraktive Besonderheit von Serien ist außerdem, dass der Zuschauer durch seinen Überblick über die Handlungsziele der Figuren in eine allwissende Rolle versetzt wird.
Die Familiarität mit den Serienhelden kann sich schon nach wenigen Folgen einstellen, und durch die extensive Anwesenheit auf dem Bildschirm erhalten die Protagonisten eine fiktive biografische Perspektive. (vgl. Gehrau, s. 66 ff)
Gemeinsam mit den Darstellern wird man älter, bzw. sieht wie im Laufe der Zeit die „Serienkinder“ wachsen.
Nicht zuletzt bieten Serien schlicht und einfach Unterhaltung.
Sie bieten die Möglichkeit aus dem eigenen Alltag zu fliehen, einfach abzuschalten und sich in die Welt der Serienhelden zu begeben.
Sie sind „leichte Kost“ und als Nebenbei-Berieselung genauso gut, wie als füllendes Abendprogramm.
Zwischen den Ländern und Kulturkreisen haben sich Fernsehserien ganz unterschiedlich entwickelt, so dass es sinnvoll erscheint, diese nach den Produktionsländern zu differenzieren.
Da wir für unsere Arbeit eine amerikanische Serie gewählt haben, werden wir auf Produktionen anderer Länder nicht im Speziellen eingehen.
6. Gesellschaft im Wandel
Die Familie als soziale Einheit mit Rechten und Pflichten innerhalb eines Gesellschaftssystems, hat bis heute eine wichtige Funktion in der Gesellschaft. Trotzdem zeichnen sich deutliche Veränderungen ab. In der vorindustriellen zeit bis tief in das 20. Jahrhundert galt die Familie als stabile Gegebenheit und Beziehung zwischen Mann und Frau, aus deren Vereinigung Kinder hervorgingen. Die Verhaltensformen innerhalb der Gesellschaft haben sich aber deutlich verändert und die Gestaltungsmöglichkeiten in Zweierbeziehungen sind vielfältiger geworden. Durch die Wandlung des Familienbildes hat sich auch die Rollenaufteilung innerhalb der Familie geändert. Frauen sind nicht mehr nur für heim und Kinder zuständig. Der überwiegende Teil hat einen Beruf erlernt und will oder muss ihn auch ausüben. Durch die Möglichkeit eines eigenen Einkommens sind Frauen selbständiger geworden und nicht mehr auf das Einkommen des Mannes angewiesen. die moderne Frau ist nicht mehr nur Familienmensch und der moderne Mann ist im Gegensatz zu seiner historischen Rolle auch zuständig für Heim und Familie. diese Veränderung spiegelt sich auch in den Medien wieder. (vgl. Steinberger, S. 9 f)
„Zweifellos befindet sich die Familie, die ihren Weg zwischen Tradition und Moderne erst finden muss, in einem Umstrukturierungsprozess. Ihre Bedeutung als soziales Fundament, in dem Kinder in Ruhe aufwachsen können, hat sie für die Gesellschaft jedoch nicht verloren. Die ORF-Dokumentation „Familie im Wandel“ (ORF, 1994) stellt eine Wertestudie vor, in der sich 80-90% der Europäer dahingehend äußern, dass die Familie der wichtigste Wertbestand in der Gesellschaft sei. Dies zeigt, dass die Familie auch heute noch einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft einnimmt.“ (Steinberger, S. 11)
Das Seriengeschehen im Fernsehen scheint auf die Umbrüche in der Gesellschaft zu reagieren, indem es Darstellungen sozialer Gemeinschaften und die Bewältigung des Zusammenlebens zeigt, die einerseits in der Form des Spieles sehr humorvoll sind, andererseits durchaus Problemstellungen innerhalb sozialer Gemeinschaften aufzeigen und Lösungen anbieten.
Für die Medienproduzenten und hier insbesondere für das Fernsehen mit seinen seriellen Gestaltungsformen wie den Familienserien könnte das Anlass sein, einerseits den Bedürfnissen der Zuschauer nach stabilen Gemeinschaften entgegenzukommen, um sich andererseits auf humorvolle Weise mit Konflikten in den Familien auseinanderzusetzen. (vgl. ebenda, S. 12)
7. Die TV-Familienserie „Eine Himmlische Familie“
Eric Camden ist Vater von sieben Kindern und Reverend in der Kleinstadt Glen Oak in Kalifornien. Annie seine Frau geht selbst keiner beruflichen Tätigkeit nach, sondern kümmert sich um den Haushalt und die Kinder. Beide sind bemüht, die alltäglichen Schwierigkeiten mit Verständnis, Hilfsbereitschaft und Humor in den Griff zu bekommen. Die sieben Kinder sorgen immer wieder für neue Probleme und Aufruhr im Haus der Camdens.
Zu Beginn der ersten Staffel, bestand die Familie aus sieben Mitgliedern: Eric und Annie und ihre fünf Kinder: Matt, Mary, Lucy, Simon und Ruthie. In der dritten Staffel gab es dann doppelten Neuzuwachs: Die Zwillinge Samuel und David.
Die Serie hat auch schon ein paar Auszeichnungen erhalten[1]:
1999 – Den TV Guide Award
1998 – Der Inspiration Award
1996 – Beste neue Serie – Film Advisory Board-award of excellence
1998 - Hollywood Reporter Best youngactor-David Gallagher Hollywood Reporter Best young actress in a drama-Beverly Mitchell Hollywood Reporter Best younger actress in a drama series-Mackenzie Rossman Green Light Award- Parent Counsel
1996-1997 Top Ten Family-Friendly Award Seal of Quality-Family Channel Veiwers for Quality Television ABRY Award-Academy of Religous Broadcasting Anit-Defamation Leauge-Award of Merit American Mothers council-Best media mother-Catherine Hicks Entertainment Industries Counsil Prism Commendation
Nominations: Emmy nomination
7.1. Formale Details
„Eine himmlische Familie“ („7th Heaven“), produziert von Aaron Spelling,
Länge einer Folge: 40 Minuten
Familienserie USA 1996 - , bisher 110 Folgen (5 Staffeln),
Ausstrahlung der 6. Staffel in den USA seit 24.9.2001;
Im deutschsprachigen Raum ausgestrahlt auf:
VOX: Mo – Fr, 16:10 Uhr (Wh. Mo – Fr, 11:15 Uhr) (seit 26.3.2001);
ORF1: Mo – Fr, 16:30 Uhr (seit 17.9.2001)
(Davor ORF1 v. 4.9.2000 – 6.6.2001; in VOX v. 28.11.2000 – 22.5.2001 (4.Staffel)
7.2. Produzent Aaron Spelling
Aaron Spelling wurde am 22. April 1923 in Dallas, Texas, geboren. Dort besuchte er die Forest Avenue Highschool und machte später seinen Abschluss als Bachelor of Arts an der Southern Methodist University in Dallas, Texas.
Seine Karriere im Showgeschäft begann er als Autor von Theaterstücken, die am Jane Wyman Theater aufgeführt wurden. Später entwarf er diverse Fernsehserien wie z.B. Playhouse 90. Seinen ersten Pilotfilm schreibt er für Four Stars Productions, wo er als Produzent beschäftigt wurde.
Später gründete er mit seinem Partner Danny Thomas die Thomas-Spelling Productions, bevor er 1972 seine eigene Produktionsfirma, die Aaron Spelling Productions eröffnete. Er wurde außerdem Partner von Leonard Goldberg in den Goldberg-Spelling Productions.
1986 ging er mit seinem Unternehmen an die Börse und eröffnete die Spelling Entertainment, Inc., deren zweiter Vorsitzender er seit 1995 ist. Er ist außerdem Vorsitzender der Tochterfirma Spelling Television. Spelling Entertainment besitzt außerdem die World Vision Syndication, Hamilton Projects (Fanartikel zu Fernsehshows) und Republic Pictures, daneben eine Softwarefirma namens Virgin Interactive.
Seit 1959 hat Spelling über 150 Serien und Filme produziert, deren Produktion er oft auch selbst geleitet hat.
Darunter sind die Serien "Burke´s Law" (1963), "Starsky and Hutch" (1975), "Love Boat" (1977), "Hart aber Herzlich" ("Hart to Hart", 1979), "Denver Clan" ("The Dynasty", 1981), "T.J.Hooker" (1982), "Beverly Hills, 90210" (1990), "Melrose Place" (1992), "Models Inc." (1994), "Savannah" (1996), "Malibu Beach" ("Malibu Shores", 1996), "Sunset Beach" (1997) und "Charmed - Zauberhafte Hexen" ("Charmed", 1998). Momentan arbeitet Spelling neben "Eine himmlische Familie" ("7th Heaven", 1996) und "Charmed" an der in den USA beliebten Serie "Safe Harbor" (1999), die wie 7th Heaven bei Warner Brothers läuft.
Spelling drehte Filme wie ""The Monk" (1969), "Yuma" (1970), "Der Tod eines Bürgers" ("The Old Man Who Cried Wolf, 1970), "Der Mörder meines Bruders" ("Run, Simon, Run", 1970), Der Hauch des Bösen" ("A Taste of Evil", 1971), "Die Verfolger" ("The Truckers", 1971), "Kopfgeldjäger" ("The Bounty Man", 1972), "Liebe in Fesseln" ("The Affair", 1973), "Die knallharten Fünf" ("S.W.A.T.", 1975), "Drei Engel für Charlie" ("Charlie´s Angels", 1976), "Fantasy Island I und II" (1977, 1978 und Serie ab 1978), "Vegas - Auftrag ohne Honorar " ("Vega$", 1978), "Mr. Mom" (1983), "Frauen wie Samt und Stahl" ("Velvet", 1983), "Nacht, Mutter" ("'Night Mother", 1983), "Faustrecht - Terror in der Highschool " ("Three O'Clock High", 1987), "Nicht jetzt, Liebling" ("Surrender", 1987), "Was nun?" ("Cross my Heart", 1987), "Day One" (Emmy 1989), "Mitgefangen - Mitgehangen" ("Jailbirds", 1991), "Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper" ("Soapdish", 1991), "Kampf um Georgia" ("Grass Roots", 1992), "..und das Leben geht weiter" ("And the Band Played On", Emmy 1993), "Daus des anderen" ("Jane's House", 1994), "Der Abenteurer und das Biest" ("Love on the Run", 1994). (vgl.: www.angelfire.com/de2/7thHeaven/aaron.html)
8. Das Genre der Familienserie
Im Spektrum des täglichen Fernsehangebots der unterschiedlichsten Sendeanstalten, wie ORF, ZDF,ARD, PRO7, Kabel 1, etc. stellen die TV- Familienserien einen fixen und wichtigen Bestandteil dar und sind zu einem Teil der Alltagskultur geworden.
Im Mittelpunkt der Familienserien stehen eine oder mehrere Familien. Das Leben der Serienfamilien verläuft zyklisch und ist zukunftsorientiert, und an einen fixen Handlungsschauplatz, den Heimatort, gebunden. Die Grundlage der Stories setzt sich einerseits aus den familiären Interaktionsstrukturen, der einzelnen Familienmitglieder untereinander und aus den Beziehungen dieser mit anderen Familien bzw. dritten Personen, zusammen. Diese Interaktionen werden durch das hinzufügen tragischer Momente, wie zum Beispiel Schulprobleme der Kinder, Konfliktsituationen am Arbeitsplatz oder zu Hause, partnerschaftliche Konflikte und Erziehungsprobleme verfeinert und dadurch für die RezipientInnen interessanter gestaltet. „Das Leben der Serienfamilien kann in diesem Sinn als soziales Drama bezeichnet werden.“ (Mikos 1994, S. 139)
Daraus ergibt sich, dass Familienserien über die Unterhaltungsfunktion hinaus eine gesellschaftliche Wirksamkeit haben. Dies lässt sich durch die Tatsache erklären, dass Bereiche des Privaten, im speziellen die Familie, „über die mediale Veröffentlichung dieses Bereiches einen intersubjektiven Orientierungsrahmen gerade für zwischenmenschliche Interaktionsformen, Generationskonflikte und geschlechterspezifischen Verhaltensweisen“ (Decker, Krah, Wünsch; aus: Medien und Erziehung 1997, S. 81) vorexerzieren.
Dieser Orientierungsrahmen basiert jedoch auf einem sehr klar vorgegebenen, starren, traditionellen und ausschließenden Wertesystem.
Im folgenden Teil dieses Kapitels werden wir, basierend auf einem Artikel von Jan-Oliver Decker, Hans Krah und Marianne Wünsch aus der Zeitschrift Medien und Erziehung, die wichtigsten Merkmale dieses Wertesystem und damit der TV-Familienserien aufzeigen.[2]
Das ideale Familienmodell
Die ideale Serienfamilie setzt sich aus dem biologischen Vater, der biologischen Mutter und den Kindern zusammen, wobei darauf geachtet wird, eine geschlechtliche Ausgewogenheit herzustellen. In den Familienserien wird die Relevanz des Merkmals biologisch und damit die Wert der biologischen Eltern besonders betont. Das Fehlen der biologischen Eltern wird als Defizit bewertet und hat psychische Probleme für die Betroffenen zur Folge.
Dem idealen Familienmodell ist eine sehr traditionelle, patriarchalische Rollenaufteilung immanent, in welcher der Vater die Funktion des Ernährers und die Vorbildfunktion für den männlichen Nachwuchs einnimmt. Die Aufgaben der Mutter beschränken sich auf reproduktive Tätigkeiten im Haushalt. Ihre Funktion besteht darin, für den Ehemann und die Kinder einen Regenerations- bzw. Schutzraum zu schaffen. Zusätzlich übernimmt sie eine zentrale Stellung für die Gewährleistung der familieninternen Kommunikation und damit ist sie ebenfalls für die Weitergabe der Werte innerhalb des Verbundes verantwortlich. Die Kinder zeichnen sich durch ihr unbedingtes Vertrauen in die Anweisungen und Verhaltensmaßregeln der Eltern aus.
Bei Verstößen gegen die Regeln erkennen die Kinder auch immer die Sinnhaftigkeit der Bestrafungen bzw. der auf den Regelverstoß folgenden Sanktionsmaßnahmen. Dies kann soweit führen, dass sich zum Beispiel in der US- amerikanischen Serie, eine himmlische Familie, Ruthy, die jüngste Tochter des Hauses, nach einem Verstoß, den die Mutter noch nicht bemerkt hat, erstens ihr Vergehen freiwillig eingesteht und zweitens selbst eine Bestrafung einfordert.
Dieses Familienmodell impliziert als zentralen Wert den unbedingten Erhalt und Zusammenhalt der Familie. Dazu gehört auch, dass die einzelnen Familienmitglieder ihre eigenen Interessen zu Gunsten der Familie als sekundär betrachten.
In den Familienserien wird davon ausgegangen, dass Konflikte und Probleme immer nur innerhalb der Familie gelöst werden können. Bei der Konfliktlösung wird jedoch an den hierarchischen Strukturen innerhalb der Familie festgehalten. Etwaige Bestrebungen des Nachwuchses selbst mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, münden immer in Misserfolge. Dadurch erhalten die Serieneltern einerseits das Recht die Kinder laufend zu überwachen und andererseits ihnen die Lösungswege vorzugeben.
Die Familie wird als der einzige Ort dargestellt, indem Sicherheit, Schutz, Geborgenheit, Liebe und Fürsorge existent sind, und den es gilt nach außen hin und vor den externen Gefahren zu beschützen. Es handelt sich auch um die einzige Stätte in der gravierende Probleme, wie zum Beispiel Drogensucht gelöst werden können. Die Hilfe von staatlichen Institutionen wird in den seltensten Fällen In Anspruch genommen, da der Serienlogik folgend, nur die Familie durch ihre Wärme und Fürsorge in der Lage ist die wahre Ursache für die Krise zu erkennen und zu beheben.
Dieses Prinzip wird auch immer wieder gerne in Ärzteserien verwendet, indem der Arzt weniger durch die medizinischen Behandlungsmethoden als mehr durch die persönliche und fürsorgliche Beziehung zwischen ihm und dem Patienten die Symptome heilen kann. Weiters werden als Ursache für Krankheiten auch meistens Defizite in der Sozialisation bzw. im sozialen Leben des Erkrankten angeführt. In der Serie eine himmlischen Familie wurde dieses Merkmal anhand des Alkoholismus der Schwester von Eric Campton (Familienoberhaupt) dargestellt. Erst durch den Besuch bei der Familie konnte die Schwester sich ihr Alkoholproblem eingestehen und mit deren Hilfe bewältigen.
Familie und Lebenslauf
„Allen Familienserien liegt ein abstrahierbares Lebenslaufmodell zu Grunde, dessen Erfüllung teleologisch auf die Familiengründung ausgerichtet ist.“ (Jan-Oliver Decker, Hans Krah, Marianne Wünsch; aus: Medien und Erziehung 1997, S. 83) Die Sinnhaftigkeit und der Erfolg im Lebenslauf der einzelnen Protagonisten hängt vom Bestehen einer familiären Bindung ab. Durch die Altersunterschiede der Familienmitglieder können die verschiedenen Stadien der Bindung (Kindheit, Jugend und Reife) an die Familie vorgeführt werden.
In der ersten Entwicklungsstufe sollen die Kinder in einem geschützten Rahmen und durch fürsorgliche Betreuung aufwachsen. Der Übergang von der Kindheit zur nächsten Phase, der Jugend, wird durch den Schulabschluss manifestiert. Dieser Lebensabschnitt ist gekennzeichnet durch die Neuorientierung der Individuen im bezug auf ihr zukünftiges Leben, erstens Entscheidungen bezüglich Berufs- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen und zweitens der beginnenden Loslösung der Jugendlichen von der Familie und zu guter letzt der Suche nach einem/r potentiellen Partner/nerin mit dem Ziel eine eigene, nach dem Vorbild der Eltern konstituierte, Familie zu gründen. Hier muss jedoch zwischen den männlichen und weiblichen Protagonisten unterschieden werden. In den Familienserien lösen sich die jugendlichen Frauen immer nur partiell von ihrer Herkunftsfamilie. Das hat zur Folge, dass sie meist noch zu Hause wohnen oder zumindest eine sehr starke Bindung zur Familie haben. Im Gegensatz dazu müssen sich männlichen Jugendlichen völlig von ihrer Herkunftsfamilie lösen und sich, „in der Regel in einem fernen Außenraum, einem Erkenntnisprozess unterziehen, in dem sie erkennen, dass der Mensch ohne Familie keine sinnvolle Existenz führt.“ (Jan-Oliver Decker, Hans Krah, Marianne Wünsch; aus: Medien und Erziehung 1997, S. 84)
Der Übertritt in die nächste Phase wird von beiden Geschlechtern mit dem Eintritt in die Ehe und der Gründung einer neuen Familie vollzogen. Ein zentrales Element der Lebensphase Reife ist auch die Schaffung eines eigenen Heims, im Idealfall ein Haus mit Garten, aber zumindest eine eigene Wohnung.
In der letzten Phase, das Alter, tritt das Individuum wieder in einen reinen Familien- und Schutzraum ein. Diese Phase wird in den Serien meistens durch den Tod eines Ehepartners eingeleitet.
Stereotypen und Abweichungen
Als Basis für die Stereotypen werden die weiter oben erwähnten Rollenbilder des idealen Familienmodells herangezogen. Die Stereotypen haben die Funktion die Abweichung von dem dargestellten heilen Familienleben leicht erkennbar zu machen Die Aufgabe der Abweichungen besteht darin das positive Bild der Stereotypen zu stärken und hervorzuheben. Der fürsorglichen Mutter wird beispielsweise eine Karrierefrau, die sich überhaupt nicht um die Bedürfnisse ihres Nachwuchs kümmert, entgegengesetzt. Dies stereotypisierte Abweichung zieht negative, irreversible psychische Konsequenzen für das Leben ihrer Kinder nach sich und legitimiert somit die traditionellen Familienrollen bzw. das ideale Familienmodell und die damit verbundenen Werte.
Als Grundlage für die einzelnen Episoden werden Mythen bzw. kulturelle Klischees herangezogen, wie zum Beispiel das ideal der Familie oder der Bruderzwist, wie bei der biblischen Geschichte von Kain und Abel, wer A sagt muss auch B sagen oder was Hänschen nicht lernt, lernt Hans `nimma` mehr, etc. „Mythen sind Erzählungen, in denen sich soziale Erfahrung manifestiert, daher sind sie stets mit sozialen Topoi verknüpfbar, in denen sich persönliche Lebenserfahrungen manifestieren, und zwar auf der Basis lebensweltlicher Bezüge und des kulturellen Kontextes.“ (Mikos 1994, S. 140) Für die RezipientInnen hat dies den Effekt, dass sie Teile ihrer gelebten Wirklichkeit in den Familienserien wiedererkennen können und sich dadurch besser mit den Storys identifizieren bzw. partielle Analogien vorhanden sind.
Die Konzeption von Liebe und Sexmoral
In Familienserien sind Liebe und Erotik immer auf das Ziel, den optimalen Lebenspartner zu finden, ausgerichtet. Das bedeutet, dass Liebe und Erotik ausschließlich im Zusammenhang mit der Gründung einer eigenen Familie denkbar und machbar sind. Für die jugendlichen Protagonisten sind voreheliche Sexualkontakte mit dem anderen Geschlecht eine Bedrohung und werden als Zeichen einer nicht aufrichtigen Liebe und nicht optimalen Beziehung gedeutet. Dies hat zur Folge, dass derartige Beziehungen sofort aufgelöst werden müssen, um sich wieder auf die Suche nach dem richtigen Partner begeben zu können. In der Serie eine himmlische Familie beispielsweise wird Mery, die älteste Tochter, von ihrem Freund unter einem anderen Vorwand in ein Motel gelockt um dort vorehelichen Sex zu praktizieren. Mery ist völlig außer sich und erzählt, als sie zu Hause angelangt war, ihren Eltern völlig aufgelöst und schockiert von diesem Erlebnis. Im folgenden Gespräch wird Mery von ihren Eltern und Geschwistern darin bestärkt die Beziehung mit diesem Jungen zu beenden.
In einer späteren Episode will Lucy mit ihrem Freund vorehelichen Sex praktizieren mit dem Ziel ihn nicht zu verlieren bzw. zu enttäuschen. Durch Zufall erfährt ihr ältester Bruder von diesem Plan und kann sie in letzter Minute vor dieser Fehlentscheidung retten, indem er an den Ort den Geschehens fährt und sie aus dem Auto ihres Freundes herausholt. Matt hält ihr während der ganzen Heimfahrt einen Vortrag und sie verhandeln, ob dieses Verstoß den Eltern mitgeteilt werden soll, oder nicht. Während dessen fährt aber schon der besagte Freund von Lucy zu den Camptons (den Eltern) nach Hause, um ihnen von diesem Fauxpas zu berichten und sich in aller Form zu entschuldigen. Seine Handlung soll in diesem Fall signalisieren, dass er es sehr wohl ernst meint mit der Tochter des Hauses und wird auch von den Eltern dementsprechend gewürdigt.
Wie aus den oben gezeigten Beispielen ersichtlich, wird in Familienserien das Thema Sexualmoral hauptsächlich durch die Darstellung von abweichendem und damit negativ bewertetem Verhalten thematisiert.
9. Überblick der Geschichte des qualitativen Denkens:
Diese Arbeit basiert auf qualitativ sozialwissenschaftlicher Methode und bildet somit den Mittelpunkt des Forschungsvorganges unserer Erhebung.
Es scheint mir sinnvoll nun einen bescheidenen Überblick über die Geschichte dieser Methode zu geben und zwar von den frühesten Beginnen an.
Wenn von qualitativen Methoden die Rede ist, so stehen diese naturgemäß immer im Gegensatz zu quantitativen Methoden, die ihr Hauptaugenmerk auf ein exaktes und objektives Ermitteln von Daten legen. Wobei diese Daten, vor allem der Verifikation oder Falsifikation von im Vorhinein festgelegter Hypothesen dienen, im Sinne dieses Wissenschaftsverständnisses sollten diese möglichst zuverlässig, vergleichbar und nachvollziehbar sein, um Gütekriterien wie die Validität und Reliabilität zu erfüllen.
Im Gegensatz dazu steht die qualitative Forschung die „...keine beliebig einsetzbare Technik ist, sondern eine Grundhaltung, ein Denkstil...“ (Mayring 1999, S. 1) und die sich auf den Menschen, seine subjektive Meinung und eigenen Perspektiven konzentriert.
Dies sollte nicht missverstanden werden; quantitative Methoden sind weder völlig obsolet, noch sind qualitative Methoden eine Alternative zur quantitativen Forschung, es sollte mehr als ein gegenseitiges Ergänzen gesehen werden. Qualitatives und quantitatives Denken sind in der Regel in jedem Forschungs- und Erkenntnisprozess enthalten, gehen gleichsam Hand in Hand. Jedoch muss betont werden, dass bisher das qualitative Denken vernachlässigt wurde.
Die Wurzeln des qualitativen Denkens gehen sehr weit in unsere Zeitrechnung zurück, „Aristoteles (384-322 v. Chr.) wird hier immer wieder als Urvater bezeichnet.“ (Mayring 1999, S. 3) Denn für ihn steht die Erforschung des Menschen an oberster Stelle des Interesses, vor allem die Seele des Menschen ist für ihn die Krone der Wissenschaft. Dies bedarf jedoch einem eigenen wissenschaftlichen Zugang der sich nicht der deduktiven Logik, im Sinne der galileischen Denktradition, die nach allgemeinen Naturgesetzen sucht, die mit Methoden gefunden und überprüft werden, die für alle Einzelwissenschaften gleich seien, unterwirft.
Vor allem aber spielen Qualitative Methoden zu beginn des 20. Jahrhunderts eine wesentliche Rolle in den Sozialwissenschaften und der Psychologie. Zu nennen wäre hier ein wissenschaftstheoretischer Strang der sich als weitere Wurzel des qualitativen Denkens auszeichnet, nämlich die Hermeneutik. „Darunter sind alle Bemühungen zu verstehen, Grundlagen wissenschaftlicher Interpretation zur Auslegung von Texten zu erarbeiten.“ (Mayring 1999, S. 4). Ein Vertreter dieser Richtung war Wilhelm Dilthey, der den Grundgedanken dieser hermeneutischen Ansätze in dem Sinne vertrat, indem alles von Menschen Hervorgebrachte, immer mit subjektiven Bedeutungen und Sinn verbunden ist, somit muss ein Forscher als Interpret tätig werden.[3]
Es folgten biographische Methoden, beschreibende Verfahren oder Fallanalysen, die sich als wichtige Verfahren darstellten und unter anderem von der „Chicagoer Schule der Soziologie“ praktiziert wurden. Eine weitläufig bekannte österreichische Studie, „Die Arbeitslosen von Marienthal“[4] aus dieser Zeit, ist ein gutes Beispiel für die damalige Bedeutung qualitativer Methoden dar. Im laufe der Zeit rückten jedoch zunehmend quantifizierende und standardisierende Ansätze in den Vordergrund und wurden zum Methodischen Paradigma, nicht nur in den klassischen Naturwissenschaften, sondern auch in der Soziologie, Psychologie und Pädagogik.
Die Wende in Richtung qualitativer Methoden ging zeitversetzt, erst in den 70er Jahren im deutschsprachigen Raum vonstatten, während in den USA der Methodenstreit bereits in den 60ern ausgebrochen war.
Die Entwicklung qualitativer Methoden in den USA teilen Denzin und Lincoln in ihrem „Handbook of Qualitative Research“ (Denzin/Lincoln 1994, S. 7), in folgende fünf Perioden ein:
1. Die Periode der traditionellen Forschung (1900-1945). Die Forschung ist interessiert am Fremden und dessen Beschreibung. In der Ethnographie interessierten vor allem fremde Kulturen, in der Soziologie Außenseiter.
2. Die Modernistische Phase (1945-70er Jahre). In dieser Phase wird versucht, die qualitative Forschung zu formalisieren und zu diesem Zwecke erscheinen auch die ersten Lehrbücher.
3. Phase der verwischten Genres (bis Mitte der 80er Jahre). Es stehen nun verschiedene Modelle und Verständnisweisen nebeneinander, wie etwa Symbolischer Interaktionismus, Ethnomethodologie, Semiotik oder Feminismus.
4. Krise der Repräsentation (ab Mitte der 80er Jahre). In dieser Phase „erfahren der Prozeß der Darstellung von Erkenntnis und Ergebnis als substantieller Teil des Forschungsprozesses und als Teil der Ergebnisse an sich zunehmende Aufmerksamkeit“ (Flick 1996, S. 19). Ausgehend von der Ethnographie wird nun sowohl die Rolle des Forschers im Forschungsprozess als subjektives Bestandteil, sowie die Frage der Konstruktion von Wirklichkeit durch am Forschungsprozess Beteiligte diskutiert.
5. Die fünfte Phase (90er Jahre). Die aktuelle Situation sehen Denzin und Lincoln dadurch gekennzeichnet, daß Erzählungen an die Stelle von Theorien treten bzw. daß Theorien als Erzählungen gesehen werden. Zudem treten solche Theorien und Erzählungen in den Vordergrund, die auf bestimmte begrenzte lokale, historische Situationen beschränkt sind.
Habermas machte erstmals 1967 aufmerksam auf die Entwicklung in der amerikanischen Soziologie die in die deutsche Wissenschaft einflossen, daraufhin wurden in den darauffolgenden Jahren hauptsächlich Diskussionspunkte aus Amerika importiert. Innerhalb der amerikanischen Soziologie der 50er und 60er Jahre wurde ein Modell entwickelt das von Glaser und Strauss als „grounded theory“ bezeichnet wurde. Dieses Modell zielt vor allem darauf ab, dass dem Gegenstand der Untersuchung mehr gerecht wird, als dies durch quantitative Methoden möglich ist. „Damit finden Datenerhebung und Auswertung gleichzeitig statt. Im Laufe der Datenerhebung kristallisiert sich ein theoretischer Bezugsrahmen heraus, der schrittweise modifiziert und vervollständigt wird.“ (Mayring 1999, S. 82).
Durch die Entwicklung zweier eigenständiger Methoden, nämlich des narrativen Interviews und der objektiven Hermeneutik setzte Anfang der 80er Jahre ein Entwicklungsschub ein. Die Themen, die Mitte der 80er Jahre die Diskussion um qualitative Methoden in Deutschland bestimmten, waren Fragen der Gültigkeit und Verallgemeinerung von erzielten Ergebnissen oder von Kriterien zu ihrer Überprüfung. Schließlich, ende der 80er wurden dann erste Lehrbücher im deutschsprachigen Raum konzipiert.
10. Zur Theorie qualitativer Forschung
Ziel qualitativer Forschung ist es spezifische Phänomene zu beleuchten, deren Kontext zu erfassen und verschiedene Aspekte in sinnvolle Zusammenhänge zu bringen. Als wichtige Orientierungspunkte für qualitative Ansätze können vor allem drei theoretische Positionen genannt werden: Symbolischer Interaktionismus, Ethnomethodologie und strukturalistische oder psychoanalytische Modelle. Im Kontext dieser Arbeit möchte ich kurz die ersten beiden Positionen erläutern.
Symbolischer Interaktionismus
Ausgehend von Herbert Blumer wird hier „der subjektive Sinn, den Individuen mit ihren Handlungen und ihrer Umgebung verbinden, zum empirischen Ansatzpunkt“ (Flick 1996, S. 29). Das Hauptaugenmerk liegt auf Prozessen der Interaktion zwischen Individuen, wobei diese Interaktionen durch Wechselseitigkeit und symbolhaften Charakter gekennzeichnet sind. Blumler legte drei Prämissen fest, durch die Symbolischer Interaktionismus gekennzeichnet werden kann. Erstens handeln Menschen gegenüber Dingen auf der Grundlage von Bedeutungen, die diese Dinge für sie besitzen. Zweitens entstehen die Bedeutungen solcher Dinge aus sozialen Interaktionen, die man mit Mitmenschen eingeht und drittens werden diese Bedeutungen in einem interpretativen Prozess, den die Person in ihrer Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, geändert und abgeändert[5]. Aus diesen Prämissen ergeben sich die Konsequenzen für qualitative Forschung, nämlich dass im Mittelpunkt des Forschungsinteresses die Art und Weise steht, in der Individuen ihre Umgebung, d.h. Erlebnisse, Erfahrungen, Gegenstände u.ä. mit Bedeutung versehen. Das methodische Prinzip, das sich hieraus begründet, wird von Stryker folgendermaßen formuliert: die „Behauptung, dass dann, wenn eine Person eine Situation als real definiert, diese Situation in ihren Konsequenzen real ist, führt direkt zum fundamentalen methodologischen Prinzip des symbolischen Interaktionismus: Der Forscher muß die Welt aus dem Gesichtswinkel der Subjekte sehen, die er untersucht“ (Stryker 1976, S. 259).
Ethnomethodologie
Die Ende der 60er Jahre begründete Ethnomethodologie setzt ihren Forschungsschwerpunkt bei der Frage nach der Herstellung sozialer Wirklichkeit durch interaktive Prozesse von Individuen. Dabei ist ein Schwerpunkt das Untersuchen von Alltagshandlungen in ihrem Kontext, da davon ausgegangen wird, daß soziale Wirklichkeit eine Vollzugswirklichkeit ist. Das heißt eine Wirlichkeit, die im Laufe von Handlungen im Alltag erst erzeugt wird. Im Zusammenhang mit Medienforschung spielten ethnomethodologische Herangehensweisen besonders im angelsächsischen Raum im Rahmen der Cultural Studies eine bedeutende Rolle. David Morley, einer der Pioniere ethnographischer Forschung, versucht in seinem Buch „TV, Audiencen and Cultural Studies“ die wichtigsten theoretischen Konzepte verschiedener Disziplinen zu einem methodischen Ganzen der Fernsehforschung zu vereinen. Dabei hält er fest, dass „Fernsehen“ in ethnographischer Forschung als eine komplexe Tätigkeit betrachtet werden muss, zu deren Erforschung eine ganzheitliche und kontextuelle Annäherung erforderlich ist. Der Akt des Fernsehens muss dabei als eine in eine umfassendere Struktur von alltäglichen Konsumprozessen eingebettete Tätigkeit betrachtet werden. Diese Prozesse, so fordert Morley, müssen wiederum in ihrer natürlichen Umgebung als im breiten Kontext des Alltags stattfindende Aktivitäten untersucht werden.
Nun können, Gemeinsamkeiten aus den bisher dargelegten theoretischen Positionierungen herausgehoben werden, um diese auf einer etwas konkreteren Ebene gemeinsame Grundsätze zu benennen. Fünf solcher Grundsätze hat Mayring in seiner „Einführung in die qualitative Sozialforschung“ (Mayring 1999, Kap. 2) genannt:
- Subjektbezogenheit der Forschung
- Deskription der Forschungssubjekte
- Interpretation der Forschungssubjekte
- Alltägliche Umgebung
- Verallgemeinerungsprozess
Diese Postulate stellen in diesem Zusammenhang, das Grundgerüst qualitativen Denkens dar, denn viel zu oft „...gerät in sozialwissenschaftlicher Forschung der eigentliche Ausgangspunkt und das erreichte Ziel, die Subjekte, ins Hintertreffen.“[6]
Das sollte nun mit der Aufstellung dieser Postulate verhindert werden, indem es in besonderem für alle Bereiche, in denen verbales Material analysiert werden soll, dazu zählen also ebenso schriftliches Material, wie Interviews, Fragebögen, usw. in diesem Sinne gehandhabt werden kann.
Unter dem Grundsatz der Subjektbezogenheit der Forschung versteht man nun, dass das Subjekt als Ausgangspunkt der Untersuchungen gesehen wird, dabei sollen bei qualitativen Ansätzen die Methoden dem jeweiligen Forschungsobjekt angepasst werden und nicht umgekehrt.
Das Postulat der Deskription und der Interpretation der Forschungsobjekte besagt, dass zu Beginn einer jeden Analyse eine genaue Deskription des Gegenstandbereichs unumgänglich ist, um somit den Kontext des Untersuchten in die Forschung mit einzubeziehen. Weiters wird hier verdeutlicht, dass alles vom Menschen Hervorgebrachtes subjektiv gefärbt ist und von seinen subjektiven Vorstellungen und Einstellungen geprägt ist, dadurch ist es nötig dass sich qualitative Forschung der Interpretation bedienen muss. „Denn die Menschen haben die unterschiedlichsten Begriffe von Glück, ebenso wie die auswertenden Sozialforscher unterschiedliche Glücksdefinitionen im Kopf haben.“ (Mayring 1999, S. 11) Hiermit wird auch deutlich, dass sich der/die ForscherIn dem Forschungsprozess bewusst werden muss, ihrem/er Rolle, ihrem/er Position und diese reflektiert und expliziert.
Auf die Untersuchung der Subjekte in ihrer natürlichen, alltäglichen Umgebung muss besonderer Wert gelegt werden, denn humanwissenschaftliche Phänomene sind stark situationsabhängig. „Menschen reagieren im Labor anders als im Alltag.“ (Mayring 1999, S. 12). Nachdem qualitative Forschung bemüht ist den Untersuchungsgegenstand in seiner ganzen Komplexität und Ganzheit zu erfassen, ist es notwendig ebendiese zu untersuchenden Phänomene so alltagsnah wie nur möglich zu beobachten und zu beschreiben. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass jeder forschende Zugang zur Realität eine Verzerrung mit sich bringt, dennoch will die qualitative Forschung solche Unschärfen verringern, oder zumindest bewusst reflektieren.
Den Verallgemeinerungsprozess der Ergebnisse drückt Mayring so aus „Da menschliches Handeln in großem Maße situativ gebunden, historisch geprägt, mit subjektiven Bedeutungen behaftet ist, lässt sich die Verallgemeinerung humanwissenschaftlicher Ergebnisse nicht automatisch durch ein Verfahren, wie das der repräsentativen Stichprobe garantieren.“ Darum muss die Verallgemeinerbarkeit der Forschungsergebnisse stets im spezifischen Fall begründet werden, es muss erklärt werden, für welche Situation und für welchen Zeitraum sie gelten.
11. Forschungsdesign
Wir haben uns in Hinblick auf unser Forschungsfeld, nämlich um die Frage der Rezeption, der Gratifikation und der Identifikation von Seherinnen einer Familienserie, für das problemzentrierte Interview entschieden. Aus dem Grund heraus, dass wir zwar unvoreingenommen an das Thema herangehen konnten, doch nicht ohne völlige Unwissenheit auf theoretischer Basis. Im Gegensatz zum narrativen Interview wird in dieser Form der Forscher angehalten nicht ohne jegliches theoretisch-wissenschaftliches Vorverständnis in die Erhebungsphase zu gehen. „Im problemzentrierten Interview steht die Konzeptgenerierung durch den Befragten zwar immer noch im Vordergrund, doch wird ein bereits bestehendes wissenschaftliches Konzept durch die Äußerungen des Erzähler evtl. modifiziert“ (Lamnek 1995, S. 74).
Weiters wählten wir die Halb-standardisierte Befragung, in der ein Leitfaden ausgearbeitet, wird der dem Forscher eine Stütze sein soll, doch keine fixen Vorgaben der Reihenfolge der Fragen, somit einen gewissen Spielraum lässt, aber auch Sicherheit gibt.
- Halb-standardisierte Befragung[7]
Es liegt ein Inerviewerleitfaden vor, bei dem es dem Interviewer jedoch überlassen bleibt, die Reihenfolge und Formulierung der Fragen im wesentlichen selbst zu bestimmen. Die Reihenfolge ergibt sich hauptsächlich aus dem Verlauf des Gespräches.
- Problemzentriertes Interview
Hier hat der Forscher vorab ein wissenschaftliches Konzept, das durch die Äußerungen des Erzählenden modifiziert wird; im Gegensatz zum narrativen Interview in dem der Forscher völlig ohne wissenschaftliche Vorarbeit in die Datenerhebung geht.
Aus den gesammelten Informationen filtert der Forscher also die für ihn relevant erscheinenden Aspekte des Problembereichs der sozialen Realität heraus und erarbeitet aus diesen den Interviewerleitfaden.
11.1 Zielgruppe der Befragten:
Unsere Zielgruppe setzt sich aus StudentInnen zwischen 20 und 27 Jahren zusammen, die weder eigene Familie haben, noch in der direkten Familienplanung stecken. Diese Gruppe ist für uns von speziellem Interesse, da diese wie wir meinen dem Familienthema gegenüber offen sind und eventuell durch Medien beeinflusst, oder zum Nachdenken über die Thematik angeregt werden.
11.2 Zugang und Erkenntnisinteresse:
Wir haben uns für die Serie „Eine himmlische Familie“ entschieden, da wir sie selber gerne konsumieren, obwohl uns bewusst ist das sie konservativ ist und sie uns deshalb immer wieder zu heißen Diskussionen anregt.
Unser Ausgangspunkt ist, dass die Rezipentinnen die Serie „Eine himmlische Familie“ als konservativ einstufen, sie dient primär der Unterhaltung und nicht der Identifikation, weil in der Serie traditionelle Familienwerte überzeichnet transportiert werden.
Sie vermittelt konservative Werte in Bezug auf Familie und stereotypische Rollenbilder; die Merkmale die von uns verwendet werden, entnahmen wir dem Artikel: Gesellschaftliche Probleme werden ideologisch reguliert - Anmerkungen zum Genre der TV-Familienserien; Jan-Oliver Decker, Hans Krah, Marianne Wünsch; aus: Medien und Erziehung; 41. Jahrgang/Nr 2/April 97/KoPäd; S. 81 – 93
Weiters befinden sich unsere Befragten nicht in der selben Lebenssituation wie die Protagonisten der Serie, denn unsere Zielgruppe setzt sich aus Studentinnen ohne Kinder zusammen (20 – 27 Jahren). Trotzdem nehmen wir an, dass die gezeigte Lebensweise, Relevanz für die zukünftige Familienplanung besitzt.
Das heißt obwohl die Ausbildungsmöglichkeiten und Berufschancen besser sind, ist es dennoch gang und gebe, dass sich Frauen hauptsächlich der Familie widmen.
Außerdem vermuten wir, dass die behandelten Themen in der Serie sehr wohl im Freundes und -bekanntenkreis Gesprächstoff bieten.
Forschungsfragen:
FF1:
Welche Motive für die Rezeption der Serie sind vorhanden, bzw. welche Gratifikationen werden damit verbunden?
FF2:
Verwenden Rezipientinnen kategorisierten Serienmerkmale für ihre individuelle zukünftige Lebensplanung?
Und wenn ja welche?
FF3:
Löst die Serie „Eine himmlische Familie“ durch ihre Themenauswahl und Aufbereitung Diskussionen im Freundes- und Bekanntenkreis aus (bietet sie Diskussionsstoff)?
Hypothesen:
H1:
Die Rezipientinnen der Serie bewerten diese als trivial, dennoch bildet die Serie einen fixen Bestandteil ihres Alltags (Tag für Tag):
H2:
Die in der Serie gezeigte Lebensweise bietet Anstoß zur Auseinandersetzung mit den Themen (Sex/Moral, Mütter/Erziehung,...), die mit Freunden, Bekannten und dgl. In Alltagsgesprächen näher erörtert werden.
H3:
Obwohl die Rezipientinnen die Serie als Ganzes verurteilen und als konservativ einstufen, verwenden sie die selben stereotypen Rollenbilder für ihren zukünftige Lebensplanung.
11.3 Auswertungsgrundlagen
Hier fiel unsere Wahl auf die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, das vor allem für Interviews und verbale Aussagen besonders geeignet scheint. „Das Ziel des Verfahrens besteht darin, Strukturmerkmale eines Textes unter Verwendung eines Kategoriensystems ‚herauszufiltern’.“ (Mayring 1993 in Diekmann 1997, S. 512).
Es wird hier nun immer wieder betont unvoreingenommen und möglichst objektiv an das Material heranzugehen, um somit im Verlauf eine Verallgemeinerung gewährleisten zu können.
Nach dieser Methode sollen nun einige Schritte genau eingehalten werden, nach Mayring[8]:
- Festlegung des Materials:
In dieser Phase muss genau definiert werden, welches Material analysiert werden soll, nachdem der Forscher große Teile des Materials gesichtet hat. Somit werden nur Textstellen ausgewählt in der sich der Interviewte explizit zum Gegenstand der Forschungsfrage geäußert hat.
- Analyse der Entstehungssituation und Formale Charakterisierung des Materials
Hier wird festgehalten, wie das Interview zustande kam und wo, soll heißen korrekt nach der qualitativen Idee, am besten im alltäglichen Umfeld; für unsere konkrete Situation, bei den Inerviewpartnern zu Hause.
Weiters die Form in der das Material vorliegt, bei uns wiederum eine akustische Aufzeichnung auf Band die später transkripiert wurde und somit in schriftlicher Form vorlag.
- Richtung der Analyse:
Wir richteten unser Interesse auf den Gegenstand des Protokolls, also auf die von uns festgelegten Themen und nur am Rande auf den emotionale oder kognitive Befindlichkeit des Interviewten.
- Bestimmung der Analysetechnik:
Mayring unterscheidet drei grundlegende Techniken: Zusammenfassung. Explikation und Strukturierung.
Hierbei geht es darum zunächst das Material zu reduzieren, sodass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben; dann die Textstellen in denen sich der Interviewte für den Forscher unverständlich oder widersprüchlich ausgedrückt hat, zu erläutern und zuletzt das Material zu strukturieren und einzuschätzen aufgrund bestimmter vorab geklärter Kriterien.
- Definition der Analyseeinheit:
Unter diesem Punkt versteht man das Erstellen eines Kategoriensystems, also Merkmale herauszufiltern um den Text beschreiben zu können. Das Kategoriensystem das unserer Analyse zugrunde liegt , findet man im anschließenden Kapitel.
- Analyse des Materials:
Auf der Grundlage der oben genannten Punkte wird nun das Material durchgearbeitet.
- Die Interpretation:
Zum Schluss werden nun die Ergebnisse auf die Hauptfragestellung hin interpretiert, das heißt die individuellen Darstellungen generalisiert um so zu einer Gesamtdarstellung typischer Fälle anhand der Kategorien zu gelangen.
Hiermit wäre die grundsätzliche Vorgehensweise erläutert im Sinne der qualitativen Sozialforschung. „Damit ist der Zweck der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse erreicht, eine große Materialmenge auf ein überschaubares Maß zu kürzen und die wesentlichen Inhalte zu erhalten.“ (Mayring 1988 in Lamnek 1995, S. 216)
12. Ergebnisse
1. Rezeptionssituation: alle von uns Befragten konsumieren grundsätzlich gerne und regelmäßig Jugend – und Familienserien. Bei allen bilden die Serien einen fixen Bestandteil ihres Fernsehalltags.
In allen Fällen ist die Rezeptionssituation der Serie, eine himmlische Familie, dadurch gekennzeichnet, dass sie zumeist allein oder nur in einem sehr engen, intimen Freundeskreis bzw. mit vertrauten Personen erfolgt.
Für die Interviewpartnerinnen stellt die Serie keinen fixen Bestandteil in ihrem täglichen Fernsehkonsum dar, wird aber mindestens 1 mal bis maximal 4 mal in der Woche von ihnen gesehen.
In keinem der Fälle wir die Serie auf beiden Sendern (ORF, VOX) parallel konsumiert, sondern entweder auf ORF oder auf VOX. Die Gründe dafür sind, dass nicht alle unserer Befragten über mehrere Kanäle verfügen und, dass die beiden Kanäle unterschiedliche Staffeln zeigen. Ich schau nur im Kabel, derzeit, weil die Folgen auf ORF alte sind, die ich schon kenn. (vgl. Interview 5)
Wenn eine Folge der Serie verpasst wird, wird von keiner der Interviewpartnerinnen ein besonders großer Aufwand betrieben, wie zum Beispiel ein Besuch auf einer der Fanhomepages um nachzulesen oder die Aufnahme der betreffenden Folge durch einen Videorekorder, um sich darüber zu informieren. In den meisten Fällen informieren sie sich bei Freundinnen über die verpassten Inhalte . Falls irgendwelche wichtigen Themen in da nächsten Folge auftauchen, also soiche die wichtig san für de Handlung, dann wird i mi erkundigen ob des irgendwer vo meine Mitseherinnen gsehn hot, also vo denen mit die i mir des immer anschau. (vgl. Interview 3)
2. Gratifikation ( konkret: Unterhaltung, Entspannung, Eskapismus, Identi- fikation, Gesprächsstoff): wiederholt wurde unter dieser Kategorie die Rolle der Serie als Unterhalter erwähnt. In allen Fällen wurde angeführt, dass die Gschichteln lustig sind und es viel zu lachen gibt. (vgl. Inerview 5) Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist auch die Entspannung, die sich schon während des Konsums einstellt.
Von 2/3 der Befragten wird auch erwähnt, dass die Serie als ein kurzes Entfliehen in eine Traumwelt genutzt wird. Wenn man die Signation hört am Anfang dann weiß man da kommt jetzt das schöne weiße Haus, da kommen schöne weiße Menschen, die schöne Geschichten erleben, die irgendwie nett miteinander umgehen. Man weiß genau man ist nicht mit Gewalt konfrontiert, mit äh allzu kritischen Dingen oder mit Menschen die sich gerade furchtbar hassen, sondern es ist einfach so eine nette kleine Welt. Und in die tauch ich einfach ab und an gern ein. (vgl. Interview 2). Von dieser Teilgruppe wird die Serie auch besonders gerne gesehen, wenn sie sich in einem emotional angespannten Zustand, wie zum Beispiel Stress oder Traurigkeit, befinden.
Keine unserer Interviewpartnerinnen kann sich völlig mit einem der Seriencharaktere identifizieren. Nur zwei der Befragten können sich mit Teilaspekten zweier Protagonistinnen, die Mutter und die jüngste Tochter, identifizieren, wobei beide sehr differenziert vorgehen bei der Auswahl der Identifikationsinhalte. Bei einer der beiden erfolgt eine stärkere Identifikation, da sie selbst in einer sehr religiösen Großfamilie in einer Kleinstadt aufgewachsen ist und selbst auch die jüngste unter den Kindern war. Ihre Identifikation bezieht sich jedoch auf ihre Kindheit und ihren Erinnerungen daran. Im Bezug auf ihre jetzige Lebenssituation kann sie sich wiederum mit keinen der ProtagonistInnen identifizieren. Die übrigen 2/3 können entweder keine Parallelen zu ihrem eigenen Leben ziehen oder haben sich darüber noch nie Gedanken gemacht.
Entgegen unseren Erwartungen wurde die Rolle der Serie als Gesprächslieferant nur teilweise erwähnt bzw. mussten wir sie danach fragen und erhielten sehr differenzierte Ergebnisse. Eine Hälfte der interviewten Personen unterhält sich nicht über die gezeigten Inhalte mit Bekannten und Freunden. Interessant ist hier auch der Aspekt der Rezeptionssituation, da alle drei die Serie ausschließlich alleine sehen möchten. Die Interviewperson 2 begründet dies auch mit dem Stellenwert der Serie in ihrem Freundes und Bekanntenkreis. Das ist einfach zu kitschig, würde ich sagen, für die Leute, die ich kenne. (vgl. Interview 2) Etwas später antwortete sie auch auf die Frage, ob die Serie zu uncool sein um sie weiterzuempfehlen mit den Worten: Ja, schon sehr uncool. (vgl. ebd.) Für die andere Hälfte ist die Diskussion bereits während der Serie und auch danach über die Themen, Familie, Erziehung, Moral, Sex und Drogenproblematik eine wichtige Motivation sich die Serie anzusehen. Das ist der Grund warum wir des anschaun. (vgl. Interview 3 und 4) Wobei sehr darauf geachtet wird, dass es sich bei den Gesprächspartnerinnen ausschließlich um Personen handelt, die die Serie ebenfalls in einer gewissen Regelmäßigkeit konsumieren. Ein interessanter Aspekt ist auch, dass als Gesprächspartner ausschließlich Frauen und keine Männer erwähnt wurden. Dieser Umstand kann damit zusammenhängen, dass Männer diese Serie seltener sehen als Frauen, wurde aber in dieser Untersuchung nicht weiter erhoben.
Die Gesprächsbereitschaft der Befragten mit Freunden und Bekannten beider Geschlechts ist jedoch hinsichtlich anderer Lieblingsserien viel größer als im Fall der himmlischen Familie.
3. Funktion der Serieninhalte für zukünftige Lebensgestaltung (konkret: Erziehungsmethoden, Beziehungsstrukturen, Konfliktlösungen):
bei allen Befragten erregt das Misstrauen der Eltern gegenüber den Kindern, aber vor allem die rigide Kontrolle durch sie, großes Missfallen und wird als nicht erstrebenswert beurteilt. Als ein weiterer negativer und nicht erstrebenswerter Aspekt der Erziehung werden auch die Bestrafungen bei Übertretungen der Verbote angesehen. Für gut bzw. erstrebenswert wird das Gespräch innerhalb der Familie von allen Befragten einheitlich erwähnt.
Die Beziehung zwischen den Eltern wird von allen als gleichberechtigt eingestuft, da Entscheidungen die Familie betreffend, zuerst von den Eltern in Gesprächen erörtert werden. Die Familienstruktur wurde von 1/3 zwar als patriarchalisch eingestuft, diese Beurteilung bezieht sich jedoch auf die traditionelle geschlechterspezifische Rollenaufteilung und nicht auf die Entscheidungsfindung innerhalb der Familie.
Im Bezug auf die Eltern – Kind Beziehung wird immer wieder auf das fehlende Vertrauen, die extreme Kontrolle und die Verhaltensmaßregelungen seitens der Eltern hingewiesen. Von der Hälfte der Befragten wird als positiv bewertet, dass die Eltern als Lebensinhalt die Erziehung ihrer Kinder sehen. Dennoch wird es von ihnen als nicht erstrebendwert angesehen, da dies die Entwicklung der Kinder beeinträchtigt. Kinder sind zu behütet und dann alleine gar nicht lebensfähig. (vgl. Interview 5)
Die Beziehung der Geschwister untereinander wird einheitlich als unrealistisch und zu kitschig wahrgenommen. Außer durch die 1. Interviewpartnerin, die jedoch nur Teilaspekte, durch ihre eigene Kindheit, als sehr realistisch einstuft, im Detail ist damit der Zusammenhalt der Geschwister untereinander gemeint. Die 5. Interviewpartnerin empfindet die Darstellung zwar als unrealistisch aber sehr schön. Ist schon schön so viele Geschwister zu haben, auch einen Zusammenhalt mit den Geschwistern. (vgl. Interview 5)
Die Konfliktlösungsstrategien in der Serie werden sehr differenziert beurteilt. Das Gespräch und die verbale Auseinandersetzung der Beteiligten mit dem Konflikt werden einheitlich als positiv gewertet. Kritisiert wird, dass die es sich bei Gesprächen zwischen den Eltern und Kindern keineswegs um gleichberechtigte Gesprächspartner handelt, sondern, dass die Kinder die Meinungen der Eltern übernehmen müssen und nach den Gesprächen immer bestraft werden. Alle Befragten könnten sich vorstellen, den Ansatz zur Konfliktbewältigung selbst einmal anzuwenden (wenn sie selbst Kinder haben), jedoch die weitere Vorgehensweise der Serieneltern nicht.
Abschließend möchten wir noch hinzufügen, dass alle Interviewpartnerinnen die Serie als eine typische amerikanische Serie empfinden und ihnen die gezeigte Moral im Bezug auf Themen wie Sex und am Abend ausgehen sehr missfallen haben. Weiters haben alle die Serie als sehr unrealistisch in ihrem Gesamten beurteilt, dennoch existieren für die Hälfte der Befragten Teilaspekte, die sie als erstrebenswert empfinden.
Bezüglich unserer erstellten Hypothesen konnte keine völlig verifiziert werden.
H1:
Die Rezipientinnen der Serie bewerten diese als trivial, dennoch bildet die Serie einen fixen Bestandteil ihres Alltags (Tag für Tag):
Durch unsere Ergebnisse ergibt sich für die erste Hypothese die Modifikation, dass die Rezipientinnen zwar sehr wohl die Serie als trivial beurteilen und die einen fixen Bestandteil ihres Fernsehalltages einnimmt, aber nicht jeden Tag sonder mindesten 1 mal und maximal 4 mal die Woche.
H2:
Die in der Serie gezeigte Lebensweise bietet Anstoß zur Auseinandersetzung mit den Themen (Sex/Moral, Mütter/Erziehung,...), die mit Freunden, Bekannten und dgl. In Alltagsgesprächen näher erörtert werden.
Diese wissenschaftliche Vorannahme konnte nur teilweise durch die erhaltenen Ergebnisse bestätigt werden, da die gezeigten Inhalte nur für die Hälfte der Befragten einen Anstoß zu Diskussionen bietet.
H3:
Obwohl die Rezipientinnen die Serie als Ganzes verurteilen und als konservativ einstufen, verwenden sie dieselben stereotypen Rollenbilder für ihre zukünftige Lebensplanung.
Im Bezug auf die Übernahme der stereotypen Rollenbilder für die zukünftige Lebensplanung der Befragten konnten wir keine falsifizierenden oder verifizierenden Ergebnisse erhalten. Stattdessen fanden wir heraus, dass Teilaspekte der Serie hinsichtlich der Erziehungsmethoden, Beziehungsstrukturen und der Konfliktlösungen als erstrebenswert empfunden werden und für die zukünftige Lebensplanung verwendet werden.
9. Conclusio
Das Ziel dieser Arbeit war es, mit Hilfe qualitativer Methoden das Phänomen von Fernsehserien, im speziellen der Familienserie eine himmlische Familie, zu erforschen. Es ging dabei nicht um möglichst allgemeine Erklärungen, sondern um die Durchdringung eines Untersuchungsgegenstandes unter Bezugnahme auf den sich ergebenden Kontext. Im Rahmen dieser Proseminararbeit beschränkte sich die praktische Ausführung auf sechs Interviews, trotzdem konnten interessante Detailaspekte für alle sechs Fälle konstatiert werden. Die von uns aufgestellten wissenschaftlichen Vorannahmen konnten in dieser Untersuchung nicht verifiziert werden. Entgegen den Erwartungen erhielten wir divergierende Ergebnisse. Um jedoch über größere Zusammenhänge verschiedener Bereiche dieses Untersuchungsgegenstand Aufschluss zu bekommen, wäre eine größere Anzahl von Untersuchungspersonen, sowie eine Ergänzung der Methoden um beispielsweise narrative Interviews von Nöten.
14.Literaturverzeichnis
Decker, Jan-Oliver; Krah, Hans; Wünsch, Marianne: Gesellschaftliche Probleme werden ideologisch reguliert - Anmerkungen zum Genre der TV-Familienserien; aus: Medien und Erziehung; 41. Jahrgang/Nr 2/April 97/KoPäd; S. 81 – 93
Denzin / Lincoln (1994): Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, Calif.
Diekmann, Andreas (1997): Empirische Sozialforschung. Reinbeck: Rowohlts.
Flick, Uwe (1996): Qualitative Forschung. Hamburg: Rowohlt .
Gehrau, Volker (2001) : Fernsehgenres und Fernsehgattungen. In: Brosius, Hans-Bernd (Hg.): Angewandte Medienforschung, Schriftenreihe des Medieninstituts Ludwigshafen. München: Verlag Reinhard Fischer.
Gleich, Uli: Funktionen von Soap operas für die Zuschauer. In: Media PerspektivenI/98, S. 46 –50.
Göttlich, Udo (1995): Der Alltag als Drama – Die Dramatisierung des Alltags. In: Müller-Doohmt, Stefan/Neumann-Braun, Klaus (Hg.): Kulturinszenierungen. Frankfurt am Main 1995.
Kaspar, Barbara (1997): Kommunikationsmethoden und Vermarktungsstrategien von Vorabendserien. Diplomarbeit. Wien.
Lamnek, Siegfried (1995): Qualitative Sozialforschung. Band 2. Weinheim: Beltz.
Mayring, Philipp (1999): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Weinheim: Psyhologie Verlags Union.
Mikos, Lothar (1994): Es wird dein Leben! – Familienserien im Fernsehen und im Alltag der Zuschauer. Münster: Verlag MAkS-Publ.
Steinberger, Eva (2000): Der Beitrag von Sitcom-Serien zur sozialen Lebensbewältigung in Familien. Diplomarbeit. Wien.
world wide web:
Hummel, Andreas: Kennzeichen der “Soap Opera”. In: Medien Observationen. www.medienobservationen.uni-muenchen.de, 20.11.2001.
Tebbich, Heide: Soapmania! die Erfolgstory der Seifenopern. In: Österreichisches Institut für Jugendforschung. www.oeij.at, 19.11.2001.
Neitzel, Stephanie/Weyer, Viktoria: Daily Soaps. www.schulen.hagen.de, 19.11.2001. www.angelfire.com.
14. Anhang
Interview und Leitfaden:
Schwerpunkte:
1. Stellenwert der Serie für die Rezipienten im Alltag
2. Motiv und Nutzen des Serienkonsums für Rezipientinnen
3. Funktion der Serieninhalte für zukünftige Lebensgestaltung
Einleitend:
Ich schreibe gerade an einer Seminararbeit über die Serie „Eine himmlische Familie“, weil ich sie selber oft sehe. Du solltest mir nun so frei wie möglich deine Meinung kundtun. Ich kann dir garantieren, dass du völlig anonym bleiben wirst, auch wenn ich ein Tonband mitlaufen lasse...
- Stellenwert der Serie
Schaust du gerne Serien?
Welche sind deine Lieblingsserien?
Seit wann kennst du die Serie?
Weißt du wann und wo die Serie läuft?
Die Serie läuft ja immer am Nachmittag oder am Abend auf verschiedenen Kanälen
wie oft würdest du sagen siehst du die Serie innerhalb einer Woche?
- Siehst du sie auch parallel im Kabel?
Was machst du wenn du eine Folge verpasst?
Siehst du sie in Gesellschaft oder alleine?
- Schauen sich deine Freunde die Serien auch an?
- Würdest du sie lieber in Gesellschaft sehen?
- Wenn ja warum?
- Wenn nein warum?
Welchen Stellenwert nimmt sie in deinem Fernsehalltag ein (läuft sie nebenbei)?
- Motiv und Nutzen
Warum spricht sie dich an?
- Wie würdest du die Serie jemandem, der sie noch nie gesehen hat beschreiben?
- Wie würdest du die Serie einstufen bzw. bewerten?
- Wieso könntest du sie weiterempfehlen oder auch nicht?
Wie würdest du die Familienstruktur beschreiben?
- ist sie liberal, patriachalisch, konservativ – wieso?
Welcher Charakter gefällt dir am besten?
Kannst du dich mit diesem identifizieren?
Warum?
Warum nicht?
An welche Themen kannst du dich erinnern die in der „himmlischen Familie“ behandelt werden?
Fällt dir konkret eine Szene ein?
Bitte, beschreib diese?
- Gefällt dir der Umgang mit den Konflikten und warum?
- Würdest du es anders machen wenn du in derselben Situation wärst?
- Warum, warum nicht?
- Unterhältst du dich mit Freunden darüber was in der Serie passiert?
Wie du es anders gemacht hättest oder diskutiert ihr darüber wie man es lösen könnte
Wenn ja
- Lösen die Probleme der Charaktere Diskussionen bei dir und deinen Freunden aus?
- Über welche Themen unterhaltet ihr euch?
- Funktion der Serieninhalte für zukünftige Lebensgestaltung
Willst du einmal Familie haben?
- Versuch in die Zukunft zu sehen ... wie siehst du dich in einer Familie?
- Wie wichtig ist es dir bei deiner Familie zu sein?
- Würdest du weiterarbeiten?
Wie hat es in deiner Familie ausgesehen?
- Sind deine Eltern getrennt?
- Wie viele Geschwister hast du?
Wärst du gerne in so einer Familie wie die „himmlische Familie“ aufgewachsen?
- Warum, warum nicht?
- Demographische Daten
Alter
Wohnort
Geschlecht
Geburtsort
Abschluss:
Danke das war´s also, dann bedank ich mich noch recht herzlich für deine Mitarbeit und deine Zeit die du mir zur Verfügung gestellt hast.
Inerview 1:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Interview 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Interview 3 :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Interview 4:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Interview 5
Alter: 27
Wohnort: Wien
Geschlecht: weiblich
Geburtsort: Wien
Einleitung
I: Ich schreibe gerade an einer Seminararbeit über die Serie „Eine himmlische Familie“, weil ich sie selber oft sehe. Du solltest mir nun so frei wie möglich deine Meinung kundtun. Ich kann dir garantieren, dass du völlig anonym bleiben wirst, auch wenn ich ein Tonband mitlaufen lasse. Ist das für dich in ordnung? Können wir anfangen?
B: Ja klar.
Stellenwert der Serie
I: Schaust du gerne Serien an?
B: Das kommt auf die Serie an. Nicht jede, manche, aber die Serien heutzutage sind zum Großteil nicht mehr sehenswert. Ich schaue eher ältere Serien an.
I: Was sind denn deine Lieblingsserien?
B: Die himmlische Familie, die Nanny.
I: Also eher Familienserien?
B: Nicht nur.
I: Und seit wann kennst du die Serie himmlische Familie?
B: (überlegt) Die kenne ich seit Ende des Jahres 99.
I: Weißt du wo und wann die Serie läuft?
B: Ja. Am Nachmittag oder Vorabend auf verschiedenen Kanälen.
I: Wie oft schaust du dir die Serie innerhalb einer Woche an?
B. Auch das ist unterschiedlich. Es gibt Wochen da schaue ich sie dreimal und es gibt Wochen, da schaue ich sie gar nicht. Also ich schau sicher sehr unregelmäßig.
I: schaust du auch paralell im Kabel?
B: Ich schau nur im Kabel, derzeit, weil die Folgen auf ORF alte sind, die ich schon kenn.
I: Und was machst du, wenn du eine Folge versäumst?
B: (leicht verdutzt) Na nix. (lacht)
I: Also ist das nicht schlimm?
B: Na, das ist mir ziemlich wurscht.
I: Schaust du die Serie in Gesellschaft oder alleine an?
B: (sehr bestimmt) alleine.
I: Schauen sich Deine Freunde die Serie auch an?
B: Teilweise.
I: Würdest du sie lieber in Gesellschaft oder mit deinen Freunden sehen?
B: Das ist mir wurscht. (lacht ein bisschen), wirklich, das is mir wurscht.
I: Welchen Stellenwert nimmt die Serie in deinem Fernsehalltag ein?
Läuft sie nur so nebenbei, so plätschernd, oder schaust du sie dir so richtig bewusst an?
B: Also wenn ich sie mir anschau, dann schau ich sie richtig an, aber ich hab keinen Fernsehalltag. (Auf meinen fragenden Blick:) Ich schau nicht täglich fern, das ist kein Scherz.
I: Das macht ja nichts, dann ist dein Fernsehalltag eben unregelmäßiges Schauen. Es ist nicht so wichtig ob du täglich fernsiehst, oder nur ab und zu. Du hast trotzdem ein gewisses Fernsehverhalten, so gesehen ist das dann dein Fernsehalltag und das würde ich gerne wissen.
B: Nein wirklich, du kannst die ... fragen, ich schau nicht viel fern.
Motiv und Nutzen
I: Na gut dann eine andere Frage: Warum spricht dich die Serie an?
B: Ah..., das ist irgendwie so eine Serie bei der man sich nacher gut fühlt, das ist so eine heile Welt Serie, so eine moralische Familie,... irgendwie so. Außerdem sind die Menschen hübsch, die Gschichteln sind lustig, es gibt auch viel zu lachen und ich finde es schauspielerisch ziemlich gut dargestellt.
I: Und wie würdest du die Serie jemandem der sie noch nie gesehen hat beschreiben?
B: (denkt etwas nach) Eine Serie, bei der es sich um eine Großfamilie handelt, deren Vater Priester ist, die sehr konservativ ist, sehr moralgeprägt, sehr erzieherisch, also ich glaube es ist die perfekte Serie für junge Mütter, weil so viele erzieherische Elemente drinnen sind.
I: Also würdest du sagen, dass diese erzieherischen Elemente nachahmenswert sind?
B: Zum Teil, nicht alle.
I: Also inwiefern könntest du die Serie weiterempfehlen, oder auch nicht?
B: Das kommt immer drauf an warum jemand fernsieht, oder was er sich von einer Fernsehserie erwartet. Also die muß man schon konkretisieren die Frage, weil jemand der an solchen Familiengeschichten Interesse hat, und ahm... (schweigt).
I: Naja, es ist doch oft so, dass wenn einem etwas sehr gefällt, empfiehlt man es weiter, weil man es einfach gut findet. Man fragt ja nicht vorher, ob sich der andere überhaupt für so etwas interessiert, sondern empfiehlt es aus eigener Überzeugung weiter. Bei anderen Dingen wieder, warnt man den anderen schon vor, weil man etwas eben schlecht, nicht so interessant, also nicht empfehlenswert findet. Könntest du da irgendeine Zuordnung machen?
B: Ich kann mir vorstellen, dass die Serie für viele Menschen zu spießig ist, zu sehr heile Welt und, ...äh... zu unmodern ist, in vielerlei Hinischt. Und dass das wirklich begeisterte Zuschauerspektrum vielleicht gar nicht so groß ist.
I: Wie würdest du die Familienstruktur in der Serie beschreiben? Ich meine damit ist sie eher liberal, oder patriarchalisch, oder konservativ, ...
B: Sehr konservativ.
I: Könntest du das ein bisschen beschreiben?
B: Naja, der Vater ist Priester, die Mutter ist eine gebildete Hausfrau und sie haben sieben Kinder unterschiedlichster Altersklassen, also ich glaube von 0 – 20 Jahren. Äh..., die Eltern sind geteilte und gemeinsame Oberhäupter der Familie, also es ist sicher nicht patriarchalisch, in diesem Punkt ist es sehr modern, weil weder Mutter noch Vater irgendetwas tut, ohne Einverständnis des jeweils anderen Ehepartners. Die Kinder unterliegen einer sehr strengen Kontrolle der Eltern und sind sehr konservativ erzogen, und sollen das auch weitergeben an ihre jüngeren Geschwister. Also es ist ganz deutlich dass sie immer aus allem was sie tun lernen sollen und das auch weitergeben sollen, im Gedankengut der Eltern. Äh... was war die Frage ursprünglich nocheinmal?
I: Wie würdest du die Familienstruktur beschreiben? Liberal, oder konservativ?
B: Schon liberal, aber trotzdem konservativ. Liberal in dem Sinne, das sie ihre Kinder zum Teil, soferne das nicht irgendwelche Drogen- oder Alkoholgeschichten, oder ähnliches sind, wo ihnen die Kinder richtig entgleiten könnten sind, ähm, also abgesehen davon also sind sie sehrwohl der Ansicht, dass ihre Kinder die Dinge tun sollen, die sie sich vorstellen, also insofern liberal sind, und dann aus ihren eigenen Fehlern lernen sollen. Sie verbieten ihnen nicht grundsätzlich alles, aber trotzdem haben sie ein sehr konservatives Gedankengut und leiten die ganze Familienstruktur auf eine typisch amerikanisch, moralische, konservative Art, und sehr durch das priesterliche Amt des Vaters geprägt. Also immer mit dem Gotteshintergrund.
I: Welcher Charakter gefällt dir am besten?
B: (überlegt ein bisschen) die Mutter.
I: Und könntest du erklären warum, kannst du dich mit ihr identifizieren?
B: Teilweise.
I: Warum gefällt sie dir am besten?
B: Sie gefällt mir deshalb am besten, weil äh, sie eine sehr starke Frau ist, weil sie nicht so extrem konservativ angehaucht ist wie der Vater, das heißt es sind im Laufe der Serie auch gewisse Jugendsünden der Mutter besprochen worden, oder hervorgekommen, wie z.B. dass die Mutter schon Joints geraucht hat in ihrer Jugend, was den Vater unheimlich entsetzt hat, nur so als Beispiel. Und man also das gefühl hat das die Mutter irgendwie die, die ist nicht so heilig wie der Vater, Die hat mehr Fehler sag ich mal, und erzieht ihre Kinder im Einverständnis mit ihm, oder im gegenseitigen Gedankengut mit ihm wohl sehr konservativ und streng, aber trotzdem auf eine jugendliche Art und Weise. Also sie ist konservativ und trotzdem jugendlich. Und das gefällt mir an ihr. Außerdem hat sie einen irren Job, weil sieben Kinder zu erziehen und trotzdem den Haushalt zu schupfen,... und jetzt in den letzten Folgen hat sie glaub ich auch angefangen zu studieren, nebenbei, also das... Sie hat ja ein abgeschlossenes Studium aber sie wollte wieder zurück an die Uni.
I: Achso, das hab ich gar nicht mitbekommen.
B: Ja, ja, ich weiß zwar nicht mehr was, aber sie hat studiert. Also die imponiert mir sehr. Außerdem finde ich, dass sie schauspielerisch ganz köstlich ist, also über die kann ich lachen, die schneidet manchmal Grimassen...
Die ist von den beiden Eltern vielmehr dijenige, wo man auch Eindrücke in ihre private Gefühlswelt hat, die ich nachvollziehen kann. Das mag auch daran liegen, dass sie auch eine Frau ist. Das kann ich bei ihm nicht so gut. Aber sie zeigt sich auch mal enerviert, und als ob sie die Nase voll hätte von den vielen Kindern und ihrem Alltag, währen er immer so dieses „ja, und die Famile...“ also dieses Heiligenscheingerede hat. Du glaubst immer, der steht vor seiner Kirche und predigt. Mich persönlich nervt das manchmal, diese Art zu reden. Und sie hat viel mehr Temperament als er, sie ist viel aggressiver und temperamentvoller.
I: An welche Themen kannst du dich erinnern, die in der himmlischen Familie behandelt werden?
B: Die Teenager-Liebesbeziehungen der Kinder, Drogengeschichten, Familienschicksale diverser Gemeindemitglieder, die dann meistens in irgendeinem Zusammenhang stehen mit der eigenen Familie. Sei es dass die Kinder befreundet sind, oder dass irgendjemand aus dieser Campden-Familie in Kontakt steht mit der anderen Familie Schulgeschichten, aber hauptsächlich die Liebesgeschichten der Kinder, die sind immer ein sehr großes Thema.
I: Fällt dir konkret eine Szene ein, die dich besonders amüsiert, beeindruckt hat, oder die du dir aus irgendeinem Grund besonders gemerkt hast?
B: Na besonders amüsiert hat mich zum Beispiel die Szene, als die Mutter Campden mit den Zwillingen in den Wehen liegt, im Krankenhaus, und die ganze Familie im Krankenhaus versammelt ist und so Familiengeschichten aufwärmt und sich darüber unterhält. Und der älteste Sohn Mat sollte Blut spenden gehen und hat sich nicht getraut. (grinst) und der Vater hat ihn immer wieder Blut spenden geschickt, weil die Wehen so lange gedauert haben, damit er was zu tun hat und ihn nicht nervt mit diversen Fragen, wanns denn endlich soweit ist, u.s.w. und Mat hat sich nicht getraut Blut spenden zu gehen (lacht) und äh der jüngere Bruder Simon ist in der Spitalskapelle gesessen und hat gebetet dass er Brüder bekommt, weil er hat sich so sehr Brüder gewünscht und Mat hat ihm dann zugehört beim Beten in der Kirche, als er gesagt hat er möchte sogern ein Vorbild für seine Brüder sein, so wie es sein älterer Bruder für ihn war. Und da war Mat ganz gerührt, und dann hat er gesagt er geht jetzt sofort Blut Spenden, weil jetzt weiß er wozu er auf der Welt ist, u.s.w., und dann ist er dort hingegangen und hat sich dort auf das Bett geschmissen (lacht) sichtbar voller Angst, hat sich voll in die Hosen gemacht und trotzdem beschlossen Blut zu spenden und na ja, er ist dann halt ohnmächtig geworden und so, na es war auf jeden Fall lustig. Aber da gibt es viele Szenen, bei denen ich lachen musste.
I: Und gefällt dir der Umgang mit den Konflikten in der Serien?
B: Teilweise.
I Warum?
B: Also jetzt rein auf Konflikte bezogen? Hm...
I: Überhaupt die Problemlösungen allgemein
B: Na wenn man jetzt rein an die Konflikte denkt, oder die Problemlösungen im großen und ganzen, ist das ganz ok. Das geht in Ordnung. Wobei ich ja der Ansicht bin, dass die jüngste Tochter, die Ruthie, immer ein bisschen bevorzugt wird. Also die ist der verwöhnte Fratz, dem wesentlich mehr verziehen wird, als den anderen. Und die Konfliktlösungen, oder... Also es geht bei ihnen immer darum, dass wenn jemand irgendetwas falsch gemacht hat, dann wird er bestraft. Also es gibt immer eine Strafe, und die sprechen das auch so aus: „ich muß dich jetzt bestrafen, weil du was falsch gemacht hast.“ Oder „Du weißt, dass du jetzt eine Strafe bekommst.“ Und das find ich halt nicht wirklich ansprechend, aber sie lösen das eigentlich eh ganz ok. Und die Kinder wissen ja auch ganz genau, dass sie dann eine Strafe bekommen werden, aber sie machens halt trotzdem.
I: Also würdest du es anders machen, wenn du in derselben Situation wärest?
B: Kommt auf die Situation an, das kann ich nicht so sagen. Möglicherweise, vielleicht auch nicht.
I: Könntest du eine bestimmte Stuation aussuchen?
B: Na ich finde, dass man bei dieser Serie, was Konfliktlösungen anbelangt, oder die Art und Weise Themen zu behandeln, dass man sich einiges sogar abschauen kann, und dass es ganz gute Vorschläge gibt, wie man das machen kann, aber auf der anderen Seite gibt’s halt auch Themen, das sind jetzt nicht unbedingt Konflikte, aber das sind Themen, äh, die sie ihren Kindern beibringen, die mir nicht gefallen, oder was ich nicht machen würde. Z.B. dass sie den Kindern sagen, Sex vor der Ehe ist schlecht. Sex sollte man erst in der Ehe haben. Das halt ich für einen Blödsinn, also das find ich ganz schlecht, als Beispiel. Aber kleinere Konfliktlösungen, ja.
I: Unterhältst du dich mit Freunden über die Serie oder deren Inhalte.
B: Nein. (fast entgeistert)
Funktion der Serieninhalte für zukünftige Lebensgestaltung
I: Willst du einmal Familie haben?
B: Ja.
I: Wenn du versuchst in die Zukunft zu sehen, wie siehst du dich in einer Familie?
B: Na als Mutter. Ha ha ha (lacht), ich mein.
I: Na klar, aber von der Rolle her.
B: Na ich bin mir sicher, dass ich eine strenge Mutter sein werde. Eine strenge und in gewissem Maße auch konservative Mutter, und ..., das vermute ich, anhand dessen, wie ich halt selber bin, aber ich glaub doch, das ich ähnlich wie meine Mutter, doch immer eine lange Leine lassen werde, oder alles für meine Kinder tun werde und trotzdem eine gewisse Strenge an den Tag legen werde. In einem konservativen Sinne, vor allem was Benehmen anbelangt.
I: Würdest du da Parallelen zur Annie sehen?
B: Ja schon.
I: Findest du deshalb auch, dass du dich am ehesten mit ihr identifizieren könntest?
B: Naja, noch am ehesten von allen diesen Rollen, weil da kann man sich wahrscheinlich am ehesten mit einer gleichgeschlechtlichen Rolle identifizieren und die Kinder sind ja noch unausgereift, die sind ja noch Jugendliche oder Kinder, die wohl ihren eigenen Charakter haben, aber am sympatischsten ist mir die Rolle der Mutter.
I: Würdest du so sein wollen wie die Annie?
B: (fast entrüstet) Nein, ich bin ich und ein eigener Mensch, was ist denn das für eine Frage?
I: Natürlich bist du ein eigener Mensch, ich meine eher ob dir gefällt wie sie die Probleme löst. Oder anders gefragt, wenn du einmal Familie hast, könntest du dir vorstellen, dass du das so ähnlich machen wollen würdest wie die Annie?
B: In manchen dingen ja, aber sicher nicht in allen Dingen.
I: Wie wichtig wäre es dir bei deiner Familie zu sein?
B: schweigen
I: Oder anders gefragt: würdest du weiterarbeiten?
B: Ich würde auf jeden Fall weiterarbeiten.
Schweigen.
I: Also würdest du auf keinen Fall zu hause bleiben?
B: Das ist schwer zu sagen. Wenn ich einen Mann hätte, der genug Kohle verdient, vielleicht. Aber eigentlich ist das nicht mein Ziel. Ich kann mir nicht vorstellen nur Hausfrau zu sein. (denkt nach, schüttelt den Kopf) nein.
I: Wie hat es in deiner Familie ausgesehen? Hast du Geschwister?
B: Ich habe eine ältere Schwester und meine eltern haben sich scheiden lassen als ich 17 war. Aber eigentlich bin ich sehr behütet aufgewachsen.
I: Wärst du gerne in so einer Familie wie die himmlische Familie aufgewachsen?
B: (überlegt) Keine Ahnung!
I: Denk ein bisschen nach. Warum ja, warum nicht?
B: Warum ja. ... Weil ich erstens glaube, dass es schön ist so viele Geschwister zu haben und v.a. auch einen Zusammenhalt mit den Geschwistern zu haben. Weil es sicher schön ist, auf der einen Seite Eltern zu haben, deren Lebensinhalt es ist für ihre Kinder da zu sein und ihre Kinder zu erziehen. Weil das ist bei denen so, es dreht sich immer alles nur um die Familie, mit wenigen ganz wenigen Ausnahmen. Das ist sicher schön.
Auf der anderen Seite, nein, wäre ich nicht gerne in so einer Familie aufgewachsen, weil mir die Kontrolle oder die Einmischung in das Leben der Kinder zu stark ist. Aber das liegt sicher daran, dass diese Kinder noch jung sind. Und ich kann vom jetzigen Standpunkt aus, ich bin einfach schon zu alt, und die Serie ist noch nicht soweit, dass man sieht wie sich die verhalten wenn ihre Kinder erwachsen und schon aus dem Haus sind. Beim Mat hat man das miterlebt, der ist schon ausgezogen und führt ein eigenes Leben. Der ist aber lange Zeit ohne seine Familie gar nicht lebensfähig gewesen. Und das liegt sicher daran, dass er in diesem Gluckenhaus und so beschützt aufgewachsen ist. Und das halte ich eben für nicht gut.
Abschluss
I: Ok, das wars. Ich danke dir für deine Mitarbeit und die Zeit, die du mir zur Verfügung gestellt hast.
Interview 6
Alter: 25
Wohnort: Wien
Geschlecht: weiblich
Geburtsort: Wien
Einleitung
I: Ich schreibe gerade an einer Seminararbeit über die Serie „Eine himmlische Familie“, weil ich sie selber oft sehe. Du solltest mir nun so frei wie möglich deine Meinung kundtun. Ich kann dir garantieren, dass du völlig anonym bleiben wirst, auch wenn ich ein Tonband mitlaufen lasse. Können wir anfangen?
B: Ja gut.
Stellenwert der Serie
I: Schaust du gerne Serien?
B: Ja. (lacht)
I: Welche sind deine Lieblingsserien?
B: Reich und Schön, eine himmlische familie, ich weiß nicht, mir fallen jetzt keine ein. (lacht)
I: Seit wann kennst du Serie „Eine himmlische Familie“?
B: Weiß ich nicht.
I: Weißt du wann und wo die Serie läuft?
B: Na nicht wirklich. Oja, im ORF.
I: Ja genau, sie läuft immer am Nachmittag oder auch am Vorabend in verschiedenen Kanälen. Wie oft, würdest du sagen, schaust die Serie innerhalb einer Woche an?
B: Zwei oder dreimal, vielleicht.
I: Schaust du sie dir auch parallel im Kabel an?
B: Nein.
I: Was machst du, wenn du eine Folge verpasst?
B: Mich umbringen (lacht schallend).
Wir müssen beide lachen.
I: Siehst du die Serie in Gesellschaft oder alleine?
B: Alleine.
I: Schauen sich diene Freunde die Serie auch an?
B: (sofort) Nein.
I: Würdest du dir die Serie lieber in Gesellschaft anschauen?
B: (sofort) Nein.
I: Warum nicht?
B: Weil ich alleine Fernschaue. Wenn ich in Gesellschaft bin, brauche ich nicht fernschauen.
I: Welchen Stellenwert nimmt die Serie in Deinem Fernsehalltag ein?
B: schweigt
I: Schaust du sie dir nebenbei an, oder schaust du sie dir ganz bewusst an?
B: Ich schaue sie dazwischen an, nebenbei und oft auch nicht ganz.
Motiv und Nutzen
I: Warum spricht dich die Serie an?
B: Weil sie einfach nett ist und eine gute Berieselung.
I: Wie würdest du die Serie jemandem der sie nicht kennt beschreiben?
B: Naja, Familie, viele Kinder, die Moral kommt durch. Naja Familienprobleme werden gelöst ohne Gewalt und na ja, so gutes Vorbild sein, halt immer moralisch richtig handeln. Den Kindern das vermitteln wollen und so. Spaß in der Familie.
I: Würdest du die Serie weiterempfehlen, oder nicht, und warum?
B: Also ich finde sie nicht so herausragend, dass ich sie weiterempfehlen würde, also ich würde sie eigentlich nicht witerempfehlen, also, jeder dem fad ist, der soll sich’s halt anschauen, (lacht) aber ich würd nicht auf die Idee kommen sie irgendjemandem zu empfehlen.
I: Wie würdest du die Familienstruktur beschreiben? Patriarchal, lieberal, konservativ,...
B: Nja, also ich glaube sie soll so ganz liberal rüberkommen, aber im Grunde find ich sie eigentlich sehr konservativ.
I: Wieso?
B: Naja, ich hab sie gerade erst vorher wieder gesehen. Und das war irgendwie so... Also der Vater spioniert den Kindern nach, weil er kein Vertrauen hat und die Vertrauensbasis weg ist und es war irgendiwie...
Der kleiner Sohn hat Zigaretten gehabt für ein Projekt und da haben sie geraucht, na und das war gleich ein Skandal mit Strafe, ja es gibt immer eine Strafe und die Eltern reden immer darüber, wie sie die Kinder bestrafen sollen. Aber trotzdem ist das dann immer irgendwie nett, also eine nette Strafe, aber trotzdem ist es immer so das Strafensystem.
I: Und welcher Charakter gefällt dir am besten?
B: Die Ruthie.
I: Wieso, kannst du dich mit ihr identifizieren, oder warum gefällst sie dir so gut?
B: Nein , identifizieren nicht, aber die find ich einfach süß. Also nett.
I: An welche Themen kannst du dich erinnern, die behandelt werden?
B: Knutschen, Drogen, Aufzucht der Kinder, Haushalt, alltägliche Dinge.
I: Fällt dir konkret eine Szene ein?
B: Ja, das heute mit den Zigaretten. Wo sie dann halt darüber gesprochen haben und der Kleine zum Vater sagt: „Ich weiß, Zigaretten sind schlecht und sie verursachen Krebs.“ Naja, das war halt sehr... schweigt.
I: Gefällt dir der Umgang mit den Konflikten in der Serie?
B: Jein.
I: Wieso ja, wieso Nein?
B: schweigt... Na ich weiß nicht.
I: Findest du, dass die Konflikte gut gelöst werden?
B: Naja, ich weiß nicht, ob die Konflikte überhaupt gelöst werden. Es wird halt kurz darüber gesprochen und dann kommt eine Strafe, aber ob das Problem jetzt wirklich gelöst wurde...
I: Würdest du es anders machen, wenn du in der gleichen Situation wärst.
B: Das weiß ich nicht, weil ich keine sieben Kinder hab. Ich hab keine Ahnung und das interessiert mich eigentlich auch überhaupt nicht.
I: Unterhälst du dich mit Freunden darüber, was in der Serie passiert?
B: (sofort) Nein. Bleib ich da eh anonym?
I: Ja natürlich, da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Das Interview wird auch nur für eine Seminararbeit verwendet und du bleibst ganz sicher anonym. Bist du damit einverstanden, dass wir noch ein bisschen weitermachen?
B: Ja, das ist ok.
Funktion der Serieninhalte für zukünftige Lebensgestaltung
I: Möchtest du einmal Familie haben?
B: Vielleicht.
I: Versuche in die Zukunft zu sehen. Wie siehst du dich in einer Familie?
B: Das weiß ich nicht.
I: Wenn du dir vorstellst, irgendwann werde ich eine Familie haben, oder auch nicht, in welcher Rolle siehst du dich da? Oder wie stellst du dir das vor?
B: überlegt. Ich hoffe, dass meine Kinder recht selbständig sind und das ich einen Partner habe, der sich auch beteiligt an der Sache.
I: Wie würdest du dich selbst einstufen? Hast du eher ein traditionelles Familienbild oder eher ein liberales...?
B: Na ich glaub eher traditionell. Oder traditionell mit liberalen Tendenzen.
I: Wie wichtig wäre es dir bei deiner Familie zu sein?
B: Sehr wichtig.
I: Würdest du weiterarbeiten?
B: Ja. Es kommt darauf an wie viele Kinder man hat. Mit einem Kind ist das sicher nicht so ein Problem, aber mit dreien glaub ich nicht, dass es so nett ist zu arbeiten. Es kommt auch drauf an welcher Beruf das ist. Wenn ich in einem Beruf bin, der mich sehr ausfüllt und mir Spaß macht, glaub ich schon, dass ich im Beruf bleiben werde.
I: Wie hat das in deiner Familie ausgesehen?
B: Meine Eltern haben sich als ich sechs war scheiden lassen. Meine Mutter war berufstätig und ich war im Halbinternat.
I: Hast du Geschwister?
B: Nein.
I: Wärst du gerne in so einer Familie wie der „himmlischen Familie“ aufgewachsen?
B: (sofort) Nein, das wär mir viel zu mühsam?
I: Weshalb?
B: Na ich weiß nicht. Vielleicht wär es ja nett Geschwister zu haben, aber nicht so viele und mir sind auch die Altersunterschiede zu groß. Außerdem ist die Serie für mich nicht sehr realistisch. Die Eltern wirken auch viel zu jung für diese vielen Kinder. Nein und überhaupt, dauernd diese Kontrolle, das wäre nichts für mich. (schweigen) warst das jetzt?
Abschluss
I: Ja, im Prinzip sind wir schon fertig. Danke für deine Mitarbeit und für die Zeit, die du dir genommen hast.
[...]
[1] Vgl. http://www.hapees-7thheaven.de/
[2] Vgl. Decker, Krah, Wünsch: Gesellschaftliche Probleme werden ideologisch reguliert – Anmerkungen zum Genre der TV-Familienserien; aus: Medien und Erziehung, 41. Jahrgang/Nr. 2/April 1997/KoPäd; S. 82 - 93
[3] Vgl. Mayring 1996
[4] Lit.: Jahoda, Marie (1996): Die Arbeitslosen von Marienthal. Frankfurt am Main: Suhrkamp
[5] Vgl. Blumer 1973
[6] Vgl. Flick 1996
[7] Vgl. Diekmann1997
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen im Inhaltsverzeichnis?
Die Hauptthemen umfassen eine Einleitung, Hintergrund und Geschichte von Soaps, entscheidende Kriterien für Soaps, andere Seriengenres, TV-Serien im Allgemeinen, gesellschaftlicher Wandel, die TV-Familienserie "Eine Himmlische Familie", das Genre der Familienserie, ein Überblick der Geschichte des qualitativen Denkens, zur Theorie qualitativer Forschung, Forschungsdesign, Ergebnisse, Conclusio, Literaturverzeichnis und ein Anhang mit Interviews.
Was sind "Domestic Novels", "Radio Soap Operas", "Daytime Serials", "Daily Soaps" und "Prime Time Soaps"?
Dies sind verschiedene Phasen und Formen von Seifenopern, die sich von literarischen Vorformen (Domestic Novels) über Radioformate (Radio Soap Operas) bis hin zu Fernsehformaten (Daytime Serials, Daily Soaps, Prime Time Soaps) entwickelt haben und sich hinsichtlich Zielgruppe, Inhalt und Produktionsbudget unterscheiden.
Welche Kriterien sind entscheidend für Soaps?
Entscheidende Kriterien sind das offene Ende der Episoden, der Endloscharakter der Handlung, Cliffhanger am Ende jeder Episode, Zopfdramaturgie und Teaser zu Beginn jeder Episode.
Welche Haupthandlungsstränge gibt es in Soap Operas?
Die Haupthandlungsstränge umfassen kriminelle und andere unwillkommene Aktivitäten, soziale Probleme, medizinische Entwicklungen sowie Liebes- und Eheprobleme.
Was sind die Merkmale von TV-Serien im Allgemeinen?
Merkmale sind gleichbleibender Vor- und Abspann, Kennmelodie, gleiche musikalische Motive, immer gleiche Hauptfiguren und teilweise immer gleiche Drehorte.
Wie haben sich Identifikationsmöglichkeiten und Motivation im Bezug auf TV-Serien entwickelt?
Die fiktive Alltagsnähe lädt zur Identifikation und zum Vergleich mit den Protagonisten ein, wobei die Vielzahl an Personen, Beziehungen und Geschehnissen es dem Rezipienten ermöglichen, ganz unterschiedliche Positionen einzunehmen. Junge Menschen, die oft als Singles in der Großstadt leben, ersetzen soziale Kontakte durch Daily Soaps, und die Serie bieten die Möglichkeit, aus dem eigenen Alltag zu fliehen, abzuschalten und sich in die Welt der Serienhelden zu begeben.
Wie hat sich die Gesellschaft im Wandel auf Familienserien ausgewirkt?
Das Seriengeschehen im Fernsehen reagiert auf die Umbrüche in der Gesellschaft, indem es Darstellungen sozialer Gemeinschaften und die Bewältigung des Zusammenlebens zeigt, die einerseits sehr humorvoll sind, andererseits durchaus Problemstellungen innerhalb sozialer Gemeinschaften aufzeigen und Lösungen anbieten.
Was ist "Eine Himmlische Familie" für eine Serie?
Eine US-amerikanische Familienserie, die das Leben einer Pfarrersfamilie mit sieben Kindern in einer Kleinstadt in Kalifornien darstellt.
Wer ist Aaron Spelling und was hat er mit der Serie zu tun?
Aaron Spelling ist der Produzent der Serie "Eine Himmlische Familie" und ein bekannter Fernsehproduzent, der auch für andere erfolgreiche Serien wie "Dallas", "Beverly Hills, 90210" und "Melrose Place" verantwortlich ist.
Was sind die Merkmale des Genres der Familienserie?
Die Serie konzentriert sich auf eine oder mehrere Familien, deren Leben zyklisch und zukunftsorientiert verläuft und an einen festen Handlungsort gebunden ist. Die Stories basieren auf familiären Interaktionsstrukturen und Beziehungen der Familienmitglieder untereinander sowie mit anderen Personen. Typisch ist die Darstellung eines idealen Familienmodells, welches durch traditionelle Rollenbilder und einem starren Wertesystem gekennzeichnet ist.
Was ist der Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Forschung?
Quantitative Forschung legt den Fokus auf exaktes und objektives Ermitteln von Daten zur Verifikation oder Falsifikation von Hypothesen. Qualitative Forschung konzentriert sich auf den Menschen, seine subjektive Meinung und eigene Perspektiven.
Was sind Symbolischer Interaktionismus und Ethnomethodologie im Kontext qualitativer Forschung?
Symbolischer Interaktionismus betrachtet den subjektiven Sinn, den Individuen mit ihren Handlungen und ihrer Umgebung verbinden. Ethnomethodologie untersucht die Herstellung sozialer Wirklichkeit durch interaktive Prozesse von Individuen und Alltagshandlungen in ihrem Kontext.
Welche qualitativen Methoden wurden in dieser Proseminararbeit angewendet?
Das problemzentrierte Interview und die halb-standardisierte Befragung nach Mayring.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Forschungsfragen fokussieren sich auf Motive für die Rezeption der Serie, die Verwendung der Serienmerkmale für die individuelle zukünftige Lebensplanung und ob die Serie Diskussionen im Freundes- und Bekanntenkreis anregt.
Welche Auswertungsgrundlagen wurden für die Interviews verwendet?
Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring wurde angewendet, um die Strukturmerkmale der Interviews herauszufiltern und die wesentlichen Inhalte zusammenzufassen, zu explizieren und zu strukturieren.
Was sind die Hauptergebnisse der Forschung?
Die Serie wird hauptsächlich zur Unterhaltung und Entspannung konsumiert. Es gibt keine völlige Identifikation mit den Charakteren. Die Serie regt zum Nachdenken über Familie, Erziehung und Moral an. Der Umgang der Eltern mit den Kindern wird teilweise kritisiert. Stereotype Rollenbilder werden teilweise für die zukünftige Lebensplanung übernommen.
- Quote paper
- Natascha Wagner (Author), 2000, Soaps & Serien "Eine himmlische Familie" - empirische Untersuchung zur RezipientInnenforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/108616