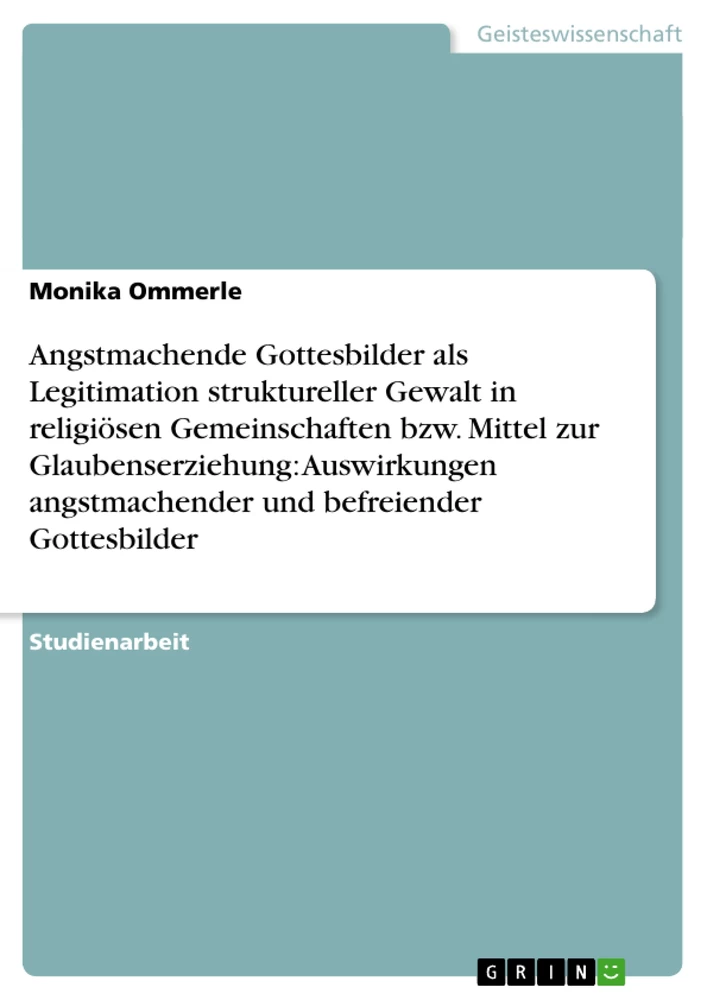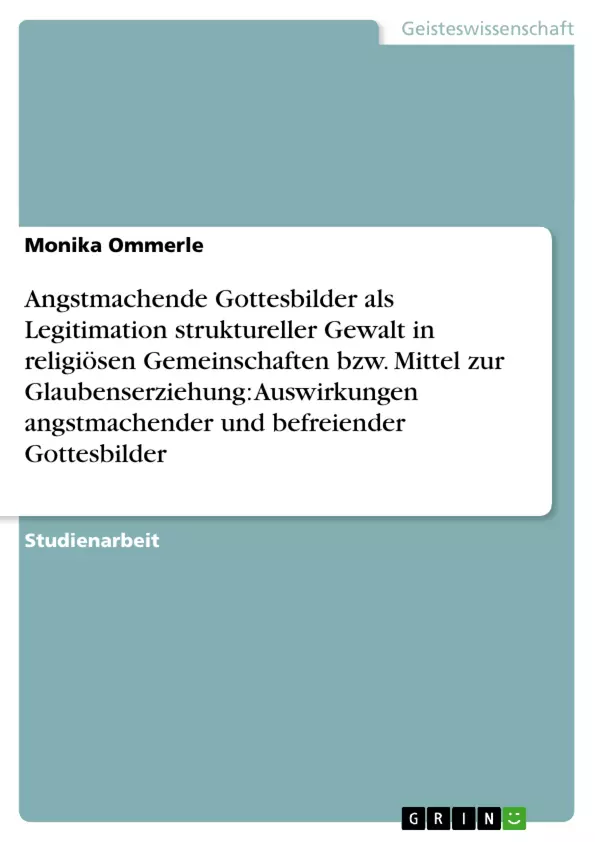Während meines Praktikums in der Altenarbeit und auch bei meiner jetzigen Tätigkeit in der Behindertenarbeit wurde und werde ich immer wieder mit Fragen konfrontiert, warum Gott so grausam ist. “Was habe ich getan, daß Gott mich mit dieser Krankheit straft?”, oder bei Elterngesprächen: “Warum straft uns Gott mit einem behinderten Kind?” Zusätzlich zu den durch Krankheit und Behinderung vorhandenen Belastungen, leiden diese Menschen unter dem “strafenden” Gott, suchen die Ursachen in eigenem, vermeintlichem Fehlverhalten.
Aber nicht nur Angst, sondern auch die Sehnsucht nach dem “strafenden Gott”, nach klaren Handlungsanweisungen, nach straffen Strukturen in religiösen Gemeinschaften konnte ich in den letzten Jahren beobachten. Die Sehnsucht vieler Menschen nach einer “Führung”, nach klaren Normen, um selber nicht mehr die Verantwortung für die Ausgestaltung seines Lebens übernehmen zu müssen. Angstmachende Gottesbilder schränken jedoch auch die Freiheit und Autonomie in der Lebensgestaltung ein.
Dieses Thema - angstmachende und befreiende Gottesbilder - möchte ich nachfolgend näher betrachten, wobei ich mich überwiegend am katholischen Glauben orientiere. Der Bezug zum Seminarthema stellt sich für mich dadurch, daß angstmachende Gottesbilder häufig dazu dienen, Menschen mit “Gewalt” zu erziehen oder zu bekehren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mensch - ein religiöses Wesen
- Gottesbilder
- Die Entstehung des kindlichen Gottesbildes
- Angstmachende Gottesbilder
- Verwirrende und angstmachende Gottesbilder in der Bibel
- Vermittlung angstmachender Gottesbilder durch Vertreter der Kirche
- Vermittlung angstmachender Gottesbilder durch die Eltern
- Auswirkungen angstmachender Gottesbilder
- Erkrankungen aufgrund religiöser Ängste
- Rückzug von Gott, Glaube und Kirche
- Flucht in religiösen Fundamentalismus
- Wege aus der 'Gottesfurcht'
- Befreiende Gottesbilder
- (christliche) Therapie
- Umdenken in Lehre und Verkündigung
- Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Auswirkungen angstmachender Gottesbilder auf Individuen innerhalb religiöser Gemeinschaften. Die Arbeit analysiert, wie solche Bilder zur Legitimation struktureller Gewalt beitragen und die Glaubenserziehung beeinflussen können. Im Fokus steht der Vergleich mit befreienden Gottesbildern und die Erörterung möglicher Wege aus der "Gottesfurcht".
- Die Entstehung und Vermittlung angstmachender Gottesbilder
- Die psychologischen und spirituellen Auswirkungen solcher Bilder
- Der Zusammenhang zwischen angstmachenden Gottesbildern und struktureller Gewalt
- Die Rolle von Eltern und kirchlichen Vertretern in der Glaubensvermittlung
- Möglichkeiten zur Entwicklung befreiender Gottesbilder und zur Überwindung religiöser Ängste
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation der Autorin, die durch ihre Arbeit mit alten und behinderten Menschen mit Fragen nach dem "grausamen" Gott konfrontiert wird. Sie beobachtet sowohl Angst vor Gott als auch die Sehnsucht nach einem strafenden Gott und klaren Strukturen. Die Arbeit untersucht angstmachende und befreiende Gottesbilder, wobei der Fokus auf dem katholischen Glauben liegt, und beleuchtet den Zusammenhang mit Gewalt in der Erziehung und Bekehrung.
Der Mensch - ein religiöses Wesen: Dieses Kapitel erörtert die anthropologische Grundlage der Religiosität. Es werden die Theorien von Rollo May und C.G. Jung herangezogen, die die essentielle Bedeutung von Sinn und Zweck im Leben und die Rolle des Glaubens an eine höhere Macht für die psychische Gesundheit hervorheben. Jungs Konzept des Archetypus und Mays Beschreibung der "Hölle" als Folge von Sinnverlust werden diskutiert. Jörg Müllers Aussage über die universelle Religiosität des Menschen wird ebenfalls zitiert, um die angeborene Verbindung des Menschen zu einer höheren Macht zu unterstreichen.
Gottesbilder: Dieses Kapitel widmet sich der Komplexität von Gottesbildern. Es betont die Unmöglichkeit, Gott naturwissenschaftlich zu beweisen oder zu begreifen, und die Bedeutung von bildlichen Vergleichen in der Bibel (Vater, Hirt, Herr der Welt). Es wird die subjektive Verarbeitung dieser Bilder als entscheidend für ihre religiöse Bedeutung hervorgehoben. Die Aussage Karl Rahners, dass ein Großteil der gängigen Gottesvorstellungen nicht mit der Realität übereinstimmen, wird zitiert, um die Vielschichtigkeit und potenziellen Diskrepanzen zwischen theologischen und individuellen Gottesbildern zu betonen.
Die Entstehung des kindlichen Gottesbildes: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle der Eltern in der Formierung des kindlichen Gottesbildes. Es betont die Wichtigkeit, Kindern die Freiheit zu geben, sich Gott auf ihre Weise vorzustellen, während gleichzeitig die Grenzen menschlichen Wissens über Gott vermittelt werden. Der Fokus liegt auf dem Prozess der Bildbildung und der Achtung der kindlichen Perspektive.
Schlüsselwörter
Angstmachende Gottesbilder, Befreiende Gottesbilder, Strukturelle Gewalt, Religiöse Erziehung, Glaubenserziehung, Psychologie der Religion, Katholischer Glaube, Theologie, Spiritualität, Sinnfindung, Existenz, Archetypus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Auswirkungen angstmachender Gottesbilder"
Was ist der Hauptfokus dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Auswirkungen angstmachender Gottesbilder auf Individuen in religiösen Gemeinschaften. Sie analysiert, wie solche Bilder zur Legitimation struktureller Gewalt beitragen und die Glaubenserziehung beeinflussen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich mit befreienden Gottesbildern und der Erörterung möglicher Wege aus der "Gottesfurcht".
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Vermittlung angstmachender Gottesbilder, deren psychologische und spirituelle Auswirkungen, den Zusammenhang mit struktureller Gewalt, die Rolle von Eltern und kirchlichen Vertretern in der Glaubensvermittlung und Möglichkeiten zur Entwicklung befreiender Gottesbilder und zur Überwindung religiöser Ängste.
Wie wird die Entstehung angstmachender Gottesbilder dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die Entstehung angstmachender Gottesbilder durch verschiedene Faktoren: verwirrende und angstmachende Gottesbilder in der Bibel, deren Vermittlung durch Vertreter der Kirche und Eltern. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle der Eltern bei der Formierung des kindlichen Gottesbildes und der Wichtigkeit, Kindern die Freiheit zu geben, Gott auf ihre Weise vorzustellen, ohne die Grenzen menschlichen Wissens zu ignorieren.
Welche Auswirkungen haben angstmachende Gottesbilder?
Angstmachende Gottesbilder können zu verschiedenen Erkrankungen aufgrund religiöser Ängste führen, zum Rückzug von Gott, Glaube und Kirche und zur Flucht in religiösen Fundamentalismus. Die Arbeit untersucht auch den Zusammenhang zwischen angstmachenden Gottesbildern und struktureller Gewalt.
Welche Wege aus der "Gottesfurcht" werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt verschiedene Wege aus der "Gottesfurcht" vor: die Entwicklung befreiender Gottesbilder, (christliche) Therapie und ein Umdenken in Lehre und Verkündigung. Die Autorin beschreibt ihre eigene Erfahrung mit alten und behinderten Menschen, die mit Fragen nach einem "grausamen" Gott konfrontiert sind, als Ausgangspunkt ihrer Untersuchung.
Welche theologischen und psychologischen Perspektiven werden einbezogen?
Die Arbeit bezieht verschiedene theologische und psychologische Perspektiven ein, unter anderem die Theorien von Rollo May und C.G. Jung zur Bedeutung von Sinn und Zweck im Leben und der Rolle des Glaubens. Auch die Aussagen von Karl Rahner zur Diskrepanz zwischen theologischen und individuellen Gottesbildern und Jörg Müllers Aussage zur universellen Religiosität des Menschen werden diskutiert.
Welche Rolle spielen Eltern und kirchliche Vertreter?
Eltern und kirchliche Vertreter spielen eine entscheidende Rolle in der Glaubensvermittlung und der Formierung des kindlichen Gottesbildes. Die Arbeit untersucht, wie ihre Handlungen und Überzeugungen zur Entstehung und Vermittlung sowohl angstmachender als auch befreiender Gottesbilder beitragen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Angstmachende Gottesbilder, Befreiende Gottesbilder, Strukturelle Gewalt, Religiöse Erziehung, Glaubenserziehung, Psychologie der Religion, Katholischer Glaube, Theologie, Spiritualität, Sinnfindung, Existenz, Archetypus.
Auf welchen Glauben konzentriert sich die Arbeit?
Obwohl die Arbeit allgemein die Auswirkungen angstmachender Gottesbilder thematisiert, liegt der Fokus auf dem katholischen Glauben.
- Quote paper
- Monika Ommerle (Author), 2000, Angstmachende Gottesbilder als Legitimation struktureller Gewalt in religiösen Gemeinschaften bzw. Mittel zur Glaubenserziehung: Auswirkungen angstmachender und befreiender Gottesbilder, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/10780