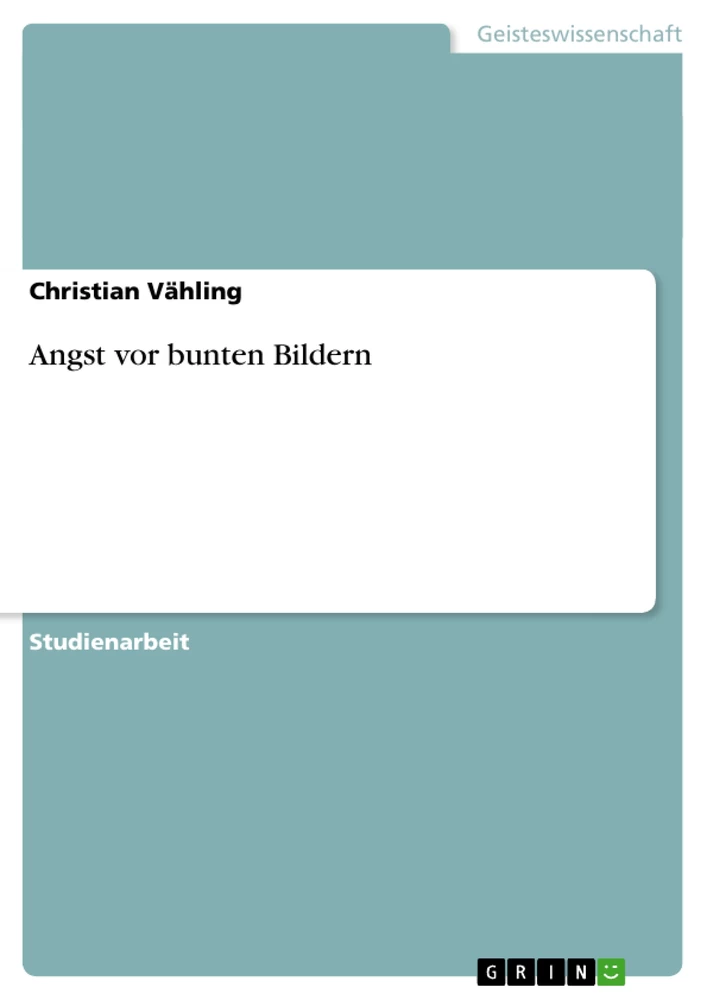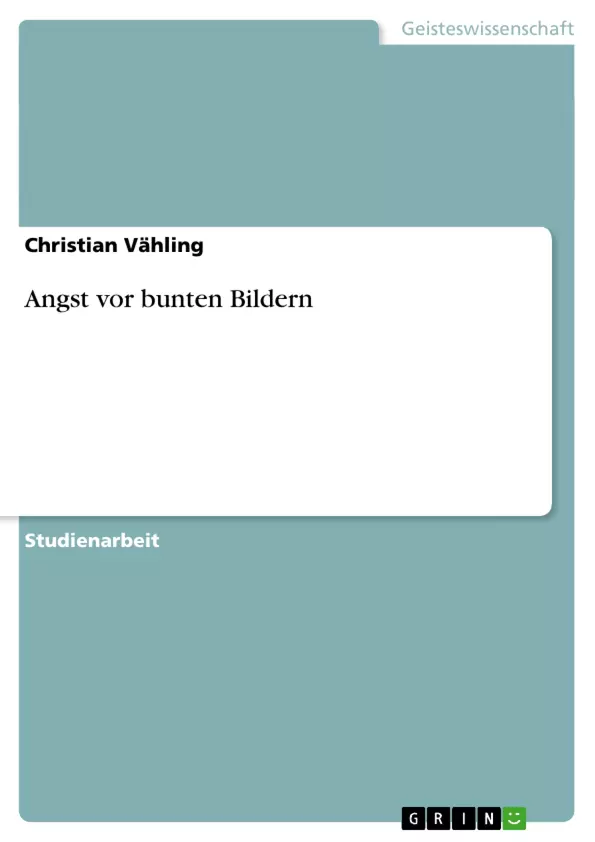Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Was ist ein Comic, und warum ist er gefährlich?
3. Die Kampagnen der Fünfziger
3.1. USA
3.1.1. Vorgeschichte: die Decency Crusades
3.1.2. USA in der Nachkriegszeit
3.1.3. Fredric Wertham
3.1.4. Der Comics Code
3.2. BRD
3.2.1. Comics im Nachkriegsdeutschland
3.2.2. Ein Comic-Diskurs ohne Comics
3.2.3. Argumente gegen die Comics
3.2.4. Kontrolle und Vernichtung
3.2.5. Erkenntnisse folgen
4. Wirkungsforschung seitdem
5. Das Besondere an den Comics
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Jedes neue Medium macht, bevor es sich ganz etabliert, eine Phase durch, in der es von breiten Teilen der Gesellschaft verpönt und verteufelt wird. Spätere Generationen blicken auf fanatische Kampagnen zurück und fragen sich, was denn der ganze Trubel sollte. Es fällt leicht, diesen Kampagnen im Nachhinein eine Art kulturelle "Betriebsblindheit" zu attestieren, wenn man selber zu einer Generation gehört, die mit dem einst verpönten Medium aufgewachsen ist, ohne spürbaren Schaden zu nehmen. Etwas schwerer fallt es dagegen, diese Erkenntnis auf aktuellere Diskurse über die jeweils neuesten Medien zu beziehen, die viel gefährlicher erscheinen. Das bleibt offenbar wiederum späteren Generationen überlassen.
Ein besonderes Medium in diesem Zusammenhang stellen die Comichefte dar, die diese Phase in den späten Vierziger und frühen Fünfziger Jahren durchmachten. Zu den Besonderheiten des Comics gehört, daß diesem Medium im Gegensatz zu anderen bis heute nie ernsthaft "gestattet" wurde, den damaligen Vorbehalten zu entwachsen. Auf ein Überbleibsel weist Knigge (1996, S. 7) hin, wenn er bemerkt, daß es bei keinem anderen Medium eine Unterscheidung gibt wie bei den Comics zwischen "Comics für Erwachsene" einerseits und den "eigentlichen" Comics andererseits.
Die Stigmatisierung als Kindermedium verknüpft die Comics-Kampagne mit der Frage des Jugendschutzes. Die Comics-Kampagnen bringen wie kaum eine andere vorher die Themen Jugendschutz, Jugendgewalt und Jugendkultur auf eine gemeinsame Ebene. Ferner zeichnet sich der Comic-Diskurs, zumindest in Deutschland, durch eine völlige Kenntnislosigkeit der Akteure gegenüber dem Medium aus; der Comic war ein Zeichensystem, zu dem vor allem die Kinder der Nachkriegsgeneration Zugang hatten und die Eltern nicht. So gesehen, läßt sich der Konflikt als Generationenkonflikt deuten, der sich um die Gültigkeit kultureller Codes drehte. Auf jeden Fall aber läßt sich am Beispiel des Comic besonders gut beobachten, wie Argumente aus früheren Diskursen einen neuen Diskurs bestimmen - schon weil die Akteure dieses Diskurses nicht über die Erfahrung verfügten, dem neuen Medium mit "eigenen" Argumenten zu begegnen.
2. Was ist ein Comic, und warum ist er gefährlich?
Der Comic ist eine Erzählform, die Schrift- und Bildelemente zu einer Einheit verbindet. Dabei nimmt der Text Eigenschaften des Bildes an und das Bild Eigenschaften des Textes: während der Text ins Bild hineinversetzt wird, erfährt das Bild zumeist die zeilenweise Anordnung des Textes; jedenfalls wird das Bild und nicht der Text zum Träger des Erzählflusses. Anders als beim Fließtext werden die Informationen eines Bildes synchron und nicht in vorgegebener Reihenfolge erfaßt und erst im Kopf zur sinnvollen Abfolge geordnet. Grünewald (2000, S.41) spricht von verknüpfendem, synthetisierendem Lesen, das einige Übung erfordert. Der ungeübte Blick sieht da erst mal gar nichts, nur Texte und Bilder, die aufgrund ihres Charakters als Träger von Teilinformationen rudimentär erscheinen.
Der moderne Comic ist ein Kind der Massenmedien. Das mag bürgerlichen Kritikern bereits als Geburtsmakel erscheinen, da es dem bürgerlichen Kunstbegriff widerspricht . Vielleicht legen deshalb viele Autoren wie Scott McCloud (1994, S.9ff) Wert darauf, die Geschichte des Comic von einer erweiterten Perspektive aus als Geschichte der Bilderzählungen überhaupt darzustellen: von den Hieroglyphen der Ägypter über mittelalterliche Wandteppiche bis hin zu den Bilderbögen des 18. und 19. Jahrhunderts. Im Rahmen dieser Arbeit erscheint es jedoch sinnvoller, diese Bilderzählungen als lediglich als eine der Vorformen des Comic zu betrachten. Die Vorgeschichte des Comic ist ebensogut die Geschichte der Massenmedien wie die der Bildgeschichten.1
So gesehen, entstand der Comic erst 1896, als der Zeitungsverleger Joseph
Pullitzer neue Mehrfarbdruckpressen aufstellte und für diese eine Verwendung suchte
Diese Farbseiten waren so beliebt, daß die Konkurrenz bald nachzog. Die ersten Jahre des Zeitungscomic sind geprägt von der Konkurrenz der beiden Zeitungszaren Pullitzer und Hearst. (vgl. Hesse-Quack 1969, S. 682)
Kritiken an den Comic Strips wurden recht früh laut und erreichten ihren ersten Höhepunkt zwischen 1906 und 1910. Zunächst bezogen sie sich vor allem auf den groben Humor der Strips. Tatsächlich scheint der frühe Comic eher dem Boulevardtheater nahezustehen als der hohen Kunst. Für viele der frühen Zeichner schien es unvorstellbar, in Comics etwas anderes zu sehen als ein "Vaudeville aus Papier". (McCloud 2000, S. 27)
Mit der Etablierung der großen Zeitungssyndikate veränderten sich anfang des Jahrhunderts auch die Comics: waren vorher aufgrund der lokalen Verbreitung der Zeitungen auch die Comics nur einem lokalen Publikum verpflichtet, versuchten die Syndikate nun, Comics landesweit und zeitungsübergreifend zu vermarkten. Das führte zu stärkerem Einfluß der Verleger auf die Gestaltung der Comics und zu einer Standardisierung und Stereotypisierung der Inhalte.
In den Dreißiger Jahren schließlich erschienen die ersten Comichefte, zunächst noch als Zusammenstellungen bereits erschienener Zeitungsstrips, später mit neuem Material.
Die Comichefte waren schlechter gedruckt und allgemein billiger hergestellt als die Zeitungsstrips. Frühe Kritiker der Hefte befürchteten unter anderem, daß sie Sehschwierigkeiten hervorrufen könnten. (vgl. Nyberg 1998, S.11)
3. Die Kampagnen der Fünfziger
Kritik an Comics hatte es spätestens seit den Dreißiger Jahren immer wieder gegeben, aber mit dem Aufkommen der Crime Comics nach 1945 verschärfte sich das Klima. Auch war es in dieser Zeit, daß die Kampagnen eine internationale Dimension bekamen. Aspekte der Kampagnen anderer Länder wurden dabei zwar übernommen (vor allem aus Amerika), und es gab auch Austausch zwischen Vertretern der Kampagnen verschiedener Länder, jedoch nahmen nicht nur die Strategien, sondern auch die Argumente in verschiedenen Ländern unterschiedliche Formen an.2 Unterschiede lagen nicht nur in der unterschiedlichen Verbeitung der Comics begründet, sondern auch etwa im jeweiligen Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, die als Quelle nicht nur der Kritik, sondern auch des Übels angesehen wurden. (vgl. von Uexküll.1955, S. 1)
Im Folgenden soll vor allem auf die Kontroversen in den USA und in der BRD eingegangen werden.
3.1. USA
3.1.1. Vorgeschichte: die Decency Crusades
Ein Artikel von Sterling North, der auf den großen Erfolg der Comics und die damit verbundene große Gefahr aufmerksam macht, leitet 1940 landesweit Kampagnen ein, die vor allem von Bibliothekaren, Elternverbänden und der Kirche ausgingen. Norths Artikel reflektierte und bestätigte die Ratlosigkeit, die viele Eltern angesichts der Lesegewohnheiten ihrer Kinder hatten, und festigte zugleich das Image der Comics als Kinderlektüre, was bis dahin nicht selbstverständlich war. (Nyberg 1998, S. 4f) Damit war die Frage der Comics kein ästhetisches Problem mehr, sondern eine Frage des Jugendschutzes. Eins der Hauptargumente Norths - daß Comics zu Leseschwierigkeiten führen könnten - wurde bereits 1941 von Paul Witty widerlegt, der weder in Bezug auf Leseverhalten noch auf Intelligenz Unterschiede zwischen Comiclesern und -Nichtlesern feststellen konnte. Witty warnte trotzdem vor den Gefahren der Comics, was darauf hindeutet, daß seine Ergebnisse nicht den allgemeinen Vorstellungen über die Folgen von Comics entsprachen - nicht mal seinen eigenen. (ebd., S.11) Auch sonst konnten Vorbehalte gegen Comics nicht empirisch bestätigt werden. (vgl. Hesse-Quack 1969)
Es blieb nicht bei bloßer Kritik: bereits früh begannen Eltern, Bibliothekare und Kirchenvertreter die sogenannten "Decency Crusades". Statt auf staatliche Schritte zu warten, wurden Händler, die als anstößig klassifizierte Comichefte verkauften, unter Druck gesetzt, bis sie die Titel aus dem Programm nahmen. Listen mit Titeln, auf die zu achten sei, wurden vom kirchennahen National Office of Decent Literature (NODL) herausgegeben. Diese Vorgehensweise hatte der Lobbyist Anthony Comstock bereits in den Siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts mit einigem Erfolg gegen die "Dime Novels" angewandt, gegen die er keine rechtliche Handhabe erwirken konnte. (Nyberg 1998, S. 22f)
3.1.2. USA in der Nachkriegszeit
Mit dem Aufkommen des Kalten Krieges veränderte sich die Comiclandschaft abermals - die optimistischen, teils auch zweckoptimistischen Geschichten der Kriegsjahre entsprachen nicht mehr dem Lebensgefühl und den Leseerwartungen des Publikums. Beliebter wurden die realistischeren und düstereren "Crime Comics". Obwohl diese Comics Titel trugen wie "Crime Does not Pay" und "Crime Must Pay the Penalty", sahen Kritiker in ihnen vor allem minutiöse Darstellungen von Kriminalität und Gewalt mit allerhöchstens aufgesetzter Moral. (Legman, in: Wertham 1948)
Ob es in den Vierzigern wirklich den Anstieg der Jugendkriminalität gegeben hat, auf dem die neue Kontroverse aufbaut, ist mindestens umstritten. (Nyberg 1998, S.19f) Gilbert nennt als Ausgangspunkt für die öffentliche Wahrnehmung von Jugendkriminalität vor allem die größere Sichtbarkeit Jugendlicher im öffentlichen Raum, die eigene Verhaltens- und Sprachcodes demonstrierten und die ältere Generation verstörten. (vgl. ebd.) Die damit verbundenen Kontrollverlustängste auf Seiten der Elterngeneration führten Gilbert zufolge zur Konstitution der Jugendkriminalität als sozialem Problem: dazu gehörten zunehmende Presseberichte, ein erweiterter Begriff von kriminellem Verhalten, mehr Verhaftungen durch Erweiterung der Deliktspanne. (ebd.)
Mit der Verbindung zur Jugendkriminalität ging es bei den Comics nicht mehr nur um die Bildung der Jugendlichen, sondern um die eigene Sicherheit und die zukünftiger Generationen. Das Thema ging plötzlich alle an, und die Dringlichkeit rechtfertigte in den Augen der Comics-Gegner auch radikale Maßnahmen wie 1949 die öffentlichen Verbrennungen konfiszierter Comics.
3.1.3. Fredric Wertham
Eine der zentralen Figuren des Diskurses zwischen 1948 und 1954 ist Fredric Wertham. In McClouds "Reinventing Comics" wird er als dämonischer Racheengel
dargestellt, dessen Geist über den Comicverbrennungen jener Zeit schwebt. (McCloud 2000, S. 86) So oder ähnlich sieht ihn zumindest die heutige Comic- Gemeinde. Anderen Darstellungen zufolge war Wertham ein kritischer, humanistischer Psychoanalytiker, Mitbegründer der Lafargue-Klinik in Harlem, der ersten, in der Farbige und Weiße gleichermaßen psychiatrisch betreut wurden, und in seiner Eigenschaft als forensischer Psychologe ein engagierter Gewaltforscher, der entgegen dem "Mainstream" der Psychiatrie die gesellschaftlichen Hintergründe für individuelle Gewalt in den Vordergrund stellte und für eine sozialpsychiatrische Öfnung der Psychiatrie eintrat. Daß Wertham heute vor allem für ein Buch erinnert wird, das ihn in eine Allianz mit Konservativen, Zensurbefürwortern und Bücherverbrennern gebracht hat, mit denen er ansonsten gar nicht übereinstimmte, mag mit Reibman (in Lent 1999, S. 238) als Ironie verstanden werden, ist aber durchaus sein eigener Verdienst.
Wertham hatte sich in München bei Emil Kraepelin dessen "Klinische Methode" der Theoriebildung aufgrund von Fallbeschreibungen zu eigen gemacht, die auch seinen Betrachtungen über Comics zugrunde liegt. 1922 emigrierte er in die USA, wo er unter Anderem als forensischer Gutachter arbeitete, bis 1946 die Lafargue- Klinik gegründet wurde.
Wertham verstand bereits früh die Neigung zur Gewalt als Ergebnis eines engmaschigen Systems von sozialen Bedingungen, das er später (1966) als "Kult der Gewalt" bezeichnen würde. Individuelles gewaltsames Handeln sei in diesem Kult aufgefangen, der es fördert, positiv sanktioniert und Alternativen verbaut. Ein Teil dieses Netzes von Einflüssen seien die Massenmedien, und davon besonders diejenigen, die sich an Kinder richten, bei denen das Erlernen sozialer Fertigkeiten noch nicht abgeschlossen sei; und das wiederum umso mehr, wenn Im Verlauf der "Kommerzialisierung der kindlichen Freizeit" (Nyberg 1998, S. 90) Medien die Funktionen eines sozialen Umfeldes mittragen. Comics seien deshalb zwar nicht die Ursache delinquenten Handelns, aber ein Faktor in der Festigung gewaltorientierter Werte.
[...]
1 Das bedeutet, der Comic hat alle Probleme der und Vorbehalte gegen die Massenmedien geerbt, wie sie etwa Eco (1984, S. 19f) beschreibt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Dieser Text behandelt die Geschichte der Comic-Kontroversen, insbesondere in den USA und Deutschland, mit Schwerpunkt auf den Kampagnen der 1950er Jahre. Er untersucht die Gründe für die Verteufelung von Comics als Medium und die Rolle von Schlüsselfiguren wie Fredric Wertham.
Was sind die Hauptpunkte der Comic-Kampagnen in den USA?
Die Comic-Kampagnen in den USA begannen mit den "Decency Crusades", angeführt von besorgten Eltern, Bibliothekaren und Kirchenvertretern. Diese Kampagnen kritisierten Comics wegen ihrer angeblichen negativen Auswirkungen auf Kinder und forderten staatliche Maßnahmen. Fredric Wertham spielte eine wichtige Rolle mit seinen Studien, die Comics mit Jugendkriminalität in Verbindung brachten.
Was waren die Hauptargumente gegen Comics?
Die Hauptargumente gegen Comics beinhalteten Bedenken hinsichtlich ihres Einflusses auf die Moral und das Verhalten von Kindern, der angeblichen Förderung von Gewalt und Kriminalität sowie der Behauptung, sie würden zu Leseschwierigkeiten führen. Zudem wurde die kommerzielle Natur des Mediums kritisiert.
Wer war Fredric Wertham und welche Rolle spielte er in den Comic-Kontroversen?
Fredric Wertham war ein Psychoanalytiker und Gewaltforscher, der Comics mit Jugendkriminalität in Verbindung brachte. Seine Studien und öffentlichen Äußerungen trugen maßgeblich zur Eskalation der Comic-Kontroversen in den USA bei.
Wie unterschieden sich die Comic-Kampagnen in den USA und der BRD?
Obwohl es einen Austausch von Ideen und Strategien zwischen den Kampagnen in den USA und der BRD gab, nahmen die Argumente und Strategien unterschiedliche Formen an. Unterschiede lagen nicht nur in der unterschiedlichen Verbeitung der Comics begründet, sondern auch etwa im jeweiligen Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, die als Quelle nicht nur der Kritik, sondern auch des Übels angesehen wurden.
Welche Rolle spielten Comics in Bezug auf Jugendschutz und Jugendkriminalität?
Comics wurden eng mit Jugendschutz und Jugendkriminalität in Verbindung gebracht. Die Comics-Kampagnen thematisierten die möglichen negativen Einflüsse auf Jugendliche und die Verbindung zwischen Comics und steigender Jugendkriminalität.
Was ist das Besondere an Comics als Medium?
Der Text hebt hervor, dass Comics im Gegensatz zu anderen Medien nie ganz aus den damaligen Vorbehalten herausgewachsen sind und immer noch als "Kindermedium" stigmatisiert werden. Dies verbindet die Comics-Kampagne mit der Frage des Jugendschutzes.
Wie wird der Comic als Erzählform definiert?
Der Comic wird als eine Erzählform definiert, die Schrift- und Bildelemente zu einer Einheit verbindet, wobei das Bild zum Träger des Erzählflusses wird und Informationen synchron erfasst werden.
Wann entstand der moderne Comic laut dem Text?
Der moderne Comic entstand laut dem Text im Jahr 1896, als der Zeitungsverleger Joseph Pullitzer neue Mehrfarbdruckpressen aufstellte und für diese eine Verwendung suchte. Diese Farbseiten waren so beliebt, daß die Konkurrenz bald nachzog.
- Quote paper
- Christian Vähling (Author), 2000, Angst vor bunten Bildern, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/107799