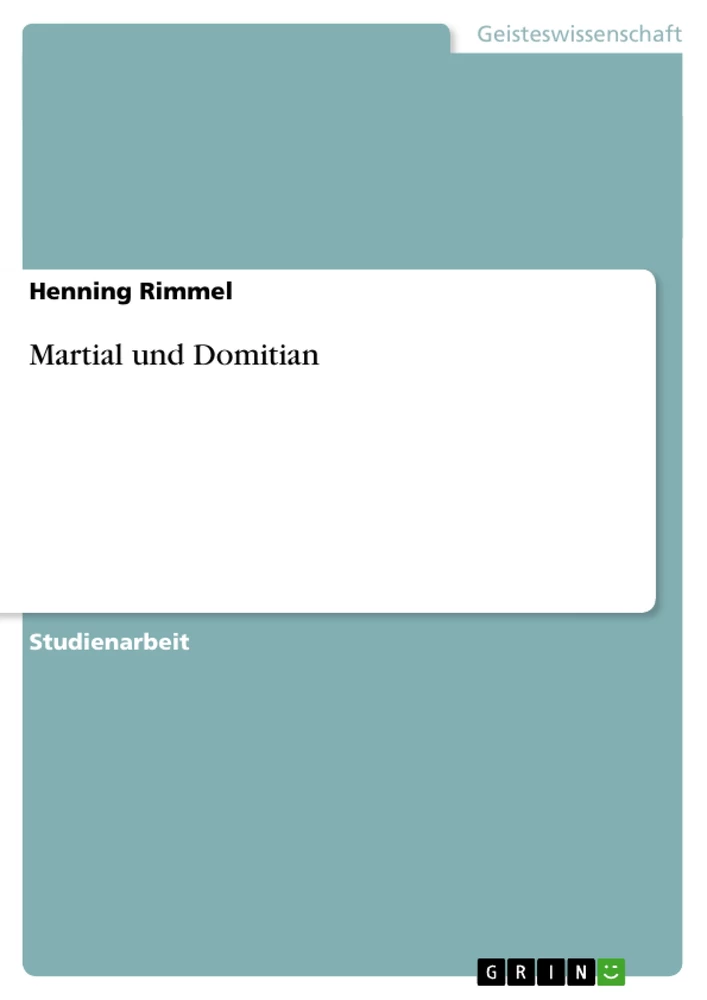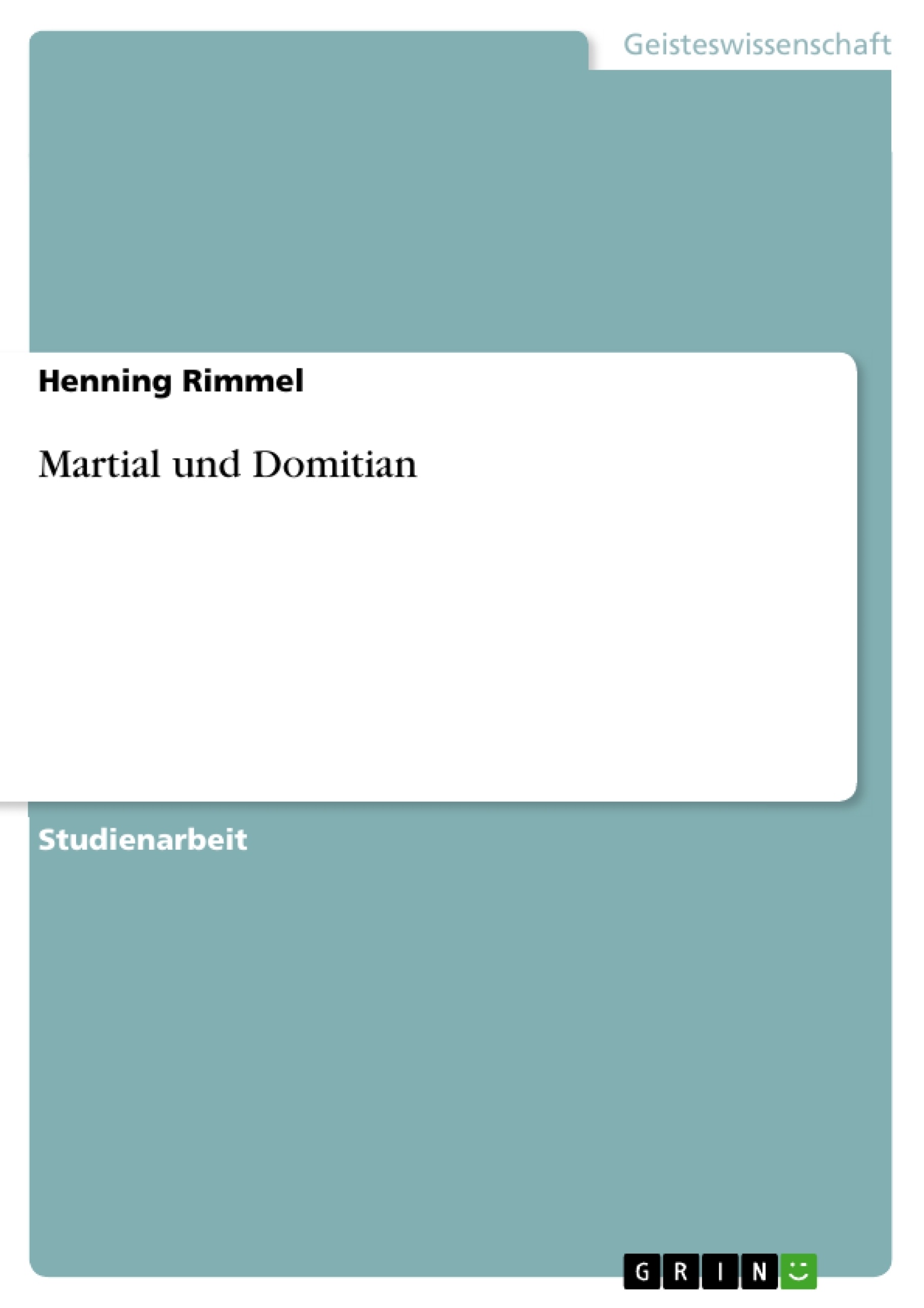War Martial ein skrupelloser Opportunist oder ein verkannter Kritiker? Diese fesselnde Analyse entführt den Leser in das Rom des Kaisers Domitian und beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen dem Epigrammdichter Martial und dem autokratischen Herrscher. Anders als traditionelle Interpretationen, die Martial oft als bloßen Schmeichler abtun, untersucht diese Arbeit die subtilen Nuancen seiner Schriften und kontextualisiert sie im Spannungsfeld von kaiserlicher Macht und künstlerischer Freiheit. Von den glanzvollen Spielen im Kolosseum bis zu den dunklen Schatten der Verfolgung zeichnet der Autor ein lebendiges Bild einer Epoche, in der das Wort zur Waffe und die Wahrheit zur gefährlichen Ware wurde. Die Analyse enthüllt, wie Martial, ein talentierter aber mittelloser Dichter, sich in der gefährlichen politischen Landschaft bewegte, während er versuchte, Anerkennung und Schutz zu erlangen. Es werden die verschiedenen Phasen ihrer Beziehung beleuchtet, von anfänglicher Begeisterung und Lobpreisung bis hin zu versteckter Kritik und schließlich offener Verehrung, wobei die Entwicklung des kaiserlichen Charakters und Regierungsstils Domitians berücksichtigt wird. War Martials Lob für Domitian reine Heuchelei oder ein verzweifelter Versuch, in einer von Angst und Einschüchterung geprägten Atmosphäre zu überleben? Entdecken Sie die versteckten Botschaften in Martials Epigrammen und tauchen Sie ein in eine Welt, in der Dichtung zum Spiegel der Macht und zur subtilen Form des Widerstands wurde. Diese detaillierte Untersuchung von Martials Werk bietet neue Perspektiven auf die römische Gesellschaft, die kaiserliche Propaganda und die Rolle des Künstlers in einer repressiven Umgebung, wobei sowohl Martials offizielle Huldigungen als auch seine möglichen subtilen subversiven Botschaften analysiert werden. War er ein Meister der Anpassung oder ein heimlicher Rebell? Die Antwort liegt verborgen in den Zeilen seiner brillanten, zeitlosen Verse, die hier mit scharfem Blick und historischem Feingefühl entschlüsselt werden. Schließlich wird die Frage aufgeworfen, ob Martials Sinneswandel nach Domitians Tod aufrichtiger Gesinnungswandel oder erzwungene Anpassung an neue Machtverhältnisse war. Eine faszinierende Reise durch die Höhen und Tiefen einer außergewöhnlichen Künstlerbeziehung im Herzen des Römischen Reiches, voller Intrigen, Ehrgeiz und der ewigen Suche nach Wahrheit und Überleben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
In dieser Arbeit möchte ich die Beziehung zwischen dem Dichter Martial und Kaiser Domitian darstellen. Dabei möchte ich vor allem der Frage nachgehen, welche Sichtweise Martials die zutreffende sein könnte; die ältere, er sei ein ‚Speichellecker der Mächtigen’ seiner Zeit gewesen, oder der eher moderne Interpretationsansatz, der ihm gern mit zum Teil recht konstruierten Interpretationsversuchen einen wechselnden Grad an Herrscherkritik zubilligt.
Hierfür halte ich es für erforderlich, zuerst einmal denjenigen der herrschenden Kaiser, die Martial erlebt hat, zu charakterisieren, dem er den Großteil seines Werkes gewidmet bzw. unter dessen Herrschaft er es verfasst hat: Domitian. Hierbei geht es natürlich nicht nur um eine kurze Biografie, weil diese allein wenig über den Herrscher aussagt. Eine Darstellung seiner Erfolge, die gern in älterer Literatur vernachlässigt werden um das oben erwähnte negative Bild zu verstärken, ist vor allem deshalb wichtig, um später Bezug auf das zum Teil ganz und gar objektive und sachliche Lob Martials für diese Errungenschaften zu nehmen. Die letzte Ausführung zu Domitian wird jedoch die wichtigste sein; bevor ich zum eigentlichen Kern der Arbeit komme, stelle ich den Herrschaftsstil und Charakter Domitians dar, der natürlich entsprechend Auswirkung auf die Umstände in Rom und das alltägliche und literarische Leben hat. Diese Atmosphäre der damaligen Zeit ist bei der Betrachtung des Verhältnisses zwischen Martial und Domitian immer zu berücksichtigen.
Ähnlich der Entwicklung innerhalb des Herrschaftsstils Domitians werde ich im Kernkapitel die Entwicklung der Beziehung zwischen dem Dichter und dem Herrscher und selbsternannten Gott darstellen, um die Fragestellung der ganzen Arbeit im Fazit beantworten zu können.
2. Biografie Domitians
Domitian wurde am 24. Oktober 51 als Sohn des Kaisers Vespasian, also auch Bruder des Kaisers Titus geboren. Vespasian kümmerte sich bei der Erziehung seiner Söhne vor allem um seinen Erstgeborenen und Nachfolger im Regierungsamt Titus. Ihm brachte er schon in dessen Jugend Tugenden und Regierungssachverstand bei, sodass Domitian sehr benachteiligt wurde. Er wurde von einem Kindermädchen aufgezogen, das laut Bengtson sogar die Konkubine Vespasians war1. Da Domitian zwar mit demselben Ehrgeiz ausgestattet war wie sein Bruder, jedoch erkannte, dass er in den traditionellen Bereichen wie der Politik immer in dessen Schatten stehen würde, suchte er sich ein anderes Betätigungsfeld, auf dem er Erfolge erreichen könnte, zum Beispiel die Literatur. Aufgrund dieser Dominanz Titus’ bzw. der Benachteiligung durch seinen Vater, war Domitian also gezwungen sich fast vollständig aus der Politik herauszuhalten. Nach Titus’ Tod 81 kam für ihn die Übernahme der Macht recht überraschend, die er dann bis zu seiner Ermordung 96 inne hatte. Er regierte somit 15 Jahre, also länger als sein Vater und sein Bruder zusammen.
3. Erfolge seiner Regierung
Wie auch sein Vater und Bruder war Domitian ein hervorragender Fachmann auf dem Gebiet der Verwaltung2.
Außerdem werden ihm Erfolge bei der Gesetzgebung zugesprochen. Hervorzuheben sind dabei vor allem die Theatergesetze, die eine strengere Durchsetzung der Sitzordnung im Theater vorsahen. Dabei ging es nicht bloßum die Verteilung der Sitze, sondern vor allem darum, die unterschiedlichen Stände wieder strenger zu trennen, nachdem für gewöhnlich auf die Sitzordnung zu Lasten der höheren Stände wenig Rücksicht genommen wurde.
Ein weiteres wichtiges Gesetz aus Domitians Regierung ist die Erneuerung der lex Iulia, die bereits von Augustus erlassen worden war und mit der er wie auch Domitian Moral, Sitten und Religion verbessern wollte.
Domitian tat sich auch und vor allem als Förderer der Wissenschaft, Kunst und Kultur in jeglicher Weise hervor. Da er Minerva zu seiner persönlichen Schutzgöttin erkoren hatte, sah er sich wohl besonders verpflichtet, ein Patron für die Künste zu sein. Er wird auch nicht umsonst als solcher von Martial bezeichnet. Domitian ließ einige abgebrannte oder heruntergekommene Tempel und Bibliotheken wieder aufbauen. Zur Restaurierung abgebrannter Bibliotheken ließ er laut Coleman sogar Kopisten in die großen Bibliotheken nach Alexandria schicken, um dort die verloren gegangenen Schriften zu reproduzieren.3 Domitian restaurierte aber nicht nur die alten Werke der Literatur, sondern sorgte auch für ein besseres Arbeitsumfeld zeitgenössischer Schriftsteller, indem er einige regelmäßige Dichterwettstreite ins Leben rief.
Genau wie seine beiden Vorgänger, die ja das heutige Kolosseum bauen ließen, bzw. einweihten, teilte auch Domitian die Begeisterung für Spiele. Er war daher auch ein großzügiger Stifter von Spielen für das Volk.
Domitian sah sich wie Augustus als Moralist und versuchte ebenso die Sitten und Bräuche der Zeit der Republik wiedereinzuführen bzw. zu erhalten. Dafür erneuerte er die oben bereits erwähnte lex Iulia des Augustus und erlangte einen zweifelhaften Ruhm, weil er im Gegensatz zu sämtlichen vorherigen principes, auch Augustus, sehr harte Prozesse aufgrund moralischer und religiöser Vergehen führte. Als Tiefpunkt ist hierbei ein Prozess gegen frevelhafte Vestalinnen zu nennen, der mit Todesurteilen endete, wobei sich die angeklagten Priesterinnen ihre Todesart noch aussuchen durften, die Oberin wurde mit der grausamsten Strafe belegt und lebendig begraben.
Ein letztes positives Kapitel seiner Herrschaft sind die militärischen Erfolge, die Domitian zu verbuchen hat. Dazu zählen die Befriedung der nördlichen Grenzen in Großbritannien, wo der Militärtribun und Statthalter von Britannien Agricola die Kaledonier in die Flucht trieb. Kurz vor der Eroberung Schottlands wurde er jedoch mit seinem Heer von Domitian an den Rhein abberufen, um ihn im Krieg gegen die Chatten zu unterstützen. Die Lage dort war ohnehin schon schwierig, da der eigentlich schlagkräftigste Teil der Armee, die Reiterei, bei so viel Wald nur zu Fuß eingesetzt werden konnte. Ein großangelegter Krieg gegen die Germanen war aber wegen der zu geringen Anzahl römischer Soldaten nicht möglich und so wurde ein Einfall der Chatten in die römischen Provinzdörfer nur durch Errichtung von limites mit einer Ausdehnung von ca. 180 km verhindert.4 Gleichzeitig führten allerdings die Daker 85 /86 an der Donau erfolgreich einen Feldzug durch die römischen Provinzdörfer durch. Nach einem fehlgeschlagenen Gegenschlag der Römer 87 erreichten Domitians Generäle einen Sieg quasi im Zentrum Dakiens bei Tapae. So kam es 89 zum Friedensschluss mit den Dakern und Dekebalus, der König der Daker, wird sogar in den Kreis der Vasallen des römischen Imperiums aufgenommen. Dieser Friedensschluss kam auch dem Kaiser recht gelegen, da sich das Reich noch einiger anderer germanischer Aufstände und Angriffe erwehren musste. Die Kämpfe gegen die Germanen dauerten zwar ohnehin bis in die Amtszeit seines Nachfolgers Nerva an, aber ohne die militärischen Erfolge Domitians wäre nach Meinung Bengtsons die Verteidigung des Reiches im Donauraum schon eher zusammengebrochen.5
4. Der Charakter Domitians
Wie schon in der Einleitung erwähnt, hat die Geschichtsschreibung wohl bis vor kurzem noch ein durchweg negatives Bild von Domitian gezeichnet und somit auch von seiner Herrschaft. Aber wie schon oben gezeigt wurde, gibt es durchaus positive Aspekte, die gern vernachlässigt wurden. Richtig ist jedoch, dass Domitian sowohl in seinem eigenen Charakter als auch im Stil seiner Regierung eine Entwicklung durchgemacht hat. Als er gerade den Thron bestieg, nachdem sein Bruder gestorben war, ließ er sich vom Statthalter der Prätorianergarde Mucian beraten. In dieser Zeit zeigte sich der Kaiser äußerst großzügig und zeichnete sich durch Augenmaß und Vernunft in seinen Entscheidungen aus, seine Verwaltung galt als transparent und effektiv.6 So wurden die Staatsschulden erlassen, wenn jemand fünf Jahre lang nichts mehr an das aerarium gezahlt hatte, die Forderungen des Fiskus durften nur innerhalb eines Jahres gestellt werden, bei Verstoß konnte der jeweilige Funktionär im schlimmsten Fall mit Verbannung bestraft werden. Domitian war offenbar völlig frei von Habgier und übertrug seine Großzügigkeit auch auf andere. So ließ er das Testament eines Rustius Caepio für ungültig erklären, der verfügt hatte, dass jeder Senator bei Betreten der curia einen Beutel Münzen erhalten solle.7
Doch in dieser Zeit beginnt Domitian auch seine Selbstvergöttlichung, für die er bekannt ist. Bisher war es so, dass ein verstorbener Kaiser von seinem Nachfolger dem Senat zur Konsekrierung vorgeschlagen wurde. Der Senat beschloss dann also die beantragte Konsekrierung, wenn der betreffende Verstorbene sich nicht gänzlich unbeliebt gemacht hatte, dann wurde er wiederum oft mit der damnatio memoriae bestraft: Die Erinnerung an ihn wurde weitgehend ausgelöscht. Domitian war nun allerdings der erste princeps, der sich selbst als göttlich ansah, weil er von Göttern abstammte. Er ließ sich daher als dominus et deus anreden, oder auch als Sohn Minervas, die er, wie oben erwähnt, zu seiner Schutzgöttin gewählt hatte.
Mit diesem Prozess der Selbstüberhöhung veränderte sich auch allgemein Domitians Charakter zum Düsteren. Anfangs stellte er sich nur über jeden anderen Menschen, behandelte selbst Ritter und Senatoren von oben herab, wodurch er sich viele Feinde in der altehrwürdigen Aristokratie machte. Diese übersteigerte Überlegenheit gegenüber anderen mündete schließlich in Rücksichtslosigkeit, Brutalität und offene Gewaltausbrüche. So findet man bei Bengtson die Anekdote, Domitian habe seine Frau Domitia Longina ihrem bisherigen Ehemann quasi entführt. Und weil dieser sich zu oft ironisch dazu geäußert habe, soll Domitian ihn töten lassen haben.8
Spätestens seit dem Aufstand seines Statthalters von Germanien, Antonius Saturninus, 89 leidet Domitian unter extremem Verfolgungswahn, der sich schließlich so sehr steigert, dass viele, die als Verschwörer verdächtigt werden, umgebracht werden und sowohl an seinem Hof als auch im Senat niemand mehr vor Domitians Willkür sicher ist. Kritiker werden brutal hingerichtet. So heißt es zum Beispiel, Domitian habe einen alten Mann, der sich abfällig über einen Gladiatoren geäußert hatte, für den er sich interessierte, festnehmen und von bissigen Hunden zerfleischen lassen. Auch der oben bereits erwähnte viel zu brutale Vestalinnenprozess gehört in diese Zeit von 93 bis 96, die man als seine Schreckensherrschaft bezeichnen kann.
5. Die Beziehung zwischen Martial und Domitian
Laut Hofmann kann man in der Beziehung zwischen Martial und Domitian drei Phasen ausmachen.9 Die erste Phase spiegelt sich in Martials liber spectaculorum wieder, in dem der Autor das herrliche neue Amphitheater des Kaisers lobt. Die lobreichen Beschreibungen der Spiele, die im heutigen Kolosseum stattfinden, gehören noch nicht in die Regierungszeit Domitians sondern sind eher als Lob für die Familie der Flavier aufzufassen, da das Amphitheater bereits von Vespasian entworfen und zu bauen begonnen wurde. Der Dichter ist hier voll des ehrlichen, sachlichen Lobes und präsentiert sich als begeisterter Freund aufwändiger Spiele.
Die zweite Phase setzt Hofmann zwischen 85 und 92 an. Wie oben dargestellt, ist das quasi die positive Herrschaftszeit Domitians. In dieser Zeit erscheinen die Bücher eins bis sieben von Martials Epigrammen. In seinen Gedichten lässt sich vor allem großes bis überschwengliches Lob für Domitian und seine Erlasse und Erfolge finden. Das liber spectaculorum enthielt zwar weitgehend kritikloses Lob für die kaiserliche Familie, hatte allerdings einen konkreten Anlass. Mit dem ersten Gedichtband beginnt Martial ohne Anlass und auch wesentlich aufdringlicher direkt den Kaiser zu loben. Dafür gilt das fünfte Gedicht im ersten Buch als Beispiel:
adeoque penitus sedit hic tibi morbus, ut saepe in aurem, Cinna, Caesarem laudes.
Andererseits vermutet Hofmann aber auch, dass Martial mit diesem Gedicht insgesamt die Eitelkeit Domitians verletzt und also einen “peinlichen Fehler“ begangen haben muss.10
Martial spricht aber natürlich auch wieder mit konkretem und vor allem auch sich selbst betreffendem Anlass Lob für den Kaiser aus. So hat das Epigramm 2.2 Domitians militärische Erfolge gegen die Chatten zum Thema, 2.91 und 2.92 behandeln das Dreikinderrecht, das Martial bei Domitian erbeten und erhalten habe und wofür er sich hiermit bedankt.
Aber Martial traut sich auch mehr und mehr, ein wenig Kritik zu üben. So führt Hofmann als Beispiel das Gedicht 4.37 an, in dem der Autor darstellt, wie Gazellen im Circus langsam zu Tode gequält werden. Er schlägt vor, Milde walten und sie rasch sterben zu lassen. Solche Verbesserungsvorschläge für den Kaiser gab es im Buch der Schauspiele nicht.11
In Buch fünf gibt es laut Hofmann eine Neuerung: Martial wendet sich das erste Mal seit dem liber spectaculorum wieder mit einem Zyklus nur einem einzigen Thema zu, nämlich der Erneuerung der Theatergesetzgebung. In den Gedichten 8, 14, 23, 25, 27, 35, 38 und 41 preist er die neuen Regelungen, die wahrscheinlich zu einer strengeren Durchsetzung der 67 v. Chr. erlassenen alten lex Roscia theatralis führten.12 Martial beginnt dabei in dem ersten Gedicht des Zyklusses, 5.8., gleich sehr stark, indem er Domitian erstmals mit dem Titel dominus et deus anredet. Außerdem ist dieses Thema allerdings, wie auch schon die Eröffnung des neuen Amphitheaters, eines, das Martial persönlich sehr wichtig ist, da er gerade zwei Jahre zuvor in den Ritterstand erhoben wurde und die strengeren Regelungen sein Anrecht sicherten.
Zum fünften Buch gibt es allerdings noch einen anderen interessanten Ansatz. So hält John Garthwaite in seinem Aufsatz „Putting a Price on Praise“ die an Domitian gerichteten Epigramme aus dem Anfangsteil des Buches für eine versteckte Kritik am Verhalten des Kaisers. Garthwaite bezieht sich in seiner Analyse lediglich auf die ersten 22 Gedichte. Er ist der Meinung, dass Martial hier aussagen will, dass er sein Verhältnis zu den Adressaten seiner Epigramme wie ein kommerzielles betrachtet, bei dem er ein Produkt herstellt und einen Preis dafür erhält. Er beschwert sich immer wieder in seinen Epigrammen darüber, dass er arm sei und seine Patrone ihm zu wenig Belohnung für sein Werk geben. Als Höhepunkt für diese Beschwerde führt Garthwaite das spätere Epigramm 5.36 an:
Laudatus nostro quidam, Faustine, libello
Dissimulat, quasi nil debeat: inposuit.
Garthwaite überträgt diese allgemeine Beschwerde über die zu geringe Belohnung durch die Patrone auf die Epigramme, die Domitian gewidmet sind. Darunter ist vor allem das Gedicht 5.15 zu nennen, in dem Martial eine Audienz mit Domitian konstruiert, bei der es genau um den Sinn des Lobes für bestimmte Adressaten in Martials Epigrammen geht. Die kurze Diskussion zwischen Dichter und Kaiser findet ihren Höhepunkt in der Frage Domitians:
Quid tamen haec prosunt quamvis venerantia multos?
Diese Frage hält Garthwaite für einen Hinweis auf die Skeptik Martials gegenüber den Belohnungen der Patrone, da Domitian jedes Bewusstsein für die Notwendigkeit einer solchen materiellen Wertschätzung fehlen lässt. Er ignoriert sie quasi13. Mit der Übertragung der Kritik Martials an seinen Patronen auf die Gedichte, die ausschließlich dem Kaiser gewidmet sind, offenbart Garthwaite eine versteckte Kaiserkritik.
Im sechsten Buch wird ein weiteres Kernstück von Domitians Gesetzgebung zum Thema, die lex Iulia de adulteriis coercendis. Dabei handelt es sich um eines der Gesetze, die Augustus seinerzeit erlassen hatte, um Ehemoral und Kinderreichtum zu fördern und standeswidrige Ehen zu verhindern. Mit der Erneuerung dieser Gesetzgebung versprach sich Domitian, die Moral, Sitten und Religion zu fördern und zu verbessern. Martial lobt dieses Angehen auch in den Gedichten 6.2 und 6.4. Allerdings lässt er auch mehr oder minder deutlich seine Kritik daran erkennen, dass sich zwar de facto die Rechtslage verbessert hat, sich in der Praxis aber noch zu wenig ändert. Er verfasst vier weitere Epigramme mit Schmähungen auf Zoilus, der in Gedicht 91 weiter seine allseits bekannte Unzucht treibt, auf Telesilla, die im siebten Gedicht ihre zehnte Ehe schließt, Proculina in 6.22, die nun heiratet und ihren wahren Liebhaber offenbart, oder Lygdus, der in Epigramm 45 in der Ehe genauso lastert wie zuvor. Da man annehmen kann, dass Domitian solche Beispiele für die Unwirksamkeit seiner Gesetze nicht gern gehört hat, kann man diese Gedichte auch als direkte aber vorsichtige Kritik sehen.14
Das siebte Buch beschließt die zweite Phase, die Hofmann für die Beziehung Martials zu Domitian findet. Hervorhebenswert findet er das 40. Gedicht, ein Grabepigramm für einen Freund, in dessen zweiten Vers es heißt:
pectore non humili passus utrumque deum.
Wenn man wie Hofmann die Stelle so auffasst, dass besagter Freund „den Kaiser in Freud und Leid“ aber „nicht knechtisch (humili pectore)“ ertragen hat, so ergibt sich für Hofmann daraus, dass Martial für sich selbst denselben Maßstab anlegt und ein aufrichtiges Wort trotz aller Ergebenheit nicht scheut. Dies tut er mit „einem kritischen Wort [...], wenn auch selten und dann auch stets mit vorsichtigem Ausdruck und hintergründig.“15
Mit dem achten Buch beginnt für Hofmann nun eine neue Phase in der Beziehung zwischen Martial und Domitian. Schon im siebten Buch hatte Martial die Hoffnung anklingen lassen, dass der Kaiser aus den Sarmatenkriegen wieder nach Rom zurückkehren würde. Das eingetretene Ereignis ist für Martial der Anlass für einen Gedichtzyklus voll des Lobes. In 8.11,15,21,24,80 lobt Martial allein die Rückkehr Domitians, in 8.26,53,30,78 die aus diesem Anlass veranstalteten Spiele, in 8.36,39 den neuen Kaiserpalast auf dem Palatin und in 8.65 den neuen Fortuna Tempel. Kein bisheriges Buch ist so stark auf Domitian ausgerichtet, es kommt auch keinerlei noch so versteckte Kritik auf.16
Mit 20 Gedichten sind rund 20% des neunten Buches auf Domitian ausgerichtet. Martial rühmt viele unterschiedliche Dinge in überschwänglicher Form. „Ein Leitthema gibt es nicht.“17
Aus der letzten Wendung in Martials Einstellung gegenüber Domitian, dass nämlich ohne jeden Anlass und innere Geschlossenheit kritiklose Huldigungen ausgesprochen werden, setzt Hofmann seine These der drei Phasen zusammen. In seiner Zusammenfassung schreibt Hofmann, Martial habe keinen hohen Stand beim Kaiser gehabt und habe versucht sein Ansehen durch sein Werk zu verbessern. Dabei habe er sich vom sachlichen Lob zu „hohler, geradezu kultischer Verehrung des Kaisers“ entwickelt.18
6. Fazit
Die Frage, ob Martial ein Heuchler war oder nicht, ist meiner Meinung nach nur schwer zu beantworten, vor allem aber nicht mit einem Wort. Wie ich schon eingangs in der Einleitung anmerkte, wird gern der Versuch gewagt, Martial in heutiger Zeit doch noch das Bild eines Herrscherkritikers zu verleihen. Dies geschieht vielleicht, weil gerade aus heutiger Sicht alles Andere schlechter nachzuvollziehen ist. Ich glaube, aber nicht, dass man so weit gehen könnte, Martial einen kritischen Autor zu nennen. Dazu fehlt die direkte Kritik an Fehlentscheidungen des Kaisers und an seiner Person selbst. Aber man muss wiederum auch die Umstände der Zeit berücksichtigen. Martial war in einer Zeit literarisch tätig, in der die Literatur so stark kontrolliert und reglementiert wurde, dass es Tacitus und Plinius, der Jüngere, vorzogen, erst nach Domitians Tod ihre literarische Tätigkeit aufzunehmen. Um es kurz zu sagen: Unter einem Kaiser, der, vorsichtig gesagt, wenig Sinn für Kritik hatte und in seinen Reaktionen auf Kritik auch immer brutaler und rücksichtsloser wurde, war es einfach nicht möglich offene Kritik zu üben. Insofern kann es keine offene literarische Kritik an Kaiser Domitian gegeben haben. Und wenn wir uns diese Situation vor Augen führen, kann ich mich zur Beantwortung meiner Fragestellung nur Hofmann anschließen. Ich halte sein Modell der drei Phasen für sehr angemessen und plausibel. Die von ihm beschriebene und hier noch einmal dargelegte Entwicklung im Verhältnis zwischen Martial und Domitian ist meiner Meinung nach sehr gut erkennbar. Sie scheint mir außerdem parallel zur Entwicklung in Domitians Herrschaftstil und Charakter zu sein, wie sie bei Bengtson beschrieben ist. Auch in den Beispielen für vorsichtige Kritik kann ich mich Hofmann anschließen. Ich kann zum Beispiel nachvollziehen, dass es eine schon recht direkte Kritik an Domitian gewesen sein muss, Beispiele für die Unwirksamkeit seiner Ehegesetzgebung zu geben, wie es Martial in seinem sechsten Buch tut. Ich halte allerdings Garthwaites Interpretation des fünften Buches für ein Beispiel, wie sehr man mitunter konstruieren muss, um eine versteckte Kritik Martials erkennbar zu machen. Diese betreffende Konstruktion kann ich noch nachvollziehen und sie erscheint mir schließlich auch plausibel, es hängt jedoch vom damaligen Publikum ab, ob diese Interpretation auch damals durchgegangen wäre. Dadurch, dass wir aber eben diesen Faktor der Auffassung durch das Publikum nicht sicher benennen können, halte ich Garthwaites These für nicht belastbar. Ich schließe mich also Hofmanns Drei - Phasen - Modell an, da mir auch sein Fazit sehr plausibel scheint. Ich halte es für sehr gut nachvollziehbar, dass Martial in seinem Schaffen versucht hat, nicht nur die Gunst des Publikums sondern vor allem die des Kaisers zu erlangen. Da er mit seinem anfänglichen Versuch, dabei Ehrlichkeit zu bewahren, nicht weit genug gekommen war, halte ich es für ganz natürlich, dass er schließlich, vielleicht auch ein wenig resigniert, versucht, den Erfolg durch Heuchelei zu vergrößern. Dieser Ansatz muss ja angesichts der göttlichen Verehrung Domitians auch geradezu die logische Konsequenz gewesen sein. Die vierte Phase würde dann quasi mit dem Tode Domitians 96 eintreten. Laut Hofmann erscheint das zehnte Buch 98 als zweite Auflage, die erste von 95 enthielt noch Gedichte auf Domitian, die Martial wohl nicht mehr sehen wollte und aus der Sammlung herausnahm.19 Auch nach Meinung von Hanna Szelest sagt Martial seine wahre Meinung über Domitian erst in den Büchern, die nach seinem Tode erschienen sind.20 Diese Tatsache untermauert meiner Meinung nach die These, dass Martial sicher in der düsteren Phase von Domitians Herrschaft offiziell den bloßen Verehrer des Kaisers gegeben hat, spätestens nach dessen Tod hat er aber wieder seine vorherige Haltung eingenommen. Daraus ergibt sich als Ergebnis meiner Arbeit jedoch auch wieder ein Problem, das sich hier nicht mehr klären lässt: Ist Martial nach Domitians Tod aus eigener Überzeugung wieder zu dessen ehrlichen Kritiker geworden oder wurde ihm dieses Verhalten von den geänderten Rahmenbedingungen aufgezwungen?
Verwendete Literatur
- BENGTSON, Herrmann: Die Flavier: Vespasian, Titus, Domitian. Geschichte eines römischen Kaiserhauses, München 1979
- COLEMAN, K. M.: The Emperor Domitian and Literature, in: HAASE, Wolfgang (Hg.): ANRW II 32.5, Berlin / New York 1986, 3087 – 3115
- GARTHWAITE, John: Putting a Price on Praise. Martial’s Debate with Domitian in Book 5, in GREWING, Farouk (Hg.): Toto notus in orbe. Perspektiven der Martial – Interpretation, Stuttgart 1998 (=Palingenesia 65)
- HOFMANN, Walter: Martial und Domitian, Philologus 127 (1983), 238 – 246
- HOWELL, Peter: Martial. Epigrams V, Edited with an Introduction, Translation and Commentary, Warminster 1995
- M. Val. MARTIALIS, Epigrammata, Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. M. Lindsay, Editio altera, Oxford 1929 (= Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis)
- SZELEST, Hanna: Martial – eigentlicher Schöpfer und hervorragendster Vertreter des römischen Epigramms, in: HAASE, Wolfgang (Hg.): ANRW II 32.4, Berlin – New York 1986, 2563 - 2623
Fußnoten
- ↑ Bengtson, S. 180.
- ↑ Bengtson, S. 180.
- ↑ Coleman, S. 3096.
- ↑ Bengtson, S. 197.
- ↑ Bengtson, S. 205.
- ↑ Bengtson, S. 183.
- ↑ Bengtson, S. 182.
- ↑ Bengtson, S. 188.
- ↑ Hofmann, S. 246.
- ↑ Hofmann, S. 240.
- ↑ Hofmann, S. 242.
- ↑ Hofmann, S. 242.
- ↑ Gartwaite, S. 166.
- ↑ Hofmann, S.243.
- ↑ Hofmann, S. 244.
- ↑ Hofmann, S. 245.
- ↑ Hofmann, S. 245.
- ↑ Hofmann, S. 246.
- ↑ Hofmann, S. 245.
- ↑ Hanna Szelest, S. 2621.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über Martial und Domitian?
- Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen dem Dichter Martial und Kaiser Domitian, insbesondere die Frage, ob Martial ein Speichellecker oder ein subtiler Kritiker des Kaisers war.
Welche Aspekte von Domitians Herrschaft werden beleuchtet?
- Die Arbeit behandelt Domitians Biografie, seine Regierungserfolge, seinen Charakter und Herrschaftsstil, um den historischen Kontext für Martials Werk zu schaffen.
Wie wird die Beziehung zwischen Martial und Domitian analysiert?
- Die Analyse konzentriert sich auf die Entwicklung der Beziehung zwischen dem Dichter und dem Kaiser, um die Fragestellung der Arbeit zu beantworten.
Welche Quellen werden für die Analyse verwendet?
- Die Analyse basiert auf Martials Epigrammen und Werken anderer Autoren wie Bengtson, Coleman, Garthwaite, Hofmann, Howell und Szelest.
Welche Phasen in der Beziehung zwischen Martial und Domitian werden unterschieden?
- Die Arbeit folgt Hofmanns These von drei Phasen: anfängliches Lob des flavischen Hauses, überschwängliches Lob und gelegentliche Kritik in Domitians positiver Regierungszeit, und schließlich kritiklose Huldigung in Domitians späterer Herrschaft.
Wie wird Martials angebliche Kritik an Domitian bewertet?
- Die Arbeit diskutiert, ob Martial offene Kritik üben konnte angesichts der strengen Kontrolle und brutalen Reaktionen Domitians. Versteckte Kritik wird in einzelnen Gedichten vermutet, aber auch als Konstrukt interpretiert.
Welche Gesetze und Ereignisse unter Domitian werden in Martials Werken thematisiert?
- Genannt werden Domitians militärische Erfolge, die Erneuerung der Theatergesetze (lex Roscia theatralis) und die Erneuerung der lex Iulia de adulteriis coercendis.
Wie bewertet die Arbeit Garthwaites Interpretation von Martials Epigrammen?
- Garthwaites Interpretation, dass Martial versteckte Kritik übt, indem er seine Klagen über mangelnde Belohnung durch Patrone auf Domitian überträgt, wird als konstruiert, aber plausibel betrachtet.
Was ist das Fazit der Arbeit?
- Das Fazit lautet, dass es schwer ist zu sagen, ob Martial ein Heuchler war oder nicht. Es wird argumentiert, dass Martial in der düsteren Phase von Domitians Herrschaft offiziell den bloßen Verehrer des Kaisers gegeben hat, um seinen Erfolg zu sichern. Nach Domitians Tod hat er möglicherweise seine vorherige Haltung wieder eingenommen, wobei unklar bleibt, ob dies aus eigener Überzeugung oder aufgrund geänderter Rahmenbedingungen geschah.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit bezüglich des Einflusses von Domitians Charakter auf Martials Werk?
- Es wird festgestellt, dass die Entwicklung in Martials Werk parallel zur Entwicklung in Domitians Herrschaftsstil und Charakter verläuft. Martials vorsichtige Kritik wird als Ausdruck einer aufrichtigen Meinung trotz aller Ergebenheit interpretiert.
- Quote paper
- Henning Rimmel (Author), 2002, Martial und Domitian, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/107754