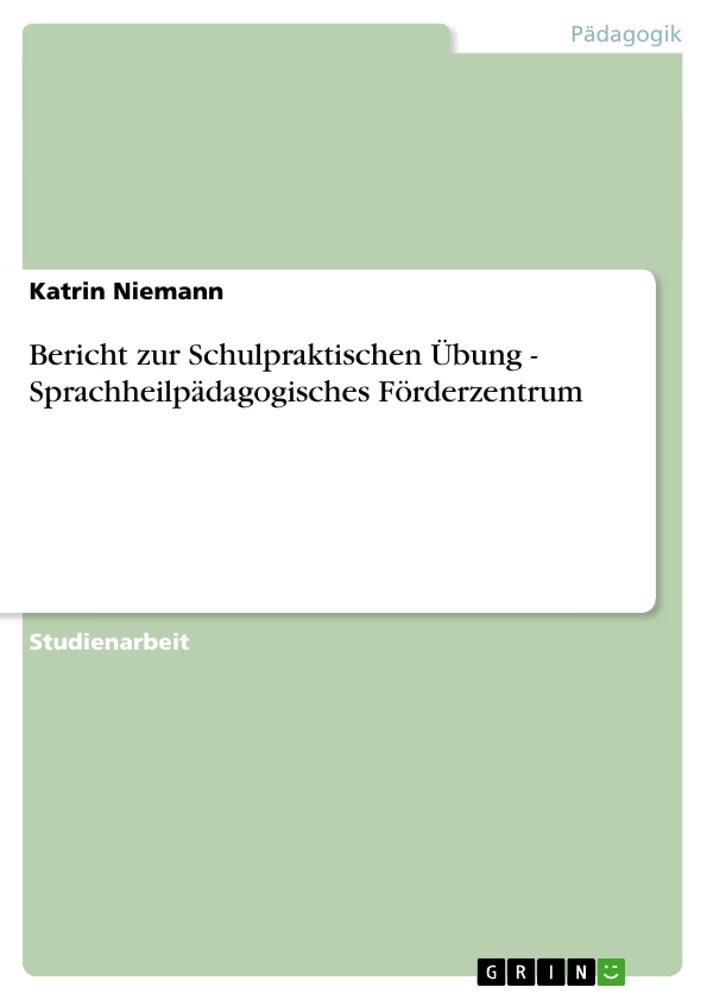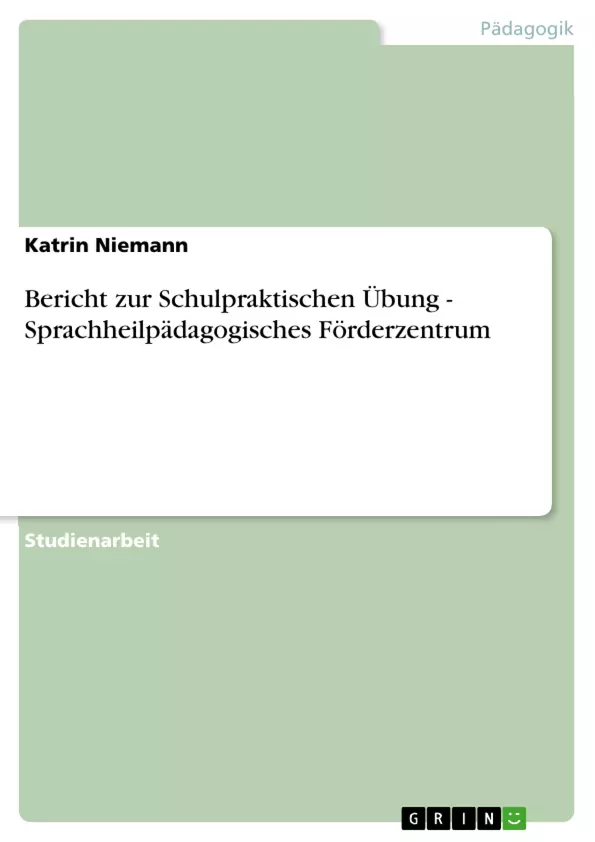Grobziel: - Festigen von Rechengesetzen und Anwendung dieser zur Entwicklung eigener Rechenstrategien, - Zusammenhänge erkennen zwischen Multiplikation & Division, Addition und Subtraktion. Curriculare Feinziele: Wissensziele:
Die Schüler sollen das schriftliche Multiplizieren von einstelligen mit zweistelligen Zahlen kennen lernen. Könnensziele: Die Schüler sollen in der Lage sein, den vorgestellten Rechenweg auf neue Aufgaben zu transferieren. Sonderpädagogische Ziele: - Förderung der akustischen Wahrnehmung durch Zuhören, - Förderung der Auge – Hand - Koordination durch verschiedene Schreibübungen, - Förderung des Aufgabenverständnis durch Erklärungen, Soziale und Verhaltensziele: - Steigerung der Lernfreude durch Arbeit in der Gruppe, - Steigerung des Selbstwertgefühls durch Gespräche und Ergebnisdarstellung
Inhaltsverzeichnis
1. Die Klasse 3l
2.1. Allgemeine Bemerkungen zur Klasse
2.2. Individuelle Lernvoraussetzungen
2. Ausrichtung am Rahmenplan
3. Eigene Unterrichtsversuch
3.1. Unterrichtsversuch vom 06.05.2002 Lehr- und Lernziele Verlaufsplanung Reflektion
3.2. Unterrichtsversuch vom 28.05.2002 (Doppelstunde) Lehr- und Lernziele Sachanalyse Didaktisch-methodische Analyse Verlaufsplanung Reflektion
3.3. Unterrichtsversuch vom 11.06.2002 Lehr- und Lernziele Verlaufsplanung Reflektion
4. Literaturverzeichnis
5. Anhang für die gesamte Arbeit (Arbeitsblätter, Verlaufsplanung)
2. Ausrichtung am Rahmenplan
Für die Förderung LRS- Schüler basieren die Richtlinien auf der Grundlage des Rahmenplans für das Fach Deutsch in der Grundschule. Da der Lese- und Rechtschreibprozess viele Tätigkeiten in sich vereint, muss sich die Gestaltung des spezifischen Deutschunterrichts an den individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler orientieren. Zu beachten ist hier das Prinzip kleinster Lernschritte. Der Stoffumfang richtet sich nach den Lernvoraussetzungen der Klasse.
Der Unterricht an der Grundschule soll den Bedürfnissen der Kinder entgegenkommen und Schlüsselqualifikation wie Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Argumentationsfähigkeit und –bereitschaft, Transfervermögen, Fähigkeit zur Konfliktlösung usw. ausbilden.
„Der Mathematikunterricht in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 hat das grundlegende Ziel, die Schüler mit solchen Inhalten. Denk- und Arbeitsweisen vertraut zu machen und solche Gewohnheiten auszubilden, die eine Basis für die Bewältigung von Alltagsproblemen jüngerer Schüler sowie eine Voraussetzung für ein stärker mathematikorientiertes Tätigsein in der Sekundarstufe sind.“ (aus: Rahmenplan Grundschule. Mathematik. (1996) Kultusministerium des Landes Mecklenburg Vorpommern)
3. Eigene Unterrichtsversuche
3.1. Unterrichtsversuch vom 06.05.2002 Lehr- und Lernziele
Grobziel:
- Festigen von Rechengesetzen und Anwendung dieser zur Entwicklung eigener Rechenstrategien
- Zusammenhänge erkennen zwischen Multiplikation & Division, Addition und Subtraktion
Curriculare Feinziele:
Wissensziele: Die Schüler sollen das schriftliche Multiplizieren von einstelligen mit zweistelligen Zahlen kennen lernen.
Könnensziele: Die Schüler sollen in der Lage sein, den vorgestellten Rechenweg auf neue Aufgaben zu transferieren.
Sonderpädagogische Ziele:
- Förderung der akustischen Wahrnehmung durch Zuhören (alle)
- Förderung der Auge – Hand - Koordination durch verschiedene Schreibübungen (alle, bes. Jan)
- Förderung des Aufgabenverständnis durch Erklärungen ( Mathias, Vanessa) Soziale und Verhaltensziele:
- Steigerung der Lernfreude durch Arbeit in der Gruppe (Paul, Jan, Dennis)
- Steigerung des Selbstwertgefühls durch Gespräche und Ergebnisdarstellung (Vanessa)
Reflektion
Als Einstieg bietet sich ein Lied sehr gut an. Die Schüler sind begeistert und beginnen den Schultag mir einem lockeren Einstieg.
Die tägliche Übung ist in der Klasse ein Ritual in Mathestunden, deshalb wählte ich einige kurze Aufgaben zur Wiederholung. Jan kam zu spät und löste die Aufgaben separat, während ich das Thema einführte. Die Kinder nahmen meine Art des Unterrichtens gut an und waren von der riesigen Schokoladentafel sehr angetan.
Die Stationsarbeit wurde von den Schülern gut angenommen. Bei Frau Petrosino war dies oft Unterrichtsgegenstand und bot sich auch heute an. Die Gruppenbildung ging auch sehr schnell, wobei ich anfangs befürchtete, dass es zwischen einigen Schülern (Jan, Dennis und Paul) Reibereien zwecks Zusammensetzung der Teams geben könnte.
Die Erklärung der Gruppenarbeit gelang mir gut, denn die Arbeit an den einzelnen Aufgaben ging zügig voran. Positiv fiel mir auf, dass die einzelnen Gruppen untereinander gut miteinander arbeiteten. Besonders bei Mathias und Marcel war zu beobachten, dass sie sich die Aufgaben untereinander gut erklären konnten und so zügig voran kamen.
3.2. Unterrichtsversuch vom 28.05.2002 (Doppelstunde) Lehr- und Lernziele
Grobziel:
- Festigen von Rechengesetzen und Anwendung dieser zur Entwicklung eigener Rechenstrategien
- Zusammenhänge erkennen zwischen Multiplikation & Division, Addition und Subtraktion
Curriculare Feinziele:
Wissensziele: Die Schüler sollen das schriftliche Multiplizieren ohne Übertrag kennen lernen..
Könnensziele: Die Schüler sollen in der Lage sein, den vorgestellten Rechenweg auf neue Aufgaben zu transferieren.
Sonderpädagogische Ziele:
- Förderung der akustischen Wahrnehmung durch Zuhören (alle)
- Förderung der Auge – Hand - Koordination durch verschiedene Schreibübungen an der Tafel, im Heft, auf Arbeitsblättern (alle, bes. Jan)
- Förderung des Aufgabenverständnis durch Erklärungen ( Mathias, Vanessa) Soziale und Verhaltensziele:
- Steigerung der Lernfreude durch Arbeit in der Gruppe (Paul, Jan, Dennis)
- Steigerung des Selbstwertgefühls durch Gespräche und Ergebnisdarstellung (Vanessa)
- Schulung der Konzentration durch aktive Beteiligung am Unterrichtsverlauf ( Paul, Jan)
- Förderung der Teamfähigkeit durch Gruppenarbeit (Werner, Paul, Dennis, Jan)
Sachanalyse
In dieser Klasse lernen Kinder mit Leserechtschreibschwäche (LRS), Dyslalie, Dysgrammatismus und semantischen Störungen, die unterschiedlich ausgeprägt sind.
LRS
Hinsichtlich der Definition herrscht bisher keine Einigkeit. Während die pädagogische Definition mehr die anlagebedingte Lernschwäche bei normaler Intelligenz und hinreichender Sinnesfunktion betont, heißt es bei WIRTH: „ Bei der Leserechtschreibschwäche liegt eine Teilleistungsschwäche im sprachlichen Bereich vor , im Sinne eines Defizits isolierter Funktionen.“ (Wirth Sprachstörungen, Sprechstörungen, Kindliche Hörstörungen, 2000 S.392)
Dyslalie
Nach WIRTH handelt es sich um eine Störung der Artikulation, bei der einzelne Laute oder Lautverbindungen betroffen sein können. Sie werden ersetzt, weggelassen oder falsch gebildet. Bei der Dyslalie unterscheidet man organische und die funktionell bedingte Dyslalie.
Bei der Diagnostik lassen sich folgende Kategorien bestimmen:
- Partielle Dyslalie ( 1-3 Laute und/oder Lautverbindungen)
- Multiple Dyslalie ( 4-8 Laute und/oder Lautverbindungen )
- Universelle Dyslalie (mehr als 8 Laute und/oder Lautverbindungen )
Kinder mit Dyslalie haben oft große Probleme beim Erlernen des Lesens und Schreibens, wobei die Ursache in der phonematischen Differenzierungsschwäche zu suchen ist.
Dysgrammatismus
Häufig gestellte Fragen
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis des Dokuments?
Das Inhaltsverzeichnis listet folgende Punkte auf: Die Klasse 3l mit Unterpunkten zu allgemeinen Bemerkungen und individuellen Lernvoraussetzungen, Ausrichtung am Rahmenplan, Eigene Unterrichtsversuche (mit detaillierten Angaben zu drei Versuchen am 06.05.2002, 28.05.2002, und 11.06.2002), Literaturverzeichnis und Anhang mit Arbeitsblättern und Verlaufsplanung.
Welche Bedeutung hat die "Ausrichtung am Rahmenplan"?
Die Richtlinien zur Förderung von LRS-Schülern basieren auf dem Rahmenplan für Deutsch in der Grundschule. Der Unterricht soll sich an den individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler orientieren, das Prinzip kleinster Lernschritte berücksichtigen und Schlüsselqualifikationen wie Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit ausbilden.
Was sind die Lehr- und Lernziele des Unterrichtsversuchs vom 06.05.2002?
Das Grobziel ist die Festigung von Rechengesetzen und die Entwicklung eigener Rechenstrategien, sowie das Erkennen von Zusammenhängen zwischen Multiplikation & Division, Addition und Subtraktion. Die curricularen Feinziele beinhalten das Erlernen des schriftlichen Multiplizierens und die Fähigkeit, den Rechenweg auf neue Aufgaben zu übertragen. Sonderpädagogische Ziele umfassen die Förderung der akustischen Wahrnehmung, Auge-Hand-Koordination und des Aufgabenverständnisses.
Was ist die Reflektion zum Unterrichtsversuch vom 06.05.2002?
Der Einstieg mit einem Lied wurde positiv aufgenommen. Die Stationsarbeit und Gruppenbildung funktionierten gut, und die Schüler arbeiteten gut miteinander. Es wurde hervorgehoben, dass die Schüler sich untereinander die Aufgaben gut erklären konnten.
Welche Lehr- und Lernziele hatte der Unterrichtsversuch vom 28.05.2002 (Doppelstunde)?
Das Grobziel war wie beim ersten Versuch die Festigung von Rechengesetzen und das Erkennen von Zusammenhängen zwischen Rechenarten. Die curricularen Feinziele beinhalteten das Erlernen des schriftlichen Multiplizierens ohne Übertrag und die Fähigkeit, den Rechenweg auf neue Aufgaben zu übertragen. Sonderpädagogische Ziele umfassten die Förderung der Wahrnehmung, Koordination, des Aufgabenverständnisses, sowie soziale Ziele wie die Steigerung der Lernfreude und Teamfähigkeit.
Welche Sachanalyse wird im Dokument bezüglich der Klasse gegeben?
Die Klasse beinhaltet Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), Dyslalie, Dysgrammatismus und semantischen Störungen. Die verschiedenen Störungen werden kurz definiert.
Wie werden LRS, Dyslalie und Dysgrammatismus definiert?
LRS wird als Teilleistungsschwäche im sprachlichen Bereich definiert. Dyslalie ist eine Störung der Artikulation. Dysgrammatismus wird als die Unfähigkeit beschrieben, das Regelsystem der Muttersprache altersgerecht zu erwerben und zu gebrauchen.
- Arbeit zitieren
- Katrin Niemann (Autor:in), 2002, Bericht zur Schulpraktischen Übung - Sprachheilpädagogisches Förderzentrum, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/107154