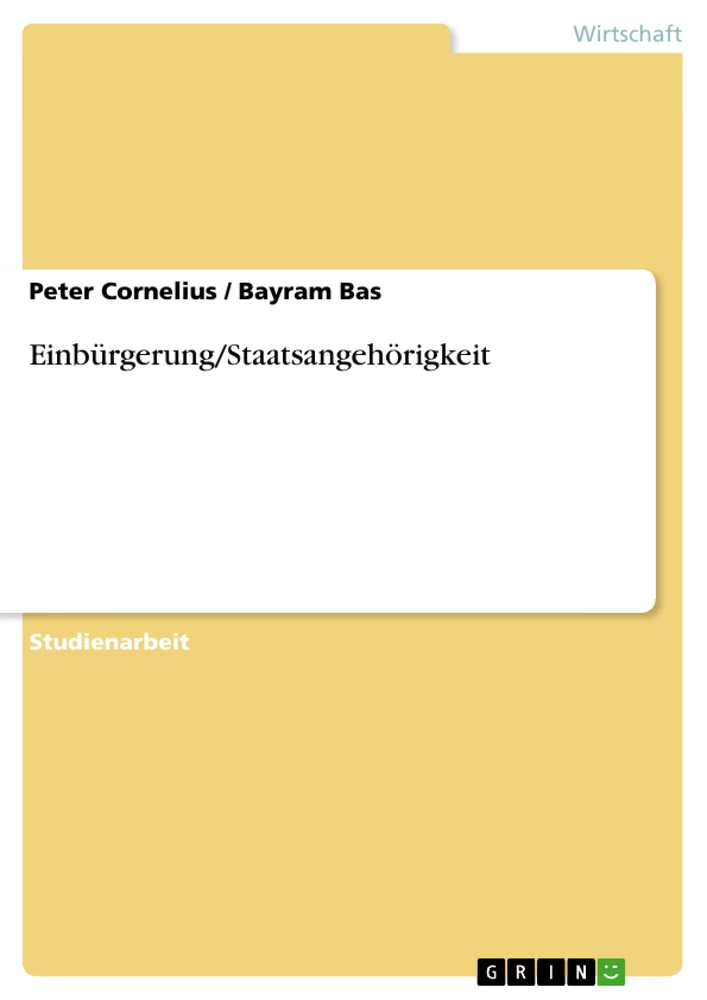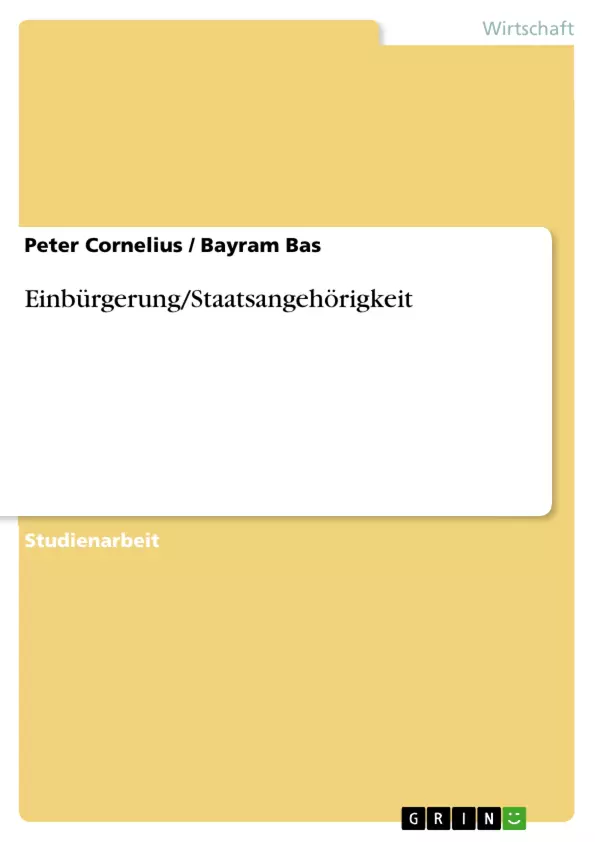Wie wird man Deutscher? Eine Frage, die mehr als sieben Millionen Menschen in Deutschland beschäftigt und deren Antwort das Gefüge unserer Gesellschaft maßgeblich beeinflusst. Dieses Buch beleuchtet die vielfältigen Facetten des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts, von den historischen Wurzeln des Abstammungsprinzips bis hin zu den modernen Ergänzungen durch das Geburtsrecht. Es bietet einen umfassenden Überblick über die Voraussetzungen und Verfahrensweisen für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, sowohl durch Geburt als auch durch Einbürgerung, und erklärt detailliert die Rechte und Pflichten, die mit der Staatsbürgerschaft einhergehen. Dabei werden die zentralen Begriffe wie Ausländer, Deutsche und Deutschstämmige präzise definiert und voneinander abgegrenzt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Regelungen zur Mehrstaatigkeit, den gesetzlichen Änderungen in diesem Bereich und den damit verbundenen Herausforderungen für die Integration. Detaillierte Erklärungen zu den Themen Einbürgerungsvoraussetzungen, wie Sprachkenntnisse, finanzielle Absicherung und Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, werden ebenso verständlich erläutert wie die Sonderregelungen für Ehegatten von Deutschen, EU-Bürger und Staatenlose. Auch der Verlust der Staatsangehörigkeit, beispielsweise durch Militärdienst im Ausland oder den Erwerb einer anderen Staatsangehörigkeit, wird thematisiert. Abgerundet wird das Werk durch ein Lexikon zur Einbürgerung, das die wichtigsten Fachbegriffe verständlich erklärt, sowie ein ausführliches Literaturverzeichnis für weiterführende Recherchen. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Ratgeber für alle, die sich mit dem Thema Staatsangehörigkeit auseinandersetzen müssen oder wollen, sei es aus persönlichem Interesse, beruflicher Notwendigkeit oder politischem Engagement. Es ermöglicht ein fundiertes Verständnis der komplexen Materie und trägt dazu bei, die Diskussion um Integration und Staatsbürgerschaft auf eine informierte Basis zu stellen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Allgemeines
1.2 Begriff der Nationalität
1.3 Einwanderung in Deutschland
2 Funktion der Staatsangehörigkeit
3 Bestimmung der Begrifflichkeiten
3.1 Ausländer
3.2 Deutsche
3.3 Deutschstämmige
3.3 Deutsche Staatsbürgerschaft
4 Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit
4.1 Deutsch durch Geburt
4.2 Ergänzung des Geburtrechtes
4.3 Voraussetzungen
4.4 Optionsmodell
5 Einbürgerung
5.1 Definition
5.2 Voraussetzungen
5.3 Regelanspruch für Ehegatten
5.4 Regelungen bei Bürgern der EU
5.5 Regelungen für Staatenlose
5.6 Kosten der Einbürgerung
6 Verlust der Staatsangehörigkeit
6.1 Verlust der Staatsangehörigkeit durch Millitär- dienst im Ausland
6.2 Verlust der Staatsangehörigkeit durch Antragser- werb im Inland
6.3 Aufgabe der Staatsangehörigkeit
7 Mehrstaatigkeit
8 Gesetzliche Änderungen im Bereich der Mehrstaatigkeit
9 Fazit
Lexikon zur Einbürgerung (Glossar)
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 : Ausländer im Bundesgebiet seit 1960
Abbildung 2 : In Deutschland geborene ausländische Bevölkerung
Abbildung 3 : Eingebürgerte Personen nach Bundesländern
Abbildung 4 : Einbürgerung nach Nationalitäten
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
In den letzten Jahren waren Diskussionen zur Staatsbürgerschaft bzw. doppelten Staatsbürgerschaft und Fragen nach neuen Integrationsfor- men für Ausländer häufig Themen in Nachrichten, Politik und Zeitge- schehen.
Diese Arbeit soll einen Beitrag zum besseren Verständnis von Einbürgerungsverfahren leisten.
Im zweiten Kapitel wird auf die Funktion der Staatsbürgerschaft eingegangen, in Kapitel drei werden die Begrifflichkeiten näher erläutert. Das Herz dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit und der Einbürgerung.
So wie man die Staatsbürgerschaft erwirbt kann man sie auch verlieren. In Kapitel 7 wird kurz zur Mehrstaatigkeit eingegangen. Das neue Staatsangehörigkeitsrecht war längst überfällig. Das in seinen Grundzügen seit 1913 bestehende „Reichs- und Staatsangehörigkeitsge- setz“ leitete die Eigenschaft, Deutscher zu sein, von der Abstammung ab. Ausländer konnten nur Deutsche werden, wenn sie die eng formulierten Voraussetzungen der Einbürgerung erfüllten - lange Zeit nur nach dem Ermessen der Behörden. An eine umfangreiche Einbürgerung war nicht gedacht, und bis heute ist die Zahl der Einbürgerungen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gering.
Mit dem neuen deutschen Staatsangehörigkeitsrecht wird das bisherige veraltete Gesetz modernisiert und an den europäischen Standart ange- passt.
Kern der Reform ist die Ergänzung des traditionellen Abstammungsprinzips durch den Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Geburt. Dies erleichtert den in Deutschland geborenen Kindern ausländischer Eltern die Identifizierung mit Ihrem Heimatland Deutschland. Sie erhalten die Chance, als Deutsche unter Deutschen aufzuwachsen.
Die entscheidende Reform des neuen Staatsangehörigkeitsrechts ist die Ergänzung um das Geburtsrecht: In Deutschland geborene Kinderaus- ländischer Eltern, die dauerhaft hier leben, werden deutsche Staatsbür- ger.1
Im neuen Gesetz wird ein weiteres wichtiges Integrationsangebot verankert: die Verkürzung der Einbürgerungsfrist für die seit langem in Deutschland lebenden Ausländer.
Wer auf Dauer in Deutschland leben will, muss die Verfassung und die Rechtsordnung achten. Ebenso selbstverständich ist das Erlernen der deutschen Sprache. Integration gelingt nur, wenn der Wille dazu auf beiden Seiten - bei den Deutschen und den in Deutschland lebenden Ausländern - vorhanden ist.
1.1 Allgemeines
„Staatsangehörigkeit setzt den Staat voraus und ist mit diesem untrennbar verbunden. Ohne das Zuordnungsobjekt Staat kann es keine Angehörigen an den Staat geben.“2
„Umgekehrt ist die Existenz eines Staates ohne eigene Staatsangehörige nicht denkbar. Der Staat wird nach traditioneller Auffassung neben den Elementen des Staatsgebiets und der Staatsgewalt durch das Staatsvolk konstituiert, das rechtlich erfasst werden muss.“3
1.2 Nationalität
„Der Begriff der „Nationalität“ ist schwieriger einzuordnen, weil er eine ambivalente Bedeutung hat.
Im völkerrechtlichen und diplomatischen Sprachgebrauch wird der Begriff der „Nation“, auf den sich „Nationalität“ bezieht, häufig als Synonym für „Staat“ gebraucht.“4
„Der Begriff der „Nationalität“ bezeichnet jedoch im heutigen Sprachgebrauch eine von der Nation verschiedene soziale Gruppe. Unter einer „Nationalität“ wird eine „ethisch“ oder sprachlich bestimmte Minderheit innerhalb eines größeren Staatsverbandes, d.h. eine Volksgruppe oder eine nationale Minderheit verstanden.“5
1.3 Einwanderung in Deutschland
Das neue Staatsangehörigkeitsrecht spiegelt zum Ersten Mal auch die gesellschaftliche Wirklichkeit in der Bundesrepublik wider.6Deutschland ist schon längst zum Einwanderungsland geworden. Seit in den 60er und 70er Jahren Arbeitskräfte aus anderen Staaten ins Land geholt wurden und ihren Beitrag zu Wirtschaftswachstum und Wohlstand leisteten, ist die Bundesrepublik für sie und ihre Familien längst Heimat geworden.
2 Die Funktion der Staatsbürgerschaft
„Die Staatsbürgerschaft entscheidet über die Rechte und Pflichten, die man in der Bundesrepublik hat - das Recht zu wählen, einen freien Beruf auszuüben oder die Verpflichtung zum Wehrdienst oder Zivildienst. Was für die meisten von uns selbstveständlich ist, ist es für einen anderen Teil der Bevölkerung nicht.
Über sieben Millionen Menschen leben in Deutschland, ohne die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben. Viele von ihnen sind als Arbeitnehmer oder Flüchtling nach Deutschland gekommen, als Familienmitglieder nachge- zogen, hier geboren und aufgewachsen. Längst haben sie als Arbeitneh- mer und Unternehmer, als Steuerzahler, Rentner, Studierende oder Auszubildende ihren Platz in der deutschen Gesellschaft gefunden. Aus „Ausländern“ sind längst „Inländer“ geworden - oft noch ohne deutschen Pass. Diese Kluft gesellschaftlicher Wirklichkeit und rechtlicher Zugehörigkeit soll mit dem neuen Staatsbürgerrecht schließen helfen. Wer dauerhaft zu dieser Gesellschaft gehört, soll auch die gleichen Rechte und Pflichten haben. Ich bin sicher, dass dies ein Schritt ist, unsere Gesellschaft fairer, toleranter und gerechter zu gestalte.“7
Abb. 1: Ausländer im Bundesgebiet seit 1960 (Stand: 31.12.2000)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Statistisches Bundesamt, zitiert nach
[http://www.bundesauslanderbeauftragte.de/daten/infos.htm],
15.04.2002
3 Bestimmung der Begrifflichkeiten
3.1 Ausländer
Wenn man eine Arbeit zur Einbürgerung schreibt, dann stößt man unverweigerlich auf die Frage, wer sich denn einbürgern lassen möchte. Die Antwort: Ausländer.
Aber wer ist das nun genau?
Juristisch gesehen ist diese Frage leicht zu beantworten; Ausländer ist jeder, der nicht die Staatsangehörigkeit des Landes besitzt in dem er/sie lebt.
So schreibt z.B. der belgische Gesetzgeber: „Ausländer sind alle Personen, die nicht nachweisen können, dass sie die belgische Staatsangehörigkeit besitzen.“
Aber „Ausländer“ sein bedeutet nicht nur formal eine Person in einer an- deren Staatsangehörigkeit zu sein, sondern auch „sozial“ gesehen wird er als „Fremder“ - überspitzt gesagt als Eindringliche - betrachtet, dem al- leine schon aufgrund dieser Tatsache mit Misstrauen begegnet wird. Jedes Jahr werden in Deutschland 100.000 Kinder geboren, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Sie wachsen hier auf und kennen das Land, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, oft nur von Ferienrei- sen. Sie sind Hamburger, Berliner oder Münchener, sie sprechen schwä- bisch, kölsch oder hessisch.
Von den mehr als sieben Millionen Ausländern, die in Deutschland leben und arbeiten, ist ein Drittel schon länger als 30 Jahre hier, die Hälfte mindestens zehn Jahre. Sie sind hier zu Hause. Sie sollen Bürgerinnen und Bürger des Gemeinwesens werden - Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten.8
3.2 Deutsche
„Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiet des Deutschen Rei- ches nach dem Stand vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.“9
„Wenn wir definieren, wer Deutscher ist und wer nicht, sei erst mal einmal vorangestellt, dass, wenn hier in Deutschland die Rede ist, unterschieden werden muss zwischen „Deutschland als Vaterland“ durch seine Geschichte und Kultur charakterisiert und Deutschland als Staat, der seinen Staatsbürgern …die gleichen Rechte garantiert und die gleichen Pflichten auferlegt, oder: der Kulturbegriff Deutschland (Kulturnation) und der Rechtsbegriff Deutschland (Staatsnation).“10
3.3 Deutschstämmige
„Dann gibt es noch diejenigen, mit denen wir die Sprache und Kultur tei- len, aber nicht das Vaterland. Ich meine die Deutschstämmigen etwa in Rumänien oder der ehemaligen Sowjetunion. Sie sind nicht deutsche Staatsbürger und nicht unsere Mitbürger, aber sie stehen uns näher als andere im Ausland.“11
3.4 Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft
Die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wer sie erworben und nicht wieder verloren hat. Seit dem 1. Januar 1914 sind vor allem die Erwerbs- und Verlustgründe des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetztes in sei- ner jeweiligen geltenden Verfassung zu beachten. Davor waren Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit im Gesetz über die Erwe- bung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 geregelt.
4 Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit
4.1. Deutsch durch Geburt
Wer als Kind deutscher Eltern geboren wird, braucht sich im seine Staatsangehörigkeit wenig Gedanken zu machen. Für ihn ist selbstverständlich, seit seiner Geburt die Staatsangehörigkeit der Eltern zu haben. Das ist das so genannte „Abstammungsprinzip“. Das neue Staatsangehörigkeitsrecht ändert an diesem Prinzip nichts Wesentliches.12
Es funktioniert nach folgendem Grundsatz:
Ein Kind wird mit der Geburt Deutscher oder Deutsche, wenn wenigstens ein Elternteil deutscher Staatsbürger ist. Die Staatsangehörigkeit des an- deren Elternteils spielt für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit keine Rolle. Allerdings wird das Kind in vielen Fällen mit der Geburt zugleich die ausländische Staatsangehörigkeit des anderen Elterneils er- werben. Das Kind besitzt dann mehrere (zwei) Staatsangehörigkeiten. Es entsteht Mehrstaatigkeit.
4.2 Ergänzung des Geburtsrechtes durch das Abstam mungsprinzip
Ergänzend zum Abstammungsprinzip gilt in Deutschland ab dem 1. Januar 2000 auch das Geburtsrecht. Viele Staaten haben es bereits in Ihrem Recht verankert.
Danach bestimmt nicht allein die Nationalität der Eltern eines Kindes seine Staatsangehörigkeit, sondern auch der Geburtsort.
Wenn ein Kind in Deutschland geboren wird, ist es zukünftig automatisch mit der Geburt Deutche oder Deutscher, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Abb. 2: In der BRD geborene ausländische Bev. (Stand: 31.12.2000)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Statistisches Bundesamt, zitiert nach
[http://www.bundesauslaenderbeauftrage.de/daten/infos.htm],15.04.20 02
4.3 Voraussetzungen
- Einer der Elternteile muss sich mindestens seit acht Jahren dauer- haft und rechtmäßig in Deutschland aufhalten
- Eine Aufenthaltsberechtigung oder seit mindestens drei Jahren ei- ne unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzen
Liegen diese Voraussetzungen bei Vater oder Mutter vor, wird von zusätzlichen Anträgen abgesehen.
Das in der BRD geborenes Kind wird automatisch Deutsche oder Deut- scher.
4.4 Optionsmodell
Das Optionsmodell gilt nicht für Kinder, die nach dem Abstammungsprinzip mit der Geburt mehrere Staatsangehörigkeiten erworben haben, wenn ihre Eltern unterschiedliche Staatsangehörigkeiten hatten.
Es gilt für Kinder, deren Eltern Ausländer sind, die aber mit der Geburt unter den genannten Voraussetzungen Deutsche geworden sind (Geburtsrecht), wenn sie mit der Geburt gleichzeitig die ausländische Staatsangehörigkeit der Eltern erworben haben.
Bis zum 23. Lebensjahr müssen sich diese Kinder nach dem Optionsmo- dell entscheiden, ob sie ausschliessslich deutsche Staatsbürger sein wol- len.
Gehört das Kind zu dieser Gruppe passiert folgendes, wenn das Kind volljährig ist:
Die Behörden weisen es darauf hin, dass es sich nach dem Optionsmodell zu seiner Staatsangehörigkeit erklären muss und erläutern ihrem Kind das gesamte Verfahren.
Das Kind kann sich entscheiden, die ausländische Staatsangehörigkeit zu behalten. Die deutsche verliert es dann aber.
Hat das Kind bis spätestens zur Vollendung des 23. Lebensjahrs keine Erklärung abgegeben, verliert es die deutsche Staatsangehörigkeit.
Will das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit behalten, muss es grundsätzlich bis zum 23. Lebensjahr nachweisen, dass die andere Staatsangehörigkeit nicht mehr besteht.
Hierbei kann es gewisse Ausnahmen geben:
- Das nicht Möglichsein nach dem Recht des anderen Staates, die Staatsangehörigkeit aufzugeben
- Vorhandensein von bestimmten Umständen, die es nicht zumutbar machen, die andere Nationalität aufzugeben
In solchen Fällen ist es nicht möglich, beide Staatsangehörigkeiten zu behalten. Hierbei gelten auch dieselben Gründe, die bei der Hinnahme von Mehrstaatigkeit bei der Anspruchseinbürgerung Anwendung finden.
Dazu muss aber spätestens bis zum 21. Lebensjahr ein Antrag gestellt werden, damit die Behörde die Beibehaltung der bisherigen Staatangehörigkeit erlaubt.
5 Einbürgerung
5.1 Definition
Unter Einbürgerung versteht man das Erwerben der deutschen Staatsangehörigkeit durch Antragstellung. Anders als beim Geburtsrecht tritt der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nicht automatisch ein, sondern es muss ein Antrag gestellt werden.13
Man findet in dem Wort Einbürgerung auch das Wort „Bürger“ und daran kann man die eigentliche Bedeutung gut verdeutlichen: Der Ausländer soll ein Bürger mit allen Rechten und Pflichten im „neuen“ Land wer- den.14
5.2 Voraussetzungen
Der Anspruch auf Einbürgerung hat ab dem 1. Januar 2000 folgende wesentlichen Voraussetzungen:
- Acht Jahre rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland
Diese Voraussetzung erfüllt man, wenn der Lebensmittelpunkt in der Bundesrepublik Deutschland liegt und wenn man im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung ist.
- Der Lebensunterhalt muss für denjenigen und seinen unterhalts-
berechtigten Familienangehörigen ohne Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe bestritten werden können
Die Voraussetzung gilt jedoch nicht, wenn noch nicht das 23. Lebensjahr vollendet ist. Ferner wird eine Ausnahme gemacht, wenn man Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe braucht. Ohne den Grund dafür selbst zu vertreten zu müssen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man durch eine betriebs- bedingte Kündigung arbeitslos wird, die mit dem persönlichen Verhalten nichts zu tun hat.
- Er/Sie muss über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen
Perfekte Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift sind für die Einbürgerung nicht erforderlich. Nach dem Entwurf der Verwaltungs- vorschrift hat man ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache, wenn man im täglichen Leben einschließlich der üblichen Kontakte mit Behörden auf Deutsch zurecht findet und man - entsprechend dem Alter und Bildungsstand - ein Gespräch auf Deutsch führen kann. Dazu ge- hört, dass Lesen von Texten des alltäglichen Lebens verstehen und mündlich wiedergeben können.
Ein Diktat oder das Schreiben eines Aufsatzes wird die Einbürgerungsbe- hörde daher nicht verlangen. Man kann ausreichende Deutschkenntnisse auch durch Unterlagen nachweisen. Es reicht aus, wenn das Zertifikat über Deutsch oder ein gleichwertiges Sprachdiplom erworben hat oder vier Jahre eine deutschsprachige Schule mit Erfolg (Versetzung) besucht hat.
Weiterhin wird der Hauptschulabschluss oder wenigstens ein gleichwertiger Schulabschluss auch als ausreichend für die Kenntnisse über die Deutsche Sprache anerkannt.
Wenn man diese Nachweise nicht vorlegen kann, kann die Einbürge- rungsbehörde die Sprachkenntnisse selbst überprüfen. Dazu kann man zu einem Gespräch eingeladen werden, in dem auch ein Text (z.B. ein Zeitungsartikel) Thema sein kann.
- Er/Sie darf sich keiner Straftat schuldig gemacht haben und des- wegen verurteilt sein
Sollte gegen diesen Bürger ermittelt werden, muss die Einbürgerungsbe- hörde mit der Entscheidung über den Antrag warten, bis die Ermittlung abgeschlossen und möglicherweise eingestellt ist oder das Gericht ent- schieden hat.
Eine Einbürgerung wegen einer schweren Straftat macht die Einbürge- rung unmöglich. Nach gewissen Fristen - abhängig von der Straftat - werden solche Straftaten aber wieder aus dem Bundeszentralregister ge- strichen. Nach Ablauf dieser Fristen ist eine Einbürgerung wieder mög- lich.
Geringfügige Verurteilungen stehen der Einbürgerung nicht im Wege.
- Er/Sie muss sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland bekennen.
Sie ist der Kern der deutschen Verfassung, des Grundgesetzes. In ihr sind einige Prinzipien besonders geschützt.
Das sind zum Beispiel die Menschenrechte, die Volkssouverenität, die Trennung der Staatsgewalten, der Rechtsstaat und das Recht auf Oppo- sition.
Man muss sich zu diesen Prinzipien bekennen und sich erklären, dass man nicht an verfassungsfeindlichen Bestrebungen teilgenommen hat.
Muss die Behörde annehmen, dass man verfassungsfeindlich war und die
freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet hat, kann man nicht deutscher Staatsbürger werden.
- Er/Sie muss seine alte Staatsangehörigkeit in der Regel bei der Einbürgerung verlieren oder aufgeben Das neue deutsche Recht soll wie bisher Mehrstaatigkeit auch bei der Einbürgerung weitgehend vermeiden. Das heißt, die alte Staatsbangehörigkeit soll nicht bestehen bleiben, wenn man durch Einbürgerung Deutsche oder Deutscher wird. Dies geschieht auf zwei Wegen: der Verlust und die Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit.
Abb. 3: Eingebürgerte Personen im Jahr 2000 nach Bundesländern (Veränderungen gegenüber 1999 in %)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Statistisches Bundesamt, zitiert nach
[http://www.bundesauslaenderbeauftragte.de/daten/infos.htm], 15.04.2000
Abb. 3: Einbürgerungen nach Nationalitäten (Stand: 31.12.2000)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Statistisches Bundesamt, zitiert nach
[http://www.bundesauslaenderbeauftragte.de/daten/infos.htm], 15.04.2000
5.3 Regelanspruch für Ehegatten
Ehepartner von Deutschen haben unter bestimmten Voraussetzungen ei- nen Regelanspruch („soll“) auf Einbürgerung, d.h. die Einbürgerung kann - liegen die Voraussetzungen vor - nur in Ausnahmefällen versagt wer- den.
Die Einbürgerung kann etwa verweigert werden, wenn die Ehe geschei- tert ist, beide Partner getrennt leben und eine Scheidung geplant ist. Auch so genannte Scheinehen begründen keinen Anspruch auf Einbürge- rung. Darunter werden Ehen verstanden, die keine familiäre Lebensge- meinschaft sind, sondern nur geschlossen wurden, um ausländerrechtli- che Vorteile zu haben.
Die Voraussetzungen für eine Einbürgerung sind für Ehepartner von Deutschen:
- Er/Sie muss einen Antrag stellen
- Es darf kein Ausweisungsgrund etwa wegen begangener Strafta- ten gegen diesen vorliegen
- Er/Sie muss eine Wohnung oder eine andere Unterkunft haben
- Er/Sie muss sich und seinen Angehörigen zu ernähren imstande sein, also keine Sozial- oder Arbeitslosenhilfe beziehen
Das heißt, dass man sich und seine Familie grundsätzlich aus eigener Erwerbstätigkeit oder aus Vermögen versorgen kann.
Bei Ehepartner reicht es natürlich aus, wenn der Unterhalt der Familie durch einen Ehepartner gesichert wird. Kann man seinen Unterhalt nur durch Inanspruchnahme öffentlicher Mittel (z.B. Arbeitslosen- oder Sozi- alhilfe) sichern, ist eine Einbürgerung daher nicht möglich. Anders als bei der Anspruchseinbürgerung können die Behörden hier keine Ausnahmen machen.15
5.4 Regelungen bei Bürgern der EU
Auch für Unionsbürger gelten die Regeln über die Einbürgerung wie bei anderen Ausländern. Unionsbürger verfügen regelmäßig über eine Aufenthaltserlaubnis - EG. Verlangt das Gesetzt, dass eine Aufenthaltserlaubnis vorhanden sein muss, reicht natürlich auch der Besitz einer Aufenthaltserlaubnis-EG aus.
Ferner kann bei Unionsbürgern in bestimmten Fällen Mehrstaatigkeit hingenommen werden.
5.5 Regelungen für Staatenlose
Staatenlos ist man, wenn kein Staat nach seinem eigenen Recht als seinen Staatsangehörigen ansieht.
Das man Staatenlos ist, weißt man den Einbürgerungsbehörden am bes- ten durch Vorlage eines Reiseausweises für Staatenlose nach. Bei der Anspruchseinbürgerung und bei der Ermessenseinbürgerung gilt für Staatenlose im Grundsatz das gleiche wie für andere Einbürgerungs- bewerber.
Allerdings haben Staatenlose keine andere Staatsangehörigkeit. Deshalb müssen diese auch keine aufgeben.16
Für Kinder von Staatenlosen, die in Deutschland geboren wurden, gibt es darüber hinaus einen besonderen Einbürgerungsanspruch, liegen die Voraussetzungen vor, darf die Einbürgerung nicht versagt werden. Der Anspruch hat folgende Voraussetzungen:
- Das Kind muss schon bei der Geburt staatenlos sein
- Er/Sie muss in Deutschland geboren sein
Auch die Geburt in einem deutschen Flugzeug oder auf einem deutschen Schiff erfüllt diese Bedingung (Territorialprinzip).
- Das Kind muss seit fünf Jahren rechtmäßig seinen dauernden Aufenthalt in Deutschland haben
Dies setzt regelmäßig eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Aufenthaltsbe- rechtigung voraus. Nach der Rechtssprechung des Bundesverwaltungs- gerichts kann im Einzelfall auch der Besitz einer Aufenthaltsbefugnis aus- reichen.
- Der Antrag auf Einbürgerung muss vor dem 21. Geburtstag ge- stellt werden
- Das staatenlose Kind darf nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren verurteilt worden sein
5.7 Kosten der Einbürgerung
Grundsätzlich sind pro Person 255 Euro zu bezahlen.
Für minderjährige Kinder ohne eigenes Einkommen, die mit Ihren Eltern zusammen eingebürgert werden, sind 55 Euro zu bezahlen.
Werden minderjährige ohne ihre Eltern - z.B. nach dem Anspruch für die in Deutschland geborene Kinder - eingebürgert, gilt die allgemeine Gebühr von 255 Euro.17
6 Verlust der Staatsangehörigkeit
Das bedeutet, dass der Staat, dem man bisher angehörte, diesen nicht mehr als seinen Bürger ansieht, wenn man sich anderswo einbürgern lässt. Dann braucht man gar nichts weiter zu tun, wenn man sich in Deutschland einbürgern lässt.
Außerdem wird die Deutsche Behörde verlangen, dass man eine entsprechende Bescheinigung über den Verlust beibringt.
6.1 Verlust durch Militärdienst im Ausland
Mit dem neuen Verlustgrund des feiwilligen Eintritts in fremde Streitkräf- te oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband (§ 28 StAG), etwa ei- ne Polizeisondertruppe, wird nur eine sehr begrenzte Fallgestaltung be- troffen. Es muß sich nämlich um einen deutschen Mehrstaater handeln, der freiwillig, also ohne gesetzliche oder sonstige Verpflichtung handelt, keine Zustimmung nach § 8 WPflG erhalten hat und auch nicht aufgrund eines zwischenstaatlichen Vertrages zur Dienstleistung berechtigt ist. Au- ßerdem muß es sich um den Verband des Staats seiner weiteren Staats- angehörigkeit handeln. Aus welchen Gründen Söldner in Drittstaaten nicht eingezogen sind, ist weder im Gesetzgebungsverfahren erwähnt noch sonst ersichtlich.18
6.2 Verlust durch Antragserwerb im Inland
Ein theoretisch wie praktisch wichtiger Schritt zur Verhinderung vor Mehrstaatigkeit bildet die Erweiterung des Verlustgrundes des Erwerbs einer fremden Staatsangehörigkeit aufgrund Antrags auf Inlandsfälle. Während bisher die deutsche Staatsangehörigkeit infolge Erwerbs einer weiteren Staatsangehörigkeit auf Antrag hin nur verliert, wer im Inland weder seinen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (§ 25 RuStAG) oder bei Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutsch- land die Staatsangehörigkeit eines anderen Vertragsstaates des MStÜbk. erwirbt. (Art. 1 MStÜbk.), tritt der Verlust künftig ohne Rücksicht auf den Lebensmittelpunkt und die Zugehörigkeit des anderen Staates zum Kreis der Vertragsstaaten des MStÜbk. ein (§ 25 StAG). Damit wird vor allem der ständigen Praxis türkischer Staatsangehöriger und Behörden der Bo-
den entzogen, nach der Entlassung aus der türkischen Staatsangehörig- keit und der Einbürgerung in Deutschland sogleich die Wiedereinbürgerung in der Türkei vorzunehmen.19
Diese seit vielen Jahren geübte Verfahrensweise hat zum Entstehen von Mehrstaatigkeit in sicher fünfstelliger Größenordnung beigetragen, ohne dass die früheren Bundesregierungen oder der Gesetzgeber hiergegen eingeschritten wären. Vereinzelte Versuche, die ebenso offensichtliche wie ärgerliche Hintergehen der deutschen Rechtsauffassung von der Notwendigkeit nicht zu dulden, oft Rücknahme der Einbürgerung zu begegnen, waren oft zum Scheitern verurteilt.20
6.3 Aufgabe der Staatsangehörigkeit:
Man muss sich an die Behörden des anderen Staates wenden, damit die andere Staatsbürgerschaft bei der Einbürgerung nicht bestehen bleibt. Meistens reicht dafür keine einfache Erklärung. Viele Staaten verlangen einen formalen Antrag, der bei der Auslandsvertretung zu stellen ist.
Sollte man bestimmte Voraussetzungen der einen Regelung nicht erfüllen, muss das nicht in jedem Fall eine Einbürgerung verhindern. Möglicherweise kann man nach anderen Vorschriften doch noch deutscher Staatsbürger werden.
7 Mehrstaatigkeit
In der Regel muss die ausländische Staatsangehörigkeit aufgegeben werden. Ausnahmen gelten wie bisher, wenn die Staatsangehörigkeit nicht oder nur unter besonderen Schwierigkeiten aufgegeben werden kann. Neue oder erweiterte Ausnahmen gelten unter anderem:
- Für ältere Personen, wenn die Entlassung aus der ausländischen Staatsangehörigkeit auf unverhältnismäßige Schwierigkeiten stößt
- Für anerkannte Flüchtlinge
- Bei unzumutbaren Bedingungen für die Entlassung aus der aus- ländischen Staatsangehörigkeit und
- Bei erheblichen Nachteilen insbesondere wirtschaftlicher oder vermögensrechtlicher Art
8 Gesetzliche Änderungen im Bereich der Mehrstaatigkeit
Bis zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechtes sah § 29 RUStAG vor, dass ein Deutscher, der eine andere Staatsangehörigkeit erwirbt, diese dann grundsätzlich verliert, wen er seinen Wohnsitz im Ausland hatte. In den Inlandsfällen trat hingegen kein Verlust ein, wenn eine andere Staatsangehörigkeit erworben wurde. Diese Regelung hat heute ihren Sinn und Zweck verloren. Wenn Mehrstaatigkeit generell vermieden wer- den soll, macht es keinen Sinn, Fälle von diesem Grundsatz auszuneh- men, nur weil die andere Staatsangehörigkeit im Inland erworben wur- de.21 Künftig soll der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit unabhängig davon eintreten, ob eine andere Staatsangehörigkeit im Inland oder Aus- land erworben wurde. Dabei soll allerdings ausweislich der Gesetzbe- gründung in mehr Fällen als bisher durch Erteilung einer Beibehaltungs- genehmigung, die vor Erwerb der anderen Staatsangehörigkeit beantragt werden muss, Mehrstaatigkeit hingenommen werden (die bisherige Pra- xis in diesem Bereich war äußerst restriktiv).
Wichtig ist auf jeden Fall der Hinweis, dass durch die Neuregelung keine Änderung in Fällen eintritt, in denen vor Wirksamwerden der Reform eine andere Staatsangehörigkeit im Bundesgebiet zulässigerweise erworben wurde. Die Neuregelung gilt erst ab 1.1.2000.
9 Fazit
Allgemein kann man sagen, dass ein erster und wichtiger Schritt zu einer neuen Integrationspolitik die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts war. Die Gesetzgeber traten Tatsachen Rechnung, dass durch dauerhafte Niederlassungen und die gestiegenen Zahlen der im Land geborenen Migrantenkinder immer mehr Menschen trotz fremder Staatsangehörig- keit zu Inländern werden.
In anderen EU-Ländern wie z.B der Niederlande wurde ein idealer Weg gefunden. Die Möglichkeit nach 5 Jahren sich einbürgern zu lassen wird geboten.
Man sollte sich in der EU zusammensetzen und Fragen nach der einheitlichen Regelung zur Einbürgerung klären.
Die Reform, die in jeweiligen Ländern durchführt, sind sicher nur ein erster Schritt in die richtige Richtung, denn es kann nicht nur das Ziel sein, eine gut strukturierte und faire Rechtslage zu haben, sondern die Gesetzgeber müssen auch Möglichkeiten - ob nun finanziell, pädagogischer oder fördernder Art - finden, damit Ausländer auch eine Chance haben, den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Besonders innerhalb der Sprachförderung könnten auch die Sozialpädagogen eine entscheidende Rolle spielen, da sie in vielen Gemeinden erste Ansprechpartner für die Ausländer sind.
Lexikon zur Einbürgerung22
Abstammungsprinzip
Erwerb der Staatsangehörigkeit der Eltern oder eines Elternteils durch Geburt. Der Fachbegriff für diesen Erwerb der Staatsangehörigkeit ist „ius sanguinis“.
Anspruchseinbürgerung
Ein Anspruch auf Einbürgerung gibt dem Betroffenen ein Recht auf die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn er die im Gesetz aufgeführten Vo- raussetzugen erfüllt. Durch die Herabsetzung der Fristen bei der An- spruchseinbürgerung nach dem Ausländergesetz besteht nunmehr be- reits nach acht Jahren Aufenthalt in Normalfall ein solcher Anspruch.
Aufenthaltsberechtigung
Sicherster Aufenthaltstitel, der immer unbefristet erteilt wird.
Einbürgerung
Die deutsche Staatsangehörigkeit wird auf Antrag erworben. Anders als beim Geburtsrecht tritt der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit hier nicht automatisch ein, sondern es muss ein Antrag gestellt werden.
Einwanderung
Mit der Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer vor über 40 Jahren be- ginnt die neuere Geschichte der Bundesrepublik als „Einwanderungs- land“. Was ursprünglich als vorübergehender Aufenthalt zu Arbeitszwe- cken geplant war, führte zur inzwischen selbstverständlichen Tatsache der Einwanderung.
Geburtsrecht
Mit diesem Begriff wird der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch die Geburt in Deutschland bei Kindern ausländischer Eltern bezeichnet. Fachbegriffe, die hierfür verwendet werden, sind unter anderen „ius soli“, Bodenrecht, Geburtsprinzip
Ius sanguinis
Lateinisch: Recht des Blutes Recht, das die Staatsangehörigkeit von Eltern ableitet
Ius soli
Lateinisch: Recht des Bodens, Landes Recht, das die Staatsangehörigkeit vom Geburtsort/- land ableitet.
Mehrstaatigkeit
Mit diesem Begriff ist gemeint, dass eine Person mehr als eine Staatsan- gehörigkeit besitzt. Mehrstaatigkeit ist bereits jetzt in Deutschland keine Sicherheit: Schätzungen von zwei Millionen Mehrstaatern aus. Sie kann aus einer Vielzahl von Günden entstehen, zum Beispiel bei Kindern aus binationalen Ehen.
Kinder aus binationalen Ehen
Kinder von Eltern mit unterschiedlicher Staatsangehörigkeit haben zumeist die Staatsangehörigkeit beider Elternteile, sie fallen nicht unter das Optionsmodell.
Straftaten
Bewerber, die wegen einer Straftat verurteilt worden sind, werden nicht eingebürgert. Bagatelldelikte wie zum Beispiel Geldstrafen bis zu 180 Tagessätzen sind ausgenommen.
Verfassungstreue
Bei der Einbürgerung wird ein Bekenntnis zur freiheitlichen demokrati- schen Grundordnung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch- land.
Literaturverzeichnis
I. Bücher:
Dahm, G., Völkerrecht, Bd. 1, Stuttgart 1958
Grawert, R., Staat und Staatsagenhörigkeit, Berlin 1973
Hagedorn, H., „Wer darf Mitglied werden?“, Opladen, 2001
Veiter, T., Nation als Rechtsbegriffe…, Köln, 1984
Lichter, M., Der Staatsangehörigkeitsbegriff im Wandel der Zeit, 1956
II. Zeitschriften und Zeitungen:
Renner, A., „Was ist neu am neuen Staatsangehörigkeitsrecht?“, in: Zeitung für Ausländerrecht (ZAR), 4/99, S.160
Schröder, S., „Ich bin Deutscher.“ Was heisst das?, in: Die Zeit, Nr. 4,
22.01.1993, S.36
Schröder, S., Renaissance der Nationalen, in: Die politische Meinung, 37/3, 1992, S.90-95
26
III. Sonstige Veröffentlichungen:
Art. 116 GG
Die Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen
(Hrsg.), 2. überarbeitete Auflage, Januar 2000
[http://www.bundesauslaenderbeauftragte.de/themen/staats.stm],
15.04.2002
[http://www.bundesauslaenderbeauftragte.de/daten/infos.htm].
15.04.2002
[http://www.einbuergerung.de/einb_kurz.htm], 15.04,2002
[http://www.einbuergerung.de/einb_lexi.html], 15.04.2002
IV. Informationsgespräche/Interviews:
Informationsgespräch mit Frau Kindling, U., Stadtverwaltung Moes, Ausländerbeauftragte, 08.05.2002
Telefon-Interview mit Frau Kindling, U., Stadtverwaltung Moers, Ausländerbeauftragte, 13.05.2002
[...]
1Vgl. Schily, O.,[http://www.einbuergerung.de/einb._kurz.html], 15.04.2002
2Grawert, R., Staat und Staatsangehörigkeit, Berlin 1973, S. 21
3Dahm, G., Völkerrecht, Bd. 1, Stuttgart 1958, S. 76ff. Makarov, A.N.: Allgemeine Lehren…, 2. Aufl., Stuttgart 1962, S. 5
4Veiter, T., Nation als Rechtsbegriffe…in: Blumenwitz/Meissner (Hrsg.), Staatliche und nationale Einheit Deutschlands - ihr Effektivität, Köln, 1984, S. 107
5Lichter, M., Der Staatsangehörigkeitsbegriff im Wandel der Zeit, Staats- und Kommunalverband 1956, S.26 f
6Vgl. Beck, M., zitiert nach[ http://www.einbuergerung.de/einb_kurz.html], 15.04.2002
7Beck, M.,[http://www.einbuergerung.de/einb_kurz.html], 15.04.2002
8Vgl. Die Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen (Hrsg.), 2. überarbeitete Auflage, Januar 2000, S.20
9Art. 116 GG
10Schröder, S., „Ich bin Deutscher“. Was heißt das?, in: Die Zeit, Nr.4, 22.01.1993, S.36
11Schröder, S., Renaissance des Nationalen, in :Die politische Meinung, 37/3,1992, S. 90-95
12Vgl. Die Beauftragte der Bundesregierung für Ausänderfragen (Hrsg.), Wie werde ich Deutscher?, 2.überarbeitete Auflage, Januar 2000, Seite 9 ff
13Vgl. Die Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen(Hrsg.), Wie werde ich Deutscher?, 2. überarbeitete Auflage, Januar 2000, S.17
14Vgl. Hagedorn, H., „Wer darf Mitglied werden?“, Opladen 2001, S. 31
15Vgl. Die Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen (Hrsg.), 2. überarbeitete Auflage, Januar 2000, S.40
16Vgl. Die Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen (Hrsg.), 2. überarbeitete Auflage, Januar 2000, S.43
17Telefoninterview mit Frau Kindling, U., Stadtverwaltung Moers, Ausländerbeauftragte, 13.05.2002
18Vgl.Renner, A.,, Was ist neu am neuen Staatsangehörigkeitsrecht?“, in: Zeitung für Ausländerrecht? (ZAR), 4/99, S. 160
19Vgl.Renner, A.,, Was ist neu am neuen Staatsangehörigkeitsrecht“?, in: Zeitung für Ausländerrecht? (ZAR), 4/99, S. 160ff
20Vgl. Dazu allg. m.w.N. über einige Fallgruppen, Hailbronner/Renner (Fn.7.), RuStAG Rn. 111 f.:, BVerwG, EZAR 600 Nr. 8 = InfAuslR 1989, S.276
21Vgl.[http://www.bundesauslaenderbeauftrage.de/themen/staats.stm], 15.04.2002
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau zum Thema Staatsangehörigkeit, Einbürgerung und Mehrstaatigkeit in Deutschland. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Liste der Abbildungen und Abkürzungen, eine Einleitung, detaillierte Erläuterungen zu den verschiedenen Aspekten des Staatsangehörigkeitsrechts, ein Glossar und ein Literaturverzeichnis. Es dient dem besseren Verständnis des Einbürgerungsverfahrens und der rechtlichen Grundlagen.
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis gibt einen Überblick über die Struktur des Dokuments und listet die Hauptkapitel und Unterpunkte auf, darunter die Einleitung, die Funktion der Staatsangehörigkeit, die Bestimmung der Begrifflichkeiten (Ausländer, Deutsche, Deutschstämmige), den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit (durch Geburt und Einbürgerung), den Verlust der Staatsangehörigkeit, Mehrstaatigkeit, gesetzliche Änderungen im Bereich der Mehrstaatigkeit und ein Fazit.
Welche Begrifflichkeiten werden im Dokument definiert?
Das Dokument definiert die zentralen Begriffe Ausländer, Deutsche, Deutschstämmige und deutsche Staatsbürgerschaft. Es erläutert die rechtliche Bedeutung dieser Begriffe und geht auf die soziale Wahrnehmung von Ausländern ein.
Wie erwirbt man die deutsche Staatsangehörigkeit?
Die deutsche Staatsangehörigkeit kann durch Geburt (Abstammungsprinzip und Geburtsrecht) oder durch Einbürgerung erworben werden. Das Dokument erläutert die jeweiligen Voraussetzungen und Verfahren.
Was ist das Abstammungsprinzip?
Das Abstammungsprinzip besagt, dass ein Kind durch die Staatsangehörigkeit seiner Eltern Deutscher wird. Wenn mindestens ein Elternteil deutscher Staatsbürger ist, erhält das Kind automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit.
Was ist das Geburtsrecht?
Das Geburtsrecht, das in Deutschland seit dem 1. Januar 2000 gilt, besagt, dass ein Kind, das in Deutschland geboren wird, unter bestimmten Voraussetzungen automatisch Deutscher wird, auch wenn seine Eltern Ausländer sind. Voraussetzung ist, dass sich mindestens ein Elternteil seit acht Jahren dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland aufhält und eine Aufenthaltsberechtigung oder seit mindestens drei Jahren eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt.
Was ist das Optionsmodell?
Das Optionsmodell betrifft Kinder, die aufgrund des Geburtsrechts und der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern mehrere Staatsangehörigkeiten besitzen. Diese Kinder müssen sich bis zum 23. Lebensjahr entscheiden, welche Staatsangehörigkeit sie behalten möchten. Wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit behalten wollen, müssen sie in der Regel nachweisen, dass sie die andere Staatsangehörigkeit aufgegeben haben.
Was sind die Voraussetzungen für die Einbürgerung?
Die wesentlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung sind: acht Jahre rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland, Sicherung des Lebensunterhalts ohne Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe, ausreichende Deutschkenntnisse, keine Verurteilung wegen einer Straftat und Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes.
Welche Sonderregelungen gelten für Ehegatten von Deutschen?
Ehegatten von Deutschen haben unter bestimmten Voraussetzungen einen Regelanspruch auf Einbürgerung. Die Voraussetzungen sind erleichtert im Vergleich zu anderen Ausländern.
Wie verliert man die deutsche Staatsangehörigkeit?
Die deutsche Staatsangehörigkeit kann unter anderem durch den freiwilligen Eintritt in fremde Streitkräfte, den Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit auf Antrag im Inland oder durch die Aufgabe der deutschen Staatsangehörigkeit verloren gehen.
Was bedeutet Mehrstaatigkeit?
Mehrstaatigkeit bedeutet, dass eine Person mehr als eine Staatsangehörigkeit besitzt. Das deutsche Recht versucht, Mehrstaatigkeit weitgehend zu vermeiden, es gibt jedoch Ausnahmen.
Welche Ausnahmen gibt es bei der Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit bei der Einbürgerung?
Ausnahmen von der Pflicht zur Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit gelten unter anderem für ältere Personen, anerkannte Flüchtlinge und bei unzumutbaren Bedingungen oder erheblichen Nachteilen wirtschaftlicher oder vermögensrechtlicher Art.
Welche gesetzlichen Änderungen gab es im Bereich der Mehrstaatigkeit?
Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts hat die Regelungen zur Mehrstaatigkeit verändert. Künftig soll der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit unabhängig davon eintreten, ob eine andere Staatsangehörigkeit im Inland oder Ausland erworben wurde.
Was sind die Kosten für die Einbürgerung?
Die Kosten für die Einbürgerung betragen grundsätzlich 255 Euro pro Person. Für minderjährige Kinder ohne eigenes Einkommen, die mit ihren Eltern zusammen eingebürgert werden, sind 55 Euro zu bezahlen.
Wo finde ich weitere Informationen zur Einbürgerung?
Weitere Informationen finden sich in den genannten Gesetzen und Verordnungen sowie bei den zuständigen Behörden und Ausländerbeauftragten.
- Quote paper
- Peter Cornelius (Author), Bayram Bas (Author), 2002, Einbürgerung/Staatsangehörigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/107123