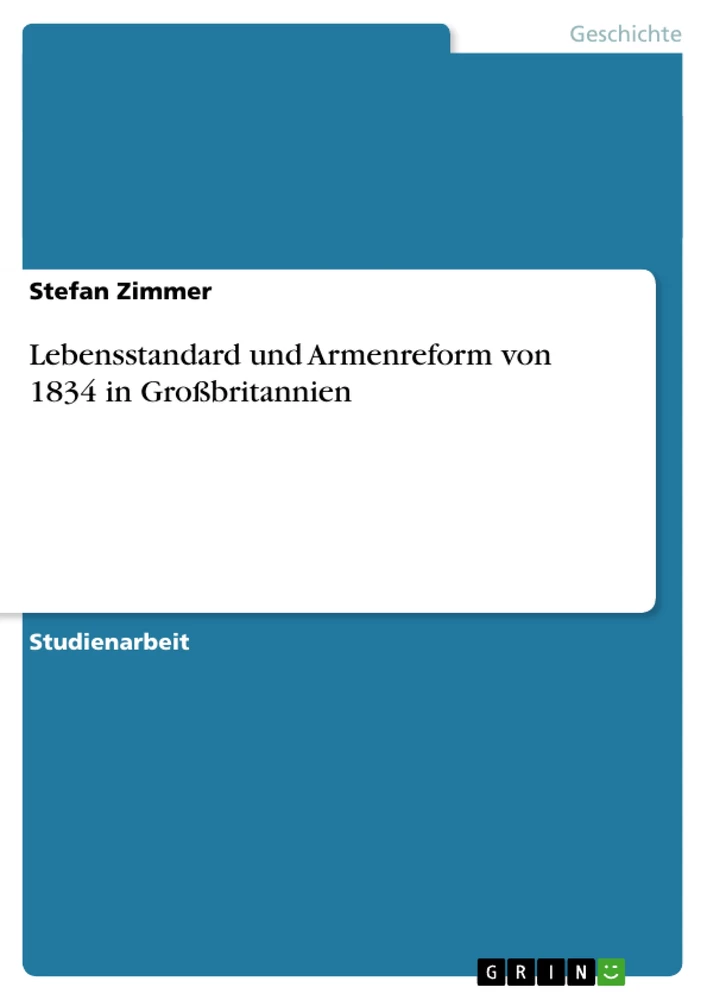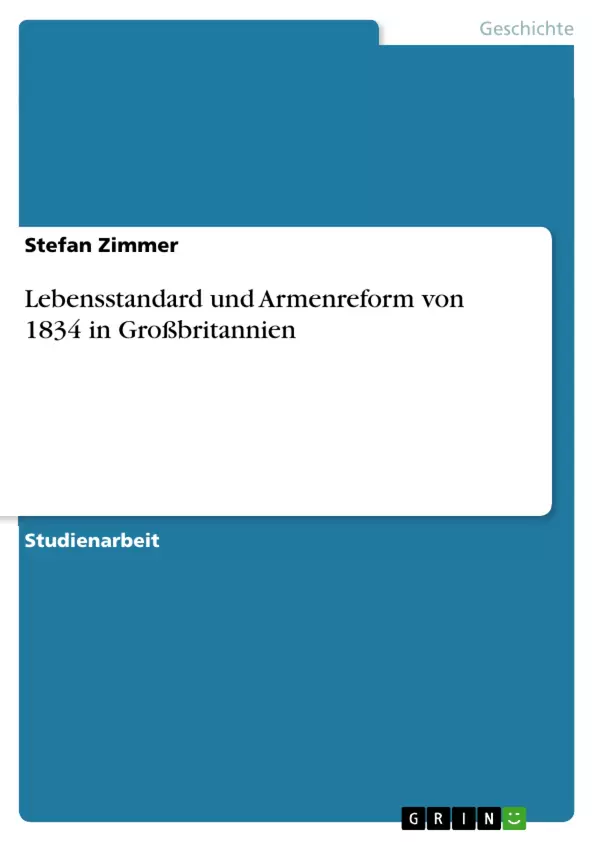Stellen Sie sich eine Zeit vor, in der Fabrikschlote den Himmel verdunkelten und das Schicksal ganzer Bevölkerungsschichten am seidenen Faden der industriellen Revolution hing. Diese tiefgründige Analyse nimmt Sie mit auf eine erschütternde Reise in das Herz des Nordens von England zwischen 1802 und 1850, einer Epoche des Umbruchs, in der das Leben der Arbeiterklasse von Armut, Ausbeutung und der ständigen Suche nach einem besseren Auskommen geprägt war. Im Zentrum steht die Frage, wie sich die berüchtigte Armenrechtsreform von 1834 auf das Leben der Hilfsbedürftigen auswirkte. War sie ein notwendiges Übel oder ein Schlag ins Gesicht der Ärmsten? Die Arbeit beleuchtet die Lebensbedingungen der Arbeiter, Arbeitslosen und Arbeitsunfähigen in den schnell wachsenden Industriestädten und auf dem Land, wobei der Fokus auf der Entwicklung des Lebensstandards, der Reallöhne, der Ernährung und der Wohnverhältnisse liegt. Detaillierte Statistiken und zeitgenössische Berichte werden verwendet, um ein facettenreiches Bild der damaligen Realität zu zeichnen. Die Untersuchung geht der Ideologie der Reformer auf den Grund, analysiert die Prinzipien der "geringeren Wählbarkeit" und des "Arbeitshaustests" und zeigt auf, wie diese in der Praxis umgesetzt wurden. War die Reform ein wirksames Mittel zur Armutsbekämpfung oder diente sie lediglich dazu, die Kosten für die Armenversorgung zu senken und die Arbeiterklasse zu disziplinieren? Die Auswirkungen der Reform auf die Armut, die Arbeitsbedingungen und die soziale Ungleichheit werden kritisch bewertet. Es wird untersucht, inwiefern die lokalen Gegebenheiten im industrialisierten Norden die Umsetzung des Gesetzes behinderten und welche Kompromisse eingegangen werden mussten. Abschließend wird ein differenziertes Fazit gezogen, das die komplexen Zusammenhänge zwischen Wirtschaftswachstum, Armut und Sozialpolitik beleuchtet. Diese Arbeit ist ein Muss für alle, die sich für Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, die industrielle Revolution und die Geschichte der Armenfürsorge interessieren und bietet wertvolle Einblicke in eine Zeit des Wandels und der sozialen Ungleichheit. Untersuchen Sie die komplexen Auswirkungen des Armengesetzes von 1834 und entdecken Sie, wie es das Leben der unteren Bevölkerungsschichten im Norden Englands während der industriellen Revolution veränderte.
Gliederung
I. Einleitung
II. Der Lebensstandard der unteren Bevölkerungsschichten im Norden Englands während der industriellen Revolution.
II. A) Statistiken über den Lebensstandard von 1802 - 1850.
II. B) Darstellung der Lage der Armen.
III. Das reformierte Armengesetz von 1834 als Kampf gegen die Armut.
III. A) Die Ideologie der Reformer und das Armengesetz von 1834.
III. B) Umsetzung der Reform und deren Auswirkungen
IV. Ausblick
V. Anhang
V. A) Literaturverzeichnis
V. B) Quellenverzeichnis
V. C) Tabellen 1 - 8
I. Einleitung
Das zentrale Thema dieser Arbeit bewegt sich um die Frage, wie sich das reformierte Armenrecht von 1834 auf die Situation der Hilfsbedürftigen und ungelernten, unterbeschäftigten Arbeiter auswirkte. Damit sind zwei wichtige Debatten der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Industriellen Revolution in England angeschnitten, welche beide sowohl unter den Zeitgenossen, als auch unter späteren Historikern, viele Kontroversen hervorriefen.
Hierbei handelt es sich zum einen um die Diskussion des Lebensstandards der britischen Bevölkerung während des betrachteten Zeitraums, zum anderen um die Debatte der Reform des Armenrechts 1834. Beide Kontroversen sind auch deshalb sehr interessant, da sie unmittelbar mit dem Widerstreit der beiden großen Ideologien des 19. Und 20. Jahrhunderts verbunden sind. So werden die Ergebnisse jeder Forschungsarbeit zu diesen Themen auch von der ideologischen Stellung des Verfassers mit beeinflusst. Eine Antwort auf die erste Debatte kann sowohl das neoliberale Weltbild des Kapitalismus bestätigen, welches den Wohlstand der Bevölkerung durch die Einführung der Industrie, der Lohnarbeit und des freien Weltmarktes vermehrt sieht. Ebenso kann es aber die sozialistische Aussage von der Ausbeutung der Arbeiterschaft untermauern, deren Lebensbedingungen sich im Gegensatz zur Bourgeousie ständig verschlechtert hätten.
Ähnlich war v.a. die zeitgenössische Diskussion um das Problem der Armen und seiner Lösung durch das neue Armenrecht von 1834 gespalten.
Klassische Liberale Theoretiker betonten das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit, der Möglichkeit durch eigene Anstrengungen seine Lage zu verbessern, und des moralischen Verfalls, als Ursache der Armut. Vertreter der entstehenden Arbeiterbewegungen betonten hingegen die Unmöglichkeit, die eigene Lage durch Arbeit zu verbessern, und verorteten die Ursache des Pauperismus nicht in der moralischen Verfassung der Arbeiterschaft, sondern in den extrem niedrigen Löhnen.
Ich möchte nun versuchen ein differenziertes Bild der wissenschaftlichen Forschung zu diesen beiden Themenkomplexen zu entwerfen, und eine Antwort auf die anfangs gestellte Frage zu entwickeln. Die Erwartungen dürfen allerdings nicht zu hoch gesteckt werden, da die statistische Datenlage zu den Lebensbedingungen der vom Armenrecht Betroffenen1 sehr eingeschränkt ist. Auch hat sich der Lebensstandard für verschiedene Bevölkerungsgruppen, in unterschiedlichen Regionen und zwischen Stadt und Land sehr unterschiedlich, ja teilweise gegensätzlich entwickelt. So daß generalisierte Aussagen für ganz Groß Britannien sehr vage bleiben, oder auf kleinere Subgruppen beschränkt werden müssen. Je kleiner jedoch der eingegrenzte geographische und gesellschaftliche Raum wird, desto dürftiger wird das hierfür erhältliche Datenmaterial.
Ich werde daher einen Mittelweg versuchen, und mich auf den Norden Englands beziehen, da sich hier vor allem die neue Industrie entwickelte. Eine Unterscheidung zwischen Stadt und Land ist auch hier noch wichtig, ich möchte mich aber nicht auf eine Siedlungsart beschränken, um noch ausreichend Datenmaterial verwenden zu können.
II. Der Lebensstandard der unteren Bevölkerungsschichten im Norden Englands, während der industriellen Revolution
Die Entwicklung des Lebensstandards der britischen Bevölkerung während der industriellen Revolution versuchten bereits zeitgenössische Beobachter und ersten Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler zu beschreiben. Seit dieser Epoche und das ganze 20. Jahrhundert hindurch widmeten viele Forscher ihre Aufmerksamkeit diesem Themenkomplex. Es wurde versucht anhand verschiedenster Indikatoren, welche den Lebensstandard und die Lebensqualität messen, diese Entwicklung möglichst genau nachzuzeichnen. Daran zeigt sich jedoch bereits das erste Problem, der Bestimmung der den Lebensstandard bedingenden, und messbaren Faktoren.
Die meisten Arbeiten beziehen sich auf den Reallohn, der aus dem eigentlichen Geldlohn und den Lebenshaltungskosten errechnet wird2. Der Reallohn wird als der zentrale Faktor für den Lebensstandard gesehen, da das tatsächlich verfügbare Geld auch die meisten anderen Faktoren, wie die Gesundheit, die Wohnverhältnisse, die Nahrungsqualität oder den Bildungsstand bedingt3. Auf diesem Feld begegnet man aber dem Problem der unvollständigen Daten, welche auch noch für jede Region und Berufsgruppe unterschiedlich ausfallen und in erster Linie für die gelernten, besser gestellten Arbeiter vorhanden sind. Andere Arbeiten versuchen daher über makroökonomische Daten die Konsumausgaben pro Kopf der Bevölkerung zu errechnen, um so einen Indikator für den durchschnittlichen Lebensstandard der Bevölkerung zu erhalten4. Dieses Material besagt aber nichts über bestimmte Gruppen aus, und kann nur ein allgemeines Bild vermitteln. Neuere Arbeiten versuchen über den etwas kuriosen Faktor der Körpergröße Aufschluß über den Lebensstandard zu gewinnen. Hier wird zugrunde gelegt, daß vor allem während der Kindheit, die Quantität und Qualität der Nahrung, die Arbeits- und sonstigen Umweltbedingungen starken Einfluß auf das Wachstum des jungen Menschen haben. Da aber hier nur Daten von Rekruten und verurteilten Kriminellen vorliegen, beschränkt sich die Aussage hier auch wieder auf bestimmte Bevölkerungsgruppen5. Das Ausmaß der Armut läßt sich am besten durch die Zahlen der Pauper, welche Unterstützung erhielten und von den lokalen Armenbehörden aufgezeichnet wurden, abbilden.
Insgesamt zeigt sich aber, daß vor allem aufgrund der bruchstückhaften Datenlage, eine befriedigende und empirisch gesicherte Aussage kaum möglich ist. Da Statistische Aufzeichnungen sozialer Merkmale erst in dem betreffenden Zeitraum begannen, und daher die Methoden der Datenerhebung noch nicht weit entwickelt waren, enthalten viele Daten auch Fehler und Ungenauigkeiten. Nichtsdestotrotz werde ich im Folgenden versuchen, zuerst das gesichtete Datenmaterial vorzustellen, zu diskutieren und daraus zu mindestens ein ungefähres Bild der Lebensverhältnisse der armen Arbeiter, Arbeitslosen und Arbeitsunfähigen im Norden Englands zu skizzieren.
Vorerst ist es aber notwendig den zu beobachtenden Zeitraum einzugrenzen, da bereits hier das Ergebnis stark beeinflußt werden kann, wie unter anderem M. Flinn festgestellt hat6. Da sich diese Arbeit auf die Auswirkungen der Armenrechtsreform von 1834 konzentriert, ist es notwendig die Lage der betreffenden Bevölkerungsschichten in einem angemessenen Zeitraum sowohl vor, als auch nach der Reform zu betrachten. Ich werde daher versuchen eine langfristige Entwicklung um dieses Jahr darzustellen, welche allerdings von kurzfristigen Trends wie Wirtschaftsrezessionen, Preisanstiegen und Arbeitslosigkeit verfälscht werden kann.
Der Beginn der Industriellen Revolution in England wird in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte teilweise etwas willkürlich an verschiedenen Jahreszahlen zwischen der Mitte des 18. Jh. und dem Jahrhundertwechsel festgelegt7. Da es mir aber nicht um genau diese Phase der Industrialisierung geht, und ich den Einfluß kurzfristiger Entwicklungen vermeiden möchte, werde ich als Anfangspunkt das Jahr 1802 nehmen. Hier ist ein kurzfristiger Preisanstieg um die Jahrhundertwende gerade vorüber, und die Wirtschaftsentwicklung hat sich wieder in einen langfristigen Trend eingefügt. Diese Phase vor der neuen Armengesetzgebung war von dem `Take off´ der britischen Industrialisierung gekennzeichnet, in der sich die traditionelle Agrarwirtschaft zur neuen Industriewirtschaft transformierte, und welche auch als die Zeit des Pauperismus bezeichnet wird.
Um nun die direkten Auswirkungen der neuen Armenverwaltung zu untersuchen, sollte die Phase nach dem Jahre 1834 eine genügend große Spanne umfassen, um eine allgemeine Entwicklung, unabhängig von kurzfristigen Krisenzeiten, erkennen zu können. Da die neue Armenverwaltung 1847 abermals reformiert wurde, und sich ab den 1850´er Jahren auch ein allgemeiner Aufschwung in den Reallöhnen der Arbeiterschaft abzeichnete, möchte ich den Zeitraum nicht in diese zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ausweiten. Zwischen den konjunkturellen Krisen von 1847/48 und 1857/58 bilden die Jahre um 1850 einen geeigneten Endpunkt der zu beobachtenden Zeitspanne. Ich werde aber die weitere Entwicklung über diese Jahre hinaus zu mindestens am Rande berücksichtigen, um auch längerfristige Prozesse nicht aus den Augen zu verlieren.
II. A) Statistiken über den Lebensstandard von 1802 - 1850
Bei der Vorstellung des gesichteten Datenmaterials möchte ich nun dessen Fehlerquellen aufzeigen, und die Aussagekraft dieser Statistiken für das Thema dieser Arbeit beurteilen. Zunächst sind hier die verschiedenen Statistiken über die Lohn- und Preisentwicklung, anhand derer der Reallohn errechnet wird, zu nennen.
Für die Preisentwicklung zwischen 1800 und 1850 wurden von A. Silberling, R. Tucker, E. Gilboy, E. Schumpeter, A. Gayer, W. Rostow, A. Schwartz und P. Rousseaux Indexes erzeugt auf welche sich die meisten nachfolgenden Forscher berufen8. Alle Autoren rechtfertigen ihren Index aufgrund von Kritik der übrigen, wobei jedoch keiner der Forscher einen empirisch idealen Index erstellte. Nach Flinn sollte ein solcher Index mehrere Faktoren berücksichtigen, daß heißt er sollte auf Einzelhandelspreisen beruhen, alle Konsumgüter beinhalten, die von einem Großteil der Arbeiterschaft konsumiert wurden, oder besser noch nach verschiedenen Berufsgruppen differenzieren, korrekt gewichtet sein, bezogen auf den Anteil der einzelnen Produkte am gesamten Konsum einer durchschnittlichen Arbeiterfamilie, und die Mieten enthalten9.
Jürgen Kuczynski verwendete den Index von Tucker und kommt zu dem Ergebnis, daß die Lebenshaltungskosten von 1802 bis 1813 um 44% anstiegen, und dann bis 1850 auf 20% unter den Wert von 1802 fallen (siehe Tabelle 1A). Lindert und Williamson errechneten aufgrund neuerer Daten und einer genaueren Gewichtungsmethode (siehe Tabelle 1B) einen weiteren Lebenskostenindex. Dieser deutet auf eine ähnliche Entwicklung hin, da mir deren Daten aber nur für die Jahre 1781 und 1819 vorliegen, ist ein direkter Vergleich unzulässig. Aus Tabelle 2 läßt sich immerhin erkennen, daß hier der Preisanstieg bis 1819 und auch die Abnahme danach wesentlich stärker ausfallen. N. Crafts hat diesen Index überarbeitet, und kommt wieder zu einer moderateren Preisschwankung (siehe Tabelle 2). Im Vergleich zu Kuczynski fallen die Lebenskosten hier von 1820 bis 1830 weniger, dafür aber bis 1850 wesentlich stärker ab. Im gesamten Verlauf kommt dieser Index dem von Kucynski jedoch sehr nahe.
Der Lohn in konkreten Währungseinheiten variiert, wie oben bereits angemerkt, sowohl zwischen den verschiedenen Regionen, als auch zwischen den einzelnen Berufsgruppen in den unterschiedlichen Branchen. Die Entwicklung der untersten Arbeiterschichten und Armen wird oft mit einzelnen Berufsgruppen assoziiert. So nehmen Lindert und Williamson die Landarbeiter für die Repräsentation der untersten 40% aller Arbeiter10, Kuczynski verweist auf die Löhne der Baumwollindustrie, „die immer niedrigere Löhne bis zum Ende der industriellen Revolution zahlte“11, und im allgemeinen werden die Löhne der ungelernten Arbeiter als die niedrigsten angesehen.
Die Lohnserien von Jürgen Kuczynski beziehen sich auf Arbeiter der Baumwollindustrie, der Landwirtschaft und auf alle Arbeiter. Er hat die Daten wiederum von Bowley und Wood, Gilboy und Tucker übernommen, merkt jedoch an, daß sich diese Lohndaten in erster Linie auf männliche, gelernte Arbeiter beziehen12. In der sich industrialisierenden Baumwollindustrie fallen die Löhne von 1802 bis 1818 um 48,7%, bezogen auf 1802, bleiben dann bis 1825 auf diesem Niveau, fallen bis 1832 nur noch um weitere 7,5% und steigen dann bis 1850 wieder auf 50,3% des Anfangswertes. In der Landwirtschaft steigen die Löhne im Gegensatz dazu erst einmal von 1802 bis 1807 um 18,3% an, und beginnen erst in den Krisenjahren um 1813 wieder zu fallen. 1823 betragen sie nur noch 86,5% des Lohnes von 1802, verharren auf diesem Niveau bis 1832 und steigen erst bis 1850 wieder auf 96% des ersten Jahres (siehe Tabelle 3).
N. Crafts stellt eine Lohnserie für ungelernte Nicht-Landarbeiter von Lindert und Williamson vor, welche auch gelernte Baumwollarbeiter enthalten und von ihnen als Mittelgruppe bezeichnet wird. Wie bereits bei den Preisindexes sind diese Daten aber auf wenige, zufällige Jahre beschränkt. Es läßt sich allerdings ein Trend von stark anwachsenden Löhnen dieser Gruppe vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1819 erkennen. Bis zum Ende unserer Periode veränderten sich diese Löhne jedoch kaum. Ähnlich sieht die Lohnserie von Landarbeitern im Norden Englands aus, welche Crafts aus Bowleys umfangreicher Sammlung entnommen hat. Hier steigen die Löhne bis 1824 etwas langsamer an, nehmen aber dann bis 1851 noch um 5,8% zu (siehe Tabelle 4). Der Unterschied in den langfristigen Trends zwischen Kuczynskis und Crafts Lohnserien ist aufgrund der unterschiedlicher Berufsgruppen, Regionen und Jahreszahlen als Datenbasis zu erklären, wird von Craft aber auch durch eine bessere Datenbasis gerechtfertigt13. M. Flinn stellt Lohnlisten verschiedener Forscher, auf unterschiedliche Berufsgruppen bezogen, gegenüber, und stellt bis zu der Zeitspanne 1820/24 gleich verlaufende Trends fest. So verzeichnen fast alle Arbeiten ein Anstieg der Löhne zwischen 14,9% und 98,2% vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1810/14. Kuczynskis Baumwollarbeiter scheinen daher eine Ausnahme darzustellen. Bis 1820/24 fallen die Löhne zwischen 3,5% und 34,1%, mit Ausnahme einer Liste Bowleys, und im Gegensatz zu den von Crafts verwendeten Daten. In der letzten Phase bis 1850 läßt sich allerdings kein allgemeiner Trend mehr ausmachen14.
Aus den bis hier vorgestellten Daten lassen sich nun Reallöhne errechnen, welche ein erstes Bild der Lebensverhältnisse der betroffenen Schichten vermitteln können. Kuczynski gibt nur einen Reallohnindex für alle Arbeitergruppen an, welcher aufgrund der steigenden Konsumgüterpreise bis zur Krise 1811/13 um 26,4% fällt, danach aber bis 1850 kontinuierlich ansteigt. Nur von den kurzfristigen Preissteigerungen während der Krisen Anfang und Ende der 20´er Jahre unterbrochen, wächst der Reallohn hier auf ein Niveau von 110%, bezogen auf den Wert von 1802 (siehe Tabelle 5). Aufgrund der Unterschiede in der Geldlohnentwicklung kommt Crafts nun auch hier zu einem neuen, abweichenden Ergebnis. Die Reallöhne steigen bei ihm sowohl für die zwei Subgruppen, als auch für alle Arbeiter seit 1780 bis 1850 kontinuierlich an. Für die Gruppe der ungelernten Nicht- Landarbeiter wird hier eine Erhöhung von 1780 bis 1819 von 17,8% errechnet, und für die Landarbeiter im Norden beläuft sich der Zuwachs bis 1824 sogar auf 60,7%. Selbst wenn die Wirkung der Krisenjahre um 1813 hier ausgeschaltet wird, kommt Crafts mit den Ergebnissen von Lindert und Williamson zu einer wesentlich optimistischeren Aussage, da der Zuwachs in den Reallöhnen bei ihm auch nach dieser Krise wesentlich stärker ausfällt (siehe Tabelle 6).
Wie unter anderem auch Flinn festgestellt hat, gab es die gravierendsten Veränderungen in den Reallöhnen in Zeiten starker Preisschwankungen. Auch gab es aufgrund der großen Unterschiede in den Löhnen zwischen einzelnen Branchen, Regionen und Ausbildungsgraden sicherlich während des gesamten Zeitraumes sowohl Reallohngewinner, als auch Verlierer. Es ist in jedem Falle wichtig darauf hinzuweisen, daß die Reallöhne nicht dem tatsächlichen Einkommen der Arbeiterhaushalte entsprechen, da langfristige Beschäftigung eher die Ausnahme bildeten und Unterbeschäftigung, vor allem in Krisenzeiten, in vielen Branchen verbreitet war15.
Um ein Bild, unabhängig von der Branche und Erwerbsunterbrechungen zu bekommen, hat Stephen Nicholas mit Paul Johnson die Körpergrößen von verurteilten Kleinkriminellen verwendet. Wie oben bereits erwähnt, sehen sie dieses Merkmal als geeigneten Indikator für den Lebensstandard, da sich die Lebensbedingungen auf das Körperwachstum auswirken würden. Ihr Sample ist hinsichtlich des Alters, der Berufe und Regionen zumindest für die untere Hälfte der Arbeiterschaft in England repräsentativ, und bildet daher für unser Thema eine interessante Aussage16. Sie kommen im Gegensatz zu den steigenden Reallöhnen im gesamten Zeitraum zu dem Ergebnis, daß die Lebensbedingungen der unteren Arbeiterschichten nach 1820, vor allem nach 1839, bis 1850 schlechter wurden. So wurden Männer und Frauen, welche nach 1820 geboren wurden, in Städten wohnten oder in der Industrie arbeiteten signifikant kleiner als vergleichbare Gruppen. Die stärkere Abnahme bei den Frauen erklären sie mit einer wachsenden Ungleichbehandlung, innerhalb der Familien, während dieser Zeit. In einer Untersuchung der besonderen Bedingungen der Frauen kommen Nicholas und Oxley anhand von Daten der Körpergröße und Alphabetisierungsrate auch zu diesem Ergebnis. Die sich wandelnden Bedingungen des Broterwerbs durch Lohnarbeit, der Fabrikarbeit und urbanen Siedlungsweise haben vor allem die Frauen zunehmend benachteiligt, was sowohl die Nahrungsverteilung, als auch Ausbildungschancen oder Erwerbsmöglichkeiten betrifft17. Eine stärkere Selbst - Selektion durch die harten Arbeitsbedingungen bei den ungelernten Arbeitern deuten Nicholas und Johnson aus der insgesamt höheren Körpergröße dieser Gruppe im Vergleich zu den gelernten Arbeitern18.
Nun soll das statistische Bild noch um einige Daten der Armut in unserem Zeitraum und den Jahrzehnten danach ergänzt werden. Eine Statistik über das Ausmaß der durch Armenhilfe unterstützten Pauper zeigt, daß von 1834 bis 1850 die Zahl der Pauper um fast 20% zurück ging, obwohl die Bevölkerung weiter wuchs. Auch danach sank die Zahl der Armen bis 1860 um weitere 13% der Pauper von 1834. Bis 1870 gab es allerdings wieder einen Anstieg sowohl der Unterstützten insgesamt, als auch der Arbeitshausinsassen19 auf knapp über das Niveau von 1850. Danach fügte sich die Entwicklung aber wieder in den langfristigen Trend der Abnahme der Bitten um Hilfe, so daß 1880 nur noch 3,2% der Bevölkerung Englands und Wales, gegenüber 8,8% zur Zeit der Armenrechtsreform, Unterstützung erhielten (siehe Tabelle 7). Die Verteilung der Armen veränderte sich nach unserer Periode auch von einem Anteil der Arbeitshausbewohner an allen Armen von 12 % 1850, zu 22% 1880. Also blieben die Armen in den Arbeitshäusern auch nach unserem Zeitraum eher die Ausnahme (siehe Tabelle 8).
Im folgenden Abschnitt soll aufgrund der hier dargestellten Daten, und durch Ergänzung zeitgenössischer Quellen und Beschreibungen aus der Sekundärliteratur die Entwicklung der Armut und der Lebensbedingungen vor und nach der Reform dargestellt werden.
II. B) Darstellung der Lage der Armen
Ein generalisiertes Bild der Lage der unteren Bevölkerungsschichten im industriellen Norden Englands zu entwerfen ist aufgrund der bruchstückhaften Datenlage kaum möglich. In jeder Region oder Branche hat es wohl zu jeder Zeit sowohl Gewinner als auch Verlierer gegeben. Trotzdem werde ich nun versuchen allgemeine Trends in den verschiedenen Abschnitten der hier gewählten Periode zusammenzufassen, und deren Ursachen und Hintergründe zu beleuchten. Von 1802 bis zur Krise 1812/13 am Ende der Napoleonischen Kriege wurde das Leben insgesamt zunächst teurer, da aufgrund kriegsbedingter Güterknappheit die Preise für Lebensmittel enorm anstiegen. „Wheat rose from 43 shillings a quarter in 1792, the year before the war broke out, to 126 shillings in 1812, (...).The poor, both in town and country, suffered terribly from the price of bread,...“20.
Die Löhne sowohl der Landarbeiter, als auch der Handwerker und Industriearbeiter stiegen im gleichen Zeitraum auch an, was für viele Bevölkerungsgruppen zu einem Wachstum des Reallohnes in diesem Abschnitt führte. Diese Aussage muß jedoch relativiert werden, da zum einen auf die stark fallenden Löhne der Arbeiter in der Baumwollindustrie der Städte im Norden hinzuweisen ist, zum anderen auf die zum Teil gravierende Arbeitslosigkeit, welche die realen Lebensbedingungen in vielen Haushalten zu mindestens kurzfristig stark verschlechterte.
„Hoch war die Zahl der Arbeitslosen wieder in den Jahren 1797, 1803 und 1807/08. Daneben läuft das Absterben ganzer Hausindustrien, das besonders qualvoll auch gerade dadurch ist, daß so viele (...) meist unbeschäftigt dahinvegetieren. 1811 erreichte die Arbeitslosigkeit einen neuen Höhepunkt“21.
Diese erste Phase war außer von den Auswirkungen des kontinentalen Krieges aber auch von einem strukturellen Wandel der britischen Gesellschaft gekennzeichnet. Wie Karl Metz festgestellt hat, veränderte sich nicht nur die agrarische Subsistenzökonomie zu einer industriellen Konsumökonomie, sondern auch das Wertesystem, und damit die Handlungsmotivation der Menschen von reinem Erhaltungstrieb zur Befriedigung von Konsumbedürfnissen22. Dieser Wandel grundlegender gesellschaftlicher, wie ökonomischer Strukturen führte sicherlich für einige Arbeitergruppen zu einem besseren Lebensstandard, war aber für viele, besonders der schlechter gestellten Arbeiter, mit neuen Unsicherheiten und einem härteren Überlebenskampf verbunden.
In der nächsten Phase nach den Krisenjahren um 1813 bis Anfang der 30´er Jahre wurde das Leben durch die fallenden Preise wieder billiger, auch wenn der Mehlpreis durch die Kornzölle ab 1815 sicherlich eine Zeit lang noch relativ teuer blieb23. Die Löhne veränderten sich in dieser Phase weniger dramatisch, als während des Krieges, wie die oben vorgestellten Lohnserien belegen. Für viele Berufsgruppen fallen sie leicht ab, bleiben auf dem Niveau von 1813 oder steigen bei den Landarbeitern sogar noch ein wenig an. Daher kann man aufgrund dieser Daten davon ausgehen, daß der Reallohn nach dem Krieg für die meisten Berufsgruppen anstieg, was für viele Haushalte auch einen besseren Lebensstandard ermöglichte. Aber auch hier muß diese Aussage wenigstens für das erste Nachkriegsjahrzehnt relativiert werden, da die heimkehrenden Soldaten nach dem Krieg vielerorts für hohe Arbeitslosigkeit sorgten.
„Doch wurde die Not des Jahres 1811 noch bei weitem von der des Jahres 1816 übertroffen, als allein an 400.000 entlassene Soldaten und Matrosen den Arbeitsmarkt überschwemmten, während gleichzeitig der Übergang zur `Friedenswirtschaft´ in England (...) Stockungen in der Produktion hervorrief“24.
Diese Aussage wird auch von den Ergebnissen von Nicholas und Johnson unterstützt, welche ab 1820 eine leichte Verschärfung der Lebensbedingungen, vor allem für Frauen, feststellten. Es ist davon auszugehen, daß die hohe Arbeitslosigkeit dieser Zeit und während der ersten konjunkturell bedingten Krise von 1825/26, die Armen vermehrt in die neu wachsenden Städte trieb, wo sich die Wohnverhältnisse, die Qualität der Nahrung und die Arbeitsbedingungen der Fabriken eher negativ auf den Lebensstandard auswirkten.
Die Verbesserungen durch höhere Reallöhne blieben also, so ist anzunehmen, auf die besser bezahlten, gelernten Arbeiter, welche vor allem im Besitz einer Stelle waren, beschränkt. Auch wenn man von einem generellen Trend der wachsenden Reallöhne ausgeht, schlug dieser während der Krisen, vor allem für die ärmeren Arbeiter, immer wieder in eine Verschlimmerung der Lage um. Das zeigt sich auch in steigenden Ausgaben für die Armenhilfe, deren vorläufiger Höhepunkt auf das Jahr 1818 viel, danach aber auch wieder leicht zurückging25. Insgesamt blieben die Ausgaben für Armenhilfe aber während dieser Phase höher als vor dem Kriegsende26, was auch auf wachsende Ungleichheit innerhalb der Arbeiterschaft schließen läßt.
In den 30´er Jahren, als auch die Armenverwaltung reformiert wurde, setzte sich der Preisverfall fort, auch stiegen die Löhne der meisten Berufe weiter leicht an, was für die betreffenden Arbeitergruppen sicherlich zu einem fortgesetzten Wachstum der Reallöhne führte. Auch bei Nicholas und Johnson bleibt die Kurve der Körpergröße in diesem Jahrzehnt auf einem gleichbleibenden Niveau, und die der Frauen verzeichnet sogar einen leichten Anstieg27. Die Zahl der Unterstützungsempfänger ging ab 1834, dem Jahr der Armenrechtsreform, ebenfalls zurück, allerdings liegen hierzu für dieses Jahrzehnt keine genauen Angaben vor, daher kann diese Entwicklung auch auf die Reform zurückgeführt werden. Das Gebiet des North Riding von Yorkshire, nördlich der Industriestädte Manchester und Leeds, verzeichnete seit 1831 steigende Kosten der Armenhilfe, was eher auf eine Zunahme der Armut schließen läßt28. Im Vergleich zu den vorherigen Jahrzehnten scheint diese Phase aber generell bessere Lebensbedingungen gesehen zu haben, obwohl für viele Arbeiter selbst in dieser, von starken Krisen verschonten Periode, der Lohn nicht ausreichte um ihre Familie zu ernähren29.
Die 1840´er Jahre waren hingegen gleich von zwei starken Krisen gekennzeichnet. Erst 1842 und nach einer kurzen Erholung der Wirtschaft 1847/48, als die neu entstehende Eisenbahnindustrie eine schwere Depression erlitt. In der Baumwollindustrie des Nordens wo die Handweberei endgültig von der maschinellen Fertigung verdrängt wurde, gab es während dieser Jahre weitverbreitete Armut, so daß manche Historiker das Jahr 1842 als das der größten Armut und Arbeitslosigkeit des 19. Jahrhunderts beschreiben30. Die oben vorgestellten Daten sind für diese Periode dünn gesäht, sie deuten aber auf einen fortgesetzten Preisverfall, hauptsächlich steigende Löhne und daher auch auf insgesamt steigende Reallöhne bis zum Ende unseres Zeitraumes hin. Der Rückgang der Anzahl der Unterstützten läßt entweder auf eine tatsächlichen Verminderung der Armut schließen, oder auf die Wirkung des reformierten Armenhilfegesetzes. Die Annahme liegt jedoch nahe, daß diese Entwicklungen eher dem langfristigen Trend vom Anfang der 30´er bis zu den frühen 50´er Jahren entspricht. Die Statistik der Körpergröße verzeichnet in diesem Jahrzehnt auch die stärkste Verschlechterung der Lebensbedingungen, so daß davon auszugehen ist, daß die beiden schweren Krisen die langfristigen Verbesserungen überschattet hatten. Die ausführlichen und teilweise polemischen Schilderungen Friedrich Engels über Manchester, der England 1844 bereiste, deuten auch auf sehr schlechte Lebensbedingungen der unteren Bevölkerungsschichten hin:
„Jeder Arbeiter, auch der Beste, ist daher stets der Brotlosigkeit, das heißt dem Hungertode ausgesetzt und viele erliegen ihm; die Wohnungen der Arbeiter sind durchgehends (...) schlecht gebaut, (...) feucht und ungesund; die Einwohner sind auf kleinsten Raum beschränkt, (...) die innere Einrichtung der Wohnungen ist ärmlich in verschiedenen Abstufungen bis zum gänzlichen Mangel auch der nothwendigsten Möbel; die Kleidung der Arbeiter ist ebenfalls durchschnittlich kärglich und bei einer großen Menge zerlumpt; die Nahrung im Allgemeinen schlecht, oft ungenießbar, und in vielen Fällen wenigstens zeitweise in unzureichender Quantität,...“31.
Die Gründe für die weit verbreitete Armut während der hier betrachteten Jahre sind vielfältig. Als erstes sind hier die niedrigen Löhne zu nennen, die trotz extrem langer Arbeitszeiten, sechs Tage die Woche, für viele Familien nicht ausreichten, sich am Leben zu erhalten. Das führte in zunehmenden Maße dazu, daß sowohl die Mutter als auch die Kinder zusätzlich arbeiten mußten, und war einer der Gründe, weshalb viele Familien trotz aller eigenen Anstrengungen auf Armenunterstützung angewiesen waren32. Wie oben bereits mehrmals erwähnt, führten die ökonomischen Krisen zu weit verbreiteter Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit, was viele Arbeiter zumindest zeitweise in die Armut abgleiten ließ.
Die Armutsverhältnisse bedingten wiederum schlechte gesundheitliche Verhältnisse, was neben den häufigen Arbeitsunfällen oft zur Arbeitsunfähigkeit oder sogar dem Tod des Hauptverdieners einer Familie führte. Alleinerziehende Mütter oder Witwen mit Kindern hatten meist gar keine Chance, ohne Armenhilfe auszukommen. Armut im Alter aufgrund fehlender Fürsorge und sozialer Absicherungen war ebenfalls ein weitverbreitetes Phänomen dieser Zeit. In einer Übersicht von Charles Booth aus dem Jahre 1880 wird von 55% bis 68% aller armen Haushalte `Fragen der Beschäftigung und der Löhne´ als Ursache der Armut angegeben. Zwischen 19% und 27% nennen familiäre Gründe als Ursache. Diese Verteilung entspricht sicherlich nicht exakt der im gesamten Norden während der hier betrachteten Zeitspanne. Sie zeigt aber, und das trifft wohl auch für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zu, daß selbst verschuldete Armut durch Trunksucht, Kriminalität oder Faulheit die seltenen Ausnahmen bildeten.
Im dritten Kapitel dieser Arbeit soll nun die Ideologie der Armenrechtsreform von 1834, sowie die wichtigsten Veränderungen vorgestellt, und abschließend die Wirkung der neuen Hilfspraxis auf das Problem der Armut beurteilt werden.
III. Das reformierte Armengesetz von 1834 als Kampf gegen die Armut
Nachdem im vorherigen Kapitel der Lebensstandard, das Ausmaß der Armut und deren Entwicklung dargestellt wurden, soll nun hier auf die zeitgenössischen Lösungsversuche eingegangen werden. Zuerst möchte ich kurz die alte Armenhilfe vor 1834 beschreiben, und deren Probleme und Kritik beleuchten. Dann soll die Ideologie der Reformer und ihre Umsetzung in dem reformierten Armengesetz dargestellt werden, um anschließend dessen Wirkungen auf die oben dargestellte Lage zu beurteilen.
Die Unterstützungspraxis vor 1834 beruhte auf den Armengesetzen von 1597 und 1601, welche lediglich bestimmten, daß arbeitsfähige Arme zu Arbeit verholfen werden, und Nicht - arbeitsfähige unterstützt werden sollen. Die Zuständigkeit sowohl für das Eintreiben der Armensteuer, als auch für die Verwaltung und Ausführung der Armenhilfe fiel auf die einzelnen Gemeinden. Von diesen wurde aus dem Kreis der Steuerzahler ein Armenaufseher gewählt, welcher meist ehrenamtlich die Armenhilfe zu organisieren hatte33. Dadurch bedingt gab es in England zu dieser Zeit keine einheitliche Unterstützungspraxis, sondern jede Gemeinde setzte die beiden Prinzipien hinsichtlich ihrer speziellen Situation auf ihre eigene Art um34.
Weit verbreitet waren sogenannte `outdoor reliefs´, das waren Barbeträge oder Naturalien, welche an die Armen wöchentlich, monatlich oder einmalig ausgezahlt wurden, die Empfänger aber in ihren Behausungen wohnen bleiben konnten. Welche dieser Hilfen der Einzelne Antragsteller bekam, hing von seinem speziellen Fall ab, und wurde zwischen ihm und dem Aufseher ausgehandelt35. In den urbanen Industriezentren waren die Empfänger größtenteils arbeitsunfähige Menschen, wie Alte, Kranke und Witwen, oder Gelegenheitsarbeiter welche in Krisenzeiten als erstes von großer Armut betroffen wurden. In den noch ländlichen Gebieten waren unter den Empfängern aber oft auch voll beschäftigte Arbeiter, deren Lohn nicht ausreichte ihre Familie zu ernähren. In Speenhamland wurde daher 1795 ein System geschaffen, welches die `outdoor´- Armenhilfe der ländlichen Gebiete noch lange Zeit bestimmte, aber in erster Linie auf den Süden beschränkt blieb. Hier wurde den Familien deren Einkommen nicht ausreichte, abhängig von den aktuellen Lebenshaltungskosten, ein Zuschuß gewährt, der ihnen ein Leben am Existenzminimum sicherte36. Diese Art von regelmäßigen Zahlungen, welche von dem Lohn des Empfängers abhing war im Norden jedoch kaum verbreitet, und auf die Handweber beschränkt, deren Gewerbe auszusterben begann37. Arbeitende Arme bekamen im Norden allerdings oft Kindergeld, oder in zunehmenden Maße auch die Miete gezahlt38. So weit es ging wurden sie jedoch an örtliche Unternehmer vermittelt, diesen ausgeliehen oder für öffentliche Arbeiten, wie zum Beispiel Straßenbau, herangezogen.
Neben dieser `outdoor´- Hilfe gab es auch Unterstützung im Rahmen eines geordneten Arbeitshauses, in welchem die Armen nach Alter und Geschlecht aufgeteilt wurden. In der Regel mußten sie dort für ihre Unterstützung arbeiten, wurden teilweise mit Kleidung versorgt und bekamen regelmäßige, wenn auch karge Mahlzeiten. Kinder wurden aus diesen Arbeitshäusern häufig als Lehrlinge an Unternehmer vermittelt, und erhielten somit eine Chance der Armut zu entkommen während sie gleichzeitig billige Arbeitskräfte darstellten39. Aber wie bei der oben beschriebenen Praxis gab es auch bei der Leitung solcher Arbeitshäuser zwischen den einzelnen Gemeinden oft große Unterschiede, und viele Ortschaften in den ländlichen Gebieten des Nordens hatten überhaupt kein Arbeitshaus oder teilten sich eines mit Nachbargemeinden. Vor 1834 blieben solche Arbeitshäuser im Norden aber die Ausnahme, auch weil sie mit mehr Aufwand und Kosten verbunden waren40.
Neben diesen Formen der öffentlichen Armenversorgung wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts auch vermehrt private Wohlfahrtsgesellschaften und Stiftungen gegründet, welche billiges Essen, Heizmaterial und Kleidung anboten, aber auch Armenhäuser und Hospitäler organisierten41.
Vor dem Hintergrund der, während der ersten drei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, stark anwachsenden Kosten der Armenhilfe, allein zwischen 1801 und 1818 um 600%42, und den gravierenden Ausmaßen der Armut dieser Zeit geriet die alte Praxis jedoch zunehmend in die Kritik. Argumente gegen die Zahlungen an Arbeitsfähige außerhalb der Arbeitshäuser lieferten in erster Linie die Zustände in den ländlichen Gebieten des Südens. Dort entwickelte sich, bedingt durch die strukturelle Arbeitslosigkeit, die Praxis des Speenhamland-Systems zu einer permanenten Einrichtung. Der Arbeitskräfteüberschuß war dort derartig hoch, daß ganze Bevölkerungsgruppen dauerhaft in die Armenhilfe abglitten, und so auf ihre Gemeinde angewiesen waren.
„This practice was, doubtless, introduced at first as a means of employing the surplus labourers of a parish; but by an abuse, which is almost inevitable, it has been converted into a means of obliging the parish to pay for labour, which ought to have been hired and paid for by private persons“43.
Die Kritiker dieser Praxis argumentierten, daß die Arbeiter demotiviert werden würden, sich durch eigene Anstrengungen zu helfen, könnten sie sich auf die Fürsorge der Gemeinden verlassen. Ein Armenaufseher aus Bedford beschreibt die Auswirkungen des roundsmen Systems, einer an Arbeit gebundenen Armenhilfe wie folgt:
„Are those men, called roundsmen, considered as good labourers? - Quite otherwise; they became roundsmen, perhaps, in consequence of their not being so well liked as the other labourers; and by being employed as roundsmen, they become still worse“44.
Im Folgenden soll nun die Ideologie, die hinter den Reformen von 1834 steckt, kurz beleuchtet, und das neue Armengesetz mit seinen Veränderungen der bisherigen Praxis dargestellt werden.
III. A) Die Ideologie der Reformer und das Armengesetz von 1834
Um dem ungelösten Problem der steigenden Armut und der damit verbundenen Kosten für die Gesellschaft beizukommen wurde 1832 eine königliche Untersuchungskommission eingesetzt. Ihr standen Edwin Chadwick, Nassau Senior sowie die beiden Bischöfe John Sumner und Charles Blomfield vor45. Während Chadwick der Sekretär und auch Schüler des Utilitaristen Jeremy Benthams war, wurde Senior vor allem von dem politischen Ökonomen Thomas Malthus beeinflußt. Somit war die Kommission sehr stark von den, diese Zeit dominierenden, Philosophien des Utilitarismus und der politischen Ökonomie geprägt, welche in der Reform ihren gesetzgeberischen Ausdruck fanden46.
Benthams Grundgedanke war, daß menschliches Handeln durch eine rationale Nutzenrechnung motiviert werde, welche danach strebt für das Individuum den größtmöglichen Nutzen, verstanden als Vorteil, Lust, Glück usw., zu erzielen, bzw. Leid, Unglück oder Nachteil zu vermeiden47. Daraus ergaben sich mehrere Prinzipien für den Umgang mit den Armen, welche später auch Eingang in Chadwicks Überlegungen fanden. Erstens sollten die Armen im Arbeitshaus nach Kategorien aufgeteilt werden, damit jeder Art von Armut mit der ihr nützlichsten Behandlung begegnet werden konnte. Zweitens sollte der Unterhalt auf Kosten Anderer nicht attraktiver erscheinen als die Erhaltung durch eigene Anstrengungen, und daraus ergab sich drittens seine Forderung, daß die Armen im Armenhaus für ihre Unterstützung arbeiten sollten, soweit sie dazu in der Lage wären.
Chadwick übernahm diese Prinzipien nicht kritiklos, da Bentham sich im Gegensatz zu ihm nicht mit der praktischen Umsetzung beschäftigt hatte, sie beeinflußten aber sehr stark seine spätere Kommissionsarbeit48. So schlug sich Benthams rationaler Bürokratismus in dem Konsens der Kommission nieder, daß rationale Verwaltung auf die Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis gestellt sein sollte. Die Reform von 1834 begann daher die Gesetzgebung von reiner Armenpolitik zu umfassender Gesellschaftspolitik zu transformieren, bei der die Interdependenz sozialer Phänomene berücksichtigt wurde49.
Malthus gruppierte seine Gedanken um seine Bevölkerungstheorie, welche besagte, daß der menschliche Geschlechtstrieb sich fortzupflanzen stärker sei, als die Vorsorge für ausreichende Nahrung zu sorgen. Die Natur würde daher auf zu schnell wachsende Bevölkerungen mit Seuchen und Hungersnöten regulierend einwirken. Die Politik müßte nun anstelle dieser natürlichen Regulation die Menschen zu vorsorgender Geburtenkontrolle anhalten, um die Bevölkerungsentwicklung hinsichtlich der Nahrungsmittelproduktion zu steuern50. Da die Armenhilfe vor 1834 den Menschen aber in jedem Fall eine Grundversorgung garantierte, würde sie genau das Gegenteil bewirken, also die Menschen zu unbedachter Reproduktion motivieren. Für die Arbeiter, welche noch im Stande waren, sich selbst zu versorgen, blieben daher noch kleinere Portionen der vorhandenen Nahrung übrig, so daß auch sie in die Armenhilfe abgedrängt würden51. Er forderte daher die völlige Abschaffung der Armenhilfe, da sie nur das Angebot - Nachfrage - Prinzip für die Bestimmung des Lohnes stören, und den Armen die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln nehmen würde.
„...I feel little doubt in my own mind that if the poor-laws had never existed, though there might have been a few more instances of very severe distress, yet that the aggregate mass of happiness among the common people would have been much greater than it is at present“52.
Senior vertrat seinerseits keinen derartig konsequenten laisser - faire Standpunkt, war er doch davon überzeugt, daß das menschliche Verlangen nach einer Verbesserung der eigenen Lage den Geschlechtstrieb durchaus genügend kontrollieren könnte. Auch sah er die Notwendigkeit eines Eingreifens seitens des Staates, in Situationen, aus denen sich der Einzelne durch eigene Anstrengungen nicht helfen konnte. Er versuchte daher die widersprüchlichen Auffassungen über die Rolle des Staates in dem Gesetzesentwurf miteinander zu vereinen53.
Das reformierte Armengesetz, welches 1834 durch den König gültig wurde, basierte auf zwei Prinzipien welche die geistige Vaterschaft der Reform widerspiegelten. Zum einen das Prinzip der `less eligibility´, der geringeren Wählbarkeit, das besagte, daß die Lage des Unterstützungsempfängers in jedem Fall schlechter sein sollte, als die des untersten Arbeiters. Damit sollte das Recht auf Hilfe durch die Pflicht zur Selbstversorgung ersetzt werden. Das zweite Prinzip, der `workhouse test´ (Arbeitshaustest), sollte die geringere Wählbarkeit garantieren. Es wurde daher jegliche Form der Unterstützung außerhalb der neu organisierten Arbeitshäuser verboten, während die Bedingungen innerhalb dieser Institutionen besonders schlecht gestaltet werden sollten. Wer trotz dieser Umstände weiterhin Hilfe verlangte, der galt als tatsächlich hilfsbedürftig54.
Damit diese Reformen auch tatsächlich eingeführt, deren Praxis überwacht und kontrolliert werden konnte, enthielt das neue Armengesetz auch verwaltungstechnische Erneuerungen. Die bisher zuständigen Gemeinden sollten zu größeren Verwaltungseinheiten der Armenhilfe (Poor Law Unions) zusammengefasst werden. Die Migrationsbestimmungen innerhalb des Landes wurde vereinfacht, und die Armenaufseher sollten durch eine gewählte Körperschaft (Board of Guardians) in den Unions, mit ihr unterstehenden, voll bezahlten Beamten ersetzt werden. An die Spitze der Verwaltung wurde schließlich eine ständige Armenkommission mit einem Inspektorat als Exekutive gesetzt, welche die Körperschaften überwachen sollte, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten55. Die bedeutendste Veränderung war die Schaffung dieser zentralen Kommission, die mit umfassenden Befugnissen ausgestattet war, und Weisungen an die lokalen Behörden geben konnte.
„...for executing the powers given to them [der Kommission] by this Act the said commissioners shall and are hereby authorized and required, from time to time as they shall see occasion, to make and issue all such rules, orders, and regulations for the management of the poor, for the government of workhouses and the education of the children therein,...“56
Damit wurde das Fundament einer zentralisierten Armenpolitik gelegt, die Umsetzung der Reform konnte aber auch mit einer derartigen Verwaltung nicht in ganz England erreicht werden. Das größte Problem das den Reformern bei der Einführung der neuen Praxis begegnete, gründete in dem Fokus, den sie auf die Problematik der überschüssigen Arbeitskräfte im ländlichen Süden gelegt hatten. In den industriellen Ballungsgebieten des Nordens gab es aber kaum eine derartige strukturelle Unterbeschäftigung. Hier war die Problematik der Armut zunehmend an die Konjunkturschwankungen gebunden, so daß in wirtschaftlich guten Zeiten der Arbeitshaustest nahezu überflüssig war, da es kaum arbeitsfähige Arbeitslose gab. Während der konjunkturellen Krisen verloren aber so viele Arbeiter ihre Einkommensquelle, daß selbst das größte Arbeitshaus noch zu klein gewesen wäre, sie alle aufzunehmen57.
Inwieweit die Probleme im Norden durch das reformierte Armengesetz in den Griff bekommen werden konnte und wie sich die Armenverwaltung dort gestaltete soll nun im nächsten Abschnitt beurteilt werden.
III. B) Umsetzung der Reform und deren Auswirkungen
Nachdem die Reform der Armengesetze im Süden Englands relativ schnell umgesetzt worden war, begannen die Kommissionsmitglieder 1837 damit die Gemeinden im Norden zu den neuen Unions zusammenzufassen58. Hier trafen die Beamten aus London aber auf starken Protest, der sich in den nördlichen Industriegebieten aus verschiedenen Gründen formierte. Konservative sahen in dem neuen Gesetz die endgültige Abschaffung paternalistischer Hilfsstrukturen durch unpersönliche Bürokratien. Radikale Arbeiter vermuteten hinter der Reform die Intention der Fabrikbesitzer ein neues Instrument zu schaffen, um die Löhne drücken zu können. Durch das Prinzip der geringeren Wählbarkeit und der Drohung des Arbeitshauses könnten auch die niedrigsten Löhne und schlechtesten Arbeitsbedingungen durchgesetzt werden. So hatte auch bereits 1834 ein Fabrikbesitzer aus Lancashire Briefe an Chadwick geschrieben, in denen er die Umsiedlung der überschüssigen Landarbeiter aus dem Süden in die nördlichen Industriegebiete vorschlug. Dadurch hoffte er die gut organisierten Gewerkschaften zu schwächen, und die Unterschiede zwischen den hohen Löhnen des Nordens und den niedrigen des Südens ausgleichen zu können59. Die Steuerzahler, Armenaufseher und lokale Verwaltungen verstanden den Sinn der Reform nicht, da sie auf die Zustände im ländlichen Süden hin zugeschnitten war. Im industrialisierten Norden hatte die Armenhilfe unter den alten Gesetzen aber relativ gut funktioniert, und man wehrte sich energisch gegen diese Einmischung Londoner Bürokraten in die regionalen Verhältnisse. In vielen Gemeinden und Städten hatten die lokalen Behörden ihre Armenhilfe ohnehin schon selbständig reformiert, Komitees für die Verwaltung gewählt und voll bezahlte Assistenten den Aufsehern zur Seite gestellt. Durch derartige Verbesserungen in den lokalen Armenverwaltungen konnten vielerorts die Ausgaben sogar gesenkt werden. Der Protest gegen das neue Armengesetz formierte sich so quer zu allen politischen oder gesellschaftlichen Grenzen im gesamten Norden60.
Erschwerend kam hinzu, daß sich 1837 eine ökonomische Depression abzeichnete, als die königliche Kommission gerade mit der Reform in den Industriegebieten beginnen wollte. Die wirtschaftliche Prosperität der 30´er Jahre hatte im Süden noch zusätzlich geholfen, die Änderungen ohne starken Protest durchführen zu können. Mit dem Beginn einer neuen konjunkturellen Krise, waren die Reformer aber im Norden von Anfang an mit einer Situation konfrontiert, auf welche das neue Armengesetz überhaupt nicht zugeschnitten war. Die arbeitsfähigen Armen waren in den Industriegebieten während des ökonomischen Aufschwungs der vorherigen Jahre weitgehend absorbiert worden, nun gerieten durch Kurzarbeit oder zeitweise Arbeitslosigkeit aber Viele wieder in Armut61. Der Arbeitshaustest wurde dadurch überflüssig sowie unmöglich, da es kurzfristig einfach zu viele Hilfsbedürftige gab, aber fest stand, daß deren Zahl mit einer besseren Wirtschaftslage wieder zurückgehen würde. Durch diese zyklische Krise wurde die Migration aus dem Süden auch wieder gestoppt, nachdem bereits fast 10.000 Familien umgesiedelt worden waren.
Der Protest gegen die Reform war im Norden auch deshalb wesentlich stärker, da dessen Agitatoren auf das Mobilisierungspotential der Fabrikarbeiter und deren Organisationen aufbauen konnten. So wurden in vielen Arbeiterstädten Anti-Poor-Law-Komitees gegründet, Demonstrationen organisiert und Finanzfonds eingerichtet, um den Agitatoren Löhne zahlen zu können. Im West Riding wurde sogar ein Koordinationsbüro eingerichtet, um die Aktivitäten der einzelnen Gemeinden leiten zu können62.
Aufgrund des zahlreichen Protestes wurde das neue Gesetz in seiner ursprünglichen Form im industriellen Norden nie völlig installiert. Nachdem die zentrale Kommission die lokalen `Boards of Guardians´ unter erheblichen Schwierigkeiten etabliert hatten, erlaubten sie ihnen weiterhin Hausarmenhilfe zu gewähren. Selbst der Vorschlag in Krisenzeiten Erwerbslose für öffentliche Arbeiten einzusetzen, um den abschreckende Charakter für Arbeitsfähige zu erhalten, wurde von den meisten lokalen Beamten ignoriert oder mißachtet. Der Arbeitshaustest wurde in den industrialisierten Gebieten daher nie praktiziert, und die Hilfe außerhalb der Arbeitshäuser auch nicht abgeschafft63. So blieb der Anteil der Arbeitshausinsassen an allen Hilfeempfängern auch nach 1850 mit 12% relativ unbedeutend. Die Steigerung bis 1880 auf 22%, läßt sich durchaus auf die Einführung der Reform zurückführen, beweist aber auch, daß das Arbeitshaus weiterhin eine Ausnahme unter den Unterstützungsformen blieb.
Die neue Form der konjunkturell bedingten Armut konnte aus den genannten Gründen mit den Disziplinierungsmaßnahmen des neuen Gesetzes nicht gemildert werden. Während solcher Krisenzeiten wuchs die Zahl der Hilfesuchenden jedesmal erneut über die Kapazitäten aller Arbeitshäuser, und die Abschaffung jeglicher Hausarmenhilfe hätte unter solchen Bedingungen zu katastrophalen Zuständen geführt.
Der im vorherigen Kapitel beschriebene Rückgang der Anträge auf Armenhilfe kann sicherlich auf die Reform zurückgeführt werden, resultiert aber wahrscheinlich aus der abschreckenden Wirkung, welche das neue System im Süden des Landes hatte. Inwieweit sich der Zuzug von Landarbeitern aus dem Süden auf die Lebensbedingungen der Arbeiter im Norden auswirkte, ist aufgrund der vorhandenen Daten nicht möglich. Da die Lohnserien der meisten Arbeitergruppen nach 1832 aber steigende Löhne verzeichnen, kann deren Konkurrenzdruck nur regional beschränkt gewesen sein. Die allgemeine Verschlechterung der Lebensbedingungen ab den späten 30´ern ist, aufgrund der zahlreichen Zugeständnisse der Reformer an die nördlichen Unions, auch nur auf die wirtschaftlichen Krisen 1837/38 und während der 40´er Jahre zurückzuführen.
Die Veränderung von der strukturellen Armut der Pauperismuszeit vor der Armenrechtsreform zu der zyklischen Armut der Industriewirtschaft wurde von den Reformern jedenfalls nicht erkannt, weshalb das Armutsproblem im Norden mehr durch wirtschaftlichen Aufschwung und wachsende Reallöhne, als durch die neue Verwaltung gemildert wurde.
IV. Ausblick
Der Lebensstandard der unteren Bevölkerungsschichten entwickelte sich während der hier behandelten Zeit kaum geradlinig. Wie ich in Kapitel II versucht habe darzustellen, läßt sich nur schwer von allgemeinen Trends sprechen. Während die eine Gruppe von Arbeitern eine Steigerung ihres Reallohnes erfuhr, begegnete den Arbeitern eines anderen Gewerbes, zum Beispiel bedingt durch den Niedergang ihrer Branche, schlimmste Not. In den 30´er Jahren verbesserte sich die Lage großer Bevölkerungsteile, und in den 40´er Jahren wuchs das Ausmaß der Armut erneut stark an, so daß sich für viele der Lebensstandard wieder verschlechterte. Somit muß eine Aussage über diese Entwicklung entweder auf sehr langfristige, grobe Trends oder auf stark eingegrenzte geographische Räume oder kurze Zeitabschnitte beschränkt bleiben.
Der hier gewählte Mittelweg hat, so hoffe ich, die Vielschichtigkeit der Entwicklung, mit teilweise gegensätzlichen Trends, deutlich gemacht.
Das Lösungskonzept der Armutsproblematik aus dem Jahre 1834 hat vielleicht auch deshalb nicht funktioniert, da sowohl die Ursachen der Armut, als auch ihr Aussehen ebenso vielschichtig waren. Die Reformer um Chadwick und Senior hatten sich zu stark auf die Verhältnisse im ländlichen Süden der Insel konzentriert, und bekamen so nicht die notwendige Übersicht über die komplexen Zusammenhänge der Armut. Sie verloren die Bedürfnisse der nicht-arbeitsfähigen Armen aus den Augen, weshalb die Reform dieser Gruppe eher einen schlechteren Lebensstandard verschaffte. Die Probleme der konjunkturell bedingten Arbeitslosen waren von ihnen auch nicht erkannt worden, was zu dem starken Widerstand der Menschen in den Industriegebieten gegen die Reform führte. Das Übersehen der speziellen und neuen Bedingungen unter dem Fabriksystem machte das neue Armengesetz zu einem veralteten Instrument, welches seine ursprüngliche Intention nicht mehr erfüllen konnte.
Zusammenfassend läßt sich über die Entwicklung des Lebensstandards in den hier betrachteten 50 Jahren nicht sagen, ob er sich generell verbessert oder verschlechtert hätte. Aber es läßt sich eine Veränderung von einer Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die strukturelle Unterbeschäftigung der Pauperismuszeit, zu kurzfristigen, aber auch gravierenden Einbrüchen durch wirtschaftliche Krisen beobachten.
V. Anhang
V. A) Literaturverzeichnis
Beveridge, W. H.: Unemployment, a problem of industry, London 1910
Crafts, N. F. R.: British economic growth during the Industrial Revolution, Oxford 1985.
Crompton, Frank: Workhouse children, Phoenix Mill 1997.
Edsall, Nicholas C.: The anti-poor law movement, 1834-44, Manchester 1971.
Flinn, M. W.: Trends in real wages, 1750-1850, in: Economic History Review, Vol. XXVII, No 1, 1974, S. 395-413.
Hastings, R. P.: Poverty and the poor law in the North Riding of Yorkshire, 1780-1837, Leeds 1982.
Johnson, Paul / Nicholas, Stephen: Male and female living standards in England and Wales, 1812-1857: evidence from criminal height records, in: Economic History Review, XLVIII, No 3, 1995, S. 471-481.
Kuczynski, Jürgen: Die Geschichte der Lage der Arbeiter in England von 1640 bis in die Gegenwart, Band IV, 2. Teil: Die Industrielle Revolution 1760 bis 1832, Berlin 1954.
Metz, Karl Heinz: Industrialisierung und Sozialpolitik, Das Problem der sozialen Sicherheit in Großbritannien 1795-1911, Göttingen 1988.
Nicholas, Stephen / Oxley, Deborah: The living standards of women during the industrial revolution, 1795-1820, in: Economic History Review, XLVI, No 4, 1993, S. 723-747.
Rose, Michael E.: The relief of poverty, 1834-1914, London 1974.
Rose, Michael E.: The anti-poor law agitation, in: J. T. Ward (Hrsg.): Popular movements, 1830-1850, London 1986.
Treble, James H.: Urban Poverty in Britain 1830-1914, Cambridge 1983.
Trevelyan, George Macaulay: English social history, London 1945.
Weisbrod, Bernd: „Victorian Values“ Arm und Reich im Viktorianischen England, Bochum 1988
V. B) Quellenverzeichnis
Zeitgenössische Schriften:
Engels, Friedrich: Die Lage der Arbeitenden Klasse in England, Suttgart 1909.
Quellensammlung:
Rose, Michael E.: The English poor law, 1780-1930, Newton Abbot 1971.
V. C) Tabellen 1 - 8
Tabelle 1A; 3; 5 aus: Kuczynski, J. (1954)
Tabelle 1 B; 2; 4; 6 aus: Crafts, N. (1985)
Tabelle 7; 8 aus: Rose, M. (1974)
[...]
1 Das waren zum einen Hilfsbedürftige, wie Alte, Kranke und Alleinstehende Mütter, aber auch zunehmend unterbezahlte, meist ungelernte Arbeiter
2 Vgl. Craft, N. F. R. (1985), S. 99ff. / Flinn, M. (1974), S. 395ff. / Kuczynski, J. (1954), S. 61ff.
3 Vgl. Flinn, M. (1974), S. 395
4 Vgl. Craft, N. F. R. (1985), S. 94ff.
5 Vgl. Nicholas, S./ Oxley, D. (1993), S.723ff. / Johnson, P./ Nicholas, S. (1995), S. 470ff.
6 Vgl. Flinn, M. (1974), S. 396
7 Vgl. ebd., S. 397
8 Vgl. Flinn, M. (1974), S. 399f.
9 Vgl. ebd., S. 401
10 Vgl. Crafts, N. (1985), S. 104f.
11 Kuczynski, J. (1954), S. 62
12 Vgl. ebd., S. 108 ff.
13 Vgl. Craft, N. (1985), S. 99f.
14 Vgl. Flinn, M. (1974), S. 407
15 Vgl. ebd., S. 408ff.
16 Vgl. Johnson, P./ Nicholas, S. (1995), S. 472ff.
17 Vgl. Nicholas, S./ Oxley, D. (1993), S. 734ff.
18 Vgl. Johnson, P./ Nicholas, S. (1995), S. 477ff.
19 Vgl. Beveridge, W. (1910), S. 42ff.
20 Trevelyan, G. (1945), S. 465
21 Kuczynski, J. (1954), S. 57
22 Vgl. Metz, K. (1988), S. 18ff.
23 Vgl. Trevelyan, G. (1945), S. 465
24 Kuczynski, J. (1954), S. 57
25 Vgl. Select Committee on Poor Rate Returns, Report V, Appendix A (1822), zit. n. Rose, M. (1971), S. 39ff.
26 Vgl. Hastings, R. (1982), S. 9
27 Vgl. Johnson, P./ Nicholas, S. (1995), S. 477
28 Vgl. Hastings, R. (1982), S. 9f.
29 Vgl. Treble, H. (1983), S. 23ff.
30 Vgl. ebd., S. 81ff.
31 Engels, F. (1909), S. 75
32 Vgl. Kuczynski, J. (1954), S. 64f.
33 Vgl. Hastings, R. (1982), S. 4f.
34 Vgl. Weisbrod, B. (1988), S.16f.
35 Vgl. Hastings, R. (1982), S. 11ff.
36 Vgl. Metz, K. (1988), S. 32f.
37 Vgl. Edsall, N. (1971), S. 47
38 Vgl. Hastings, R. (1982), S. 11f.
39 Vgl. Crompton, F. (1997), S. 16ff.
40 Vgl. Hastings, R. (1982), S. 21ff.
41 Vgl. ebd., S. 2
42 Vgl. Metz, K. (1988), S. 68
43 Select Committee on Labourers´Wages. Report, VI (1824), zit. n. Rose, M. (1971), S.52
44 Select Committee on Labourers´Wages . Report, VI, Evidence of Rev Phillip Hunt (1824), zit. n. Rose, M. (1971), S. 57
45 Vgl. Metz, K. (1988), S. 70f.
46 Vgl. Edsall, N. (1971), S. 2
47 Vgl. Metz, K. (1988), S. 37f.
48 Vgl. Edsall, N. (1971), S.6
49 Vgl. Metz, K. (1988), S. 72
50 Vgl. ebd., S. 27
51 Vgl. Edsall, N. (1971), S. 3
52 T. Malthus. Essay on Population (1798), zit. n. Rose, M. (1971), S. 46
53 Vgl. Edsall, N. (1971), S. 5
54 Vgl. Metz, K. (1988), S. 76
55 Vgl. Edsall, N. (1971), S. 8
56 W. Glen. The Statutes in Force Relating to the Poor (1857), zit. n. Rose, M. (1971), S. 96
57 Vgl. Edsall, N. (1971), S. 48
58 Vgl. Edsall, N. (1971), S. 49
59 Vgl. ebd., S. 51f.
60 Vgl. Rose, M. (1986), S. 80ff.
61 Vgl. Metz, K. (1988), S. 80f.
62 Vgl. Rose, M. (1986), S 86f.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Das zentrale Thema dieser Arbeit dreht sich um die Frage, wie sich das reformierte Armenrecht von 1834 auf die Situation der Hilfsbedürftigen und ungelernten, unterbeschäftigten Arbeiter im Norden Englands auswirkte.
Welche Debatten werden in dieser Arbeit angeschnitten?
Es werden zwei wichtige Debatten der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Industriellen Revolution in England angeschnitten: die Diskussion des Lebensstandards der britischen Bevölkerung und die Debatte der Reform des Armenrechts von 1834.
Warum ist die Datenlage für die Forschung eingeschränkt?
Die statistische Datenlage zu den Lebensbedingungen der vom Armenrecht Betroffenen ist sehr eingeschränkt. Der Lebensstandard entwickelte sich für verschiedene Bevölkerungsgruppen, in unterschiedlichen Regionen und zwischen Stadt und Land sehr unterschiedlich, teilweise gegensätzlich. Statistische Aufzeichnungen sozialer Merkmale begannen erst in dem betrachteten Zeitraum, daher sind die Methoden der Datenerhebung noch nicht weit entwickelt.
Auf welche Region konzentriert sich die Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Norden Englands, da sich hier vor allem die neue Industrie entwickelte. Es wird aber auch eine Unterscheidung zwischen Stadt und Land getroffen.
Welchen Zeitraum betrachtet die Arbeit?
Die Arbeit betrachtet den Zeitraum von 1802 bis 1850, um die Auswirkungen der Armenrechtsreform von 1834 sowohl vor als auch nach der Reform zu analysieren.
Welche Indikatoren werden zur Messung des Lebensstandards verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Indikatoren wie Reallohn, Konsumausgaben pro Kopf, Körpergröße und die Anzahl der Pauper, die Unterstützung erhielten.
Wie hat sich der Reallohn während des betrachteten Zeitraums entwickelt?
Die Entwicklung des Reallohns variierte je nach Region, Branche und Berufsgruppe. Einige Gruppen erlebten einen Anstieg, während andere Rückgänge verzeichneten. Krisenzeiten führten oft zu einem Rückgang des Reallohns, vor allem für die ärmeren Arbeiter.
Welchen Einfluss hatte die Armenrechtsreform von 1834 auf die Armut?
Die Armenrechtsreform von 1834 basierte auf den Prinzipien der "less eligibility" und des "workhouse test". Sie führte zu einer Zentralisierung der Armenverwaltung. Die Reform stieß im Norden Englands auf Widerstand, da sie auf die Probleme des ländlichen Südens zugeschnitten war und die konjunkturell bedingte Armut in den Industriegebieten nicht berücksichtigte. Der Einfluss auf die Armut ist umstritten, da der Rückgang der Anträge auf Armenhilfe auch auf wirtschaftlichen Aufschwung und steigende Reallöhne zurückzuführen sein könnte.
Was waren die Hauptkritikpunkte an der alten Armenhilfe vor 1834?
Die alte Armenhilfe wurde kritisiert, weil sie angeblich die Arbeiter demotivierte, sich durch eigene Anstrengungen zu helfen, und zu einem unkontrollierten Anstieg der Kosten führte. Insbesondere das Speenhamland-System im Süden wurde als ineffizient und schädlich angesehen.
Welche Ideologien beeinflussten die Reformer des Armenrechts von 1834?
Die Reformer des Armenrechts von 1834 wurden stark von den Philosophien des Utilitarismus (Jeremy Bentham) und der politischen Ökonomie (Thomas Malthus, Nassau Senior) geprägt.
Warum stieß die Armenrechtsreform von 1834 im Norden Englands auf Widerstand?
Die Reform stieß im Norden auf Widerstand, da sie auf die Probleme des ländlichen Südens zugeschnitten war und die konjunkturell bedingte Armut in den Industriegebieten nicht berücksichtigte. Zudem befürchteten Arbeiter, dass die Reform dazu dienen würde, die Löhne zu drücken.
Wie wurde die Armenrechtsreform von 1834 im Norden Englands umgesetzt?
Aufgrund des Widerstands wurde die Reform im Norden nie vollständig umgesetzt. Hausarmenhilfe wurde weiterhin gewährt, und der Arbeitshaustest wurde in den industrialisierten Gebieten nicht konsequent praktiziert.
Welche Rolle spielten wirtschaftliche Krisen in der Entwicklung des Lebensstandards?
Wirtschaftliche Krisen führten immer wieder zu kurzfristigen, aber gravierenden Einbrüchen im Lebensstandard der Arbeiter, insbesondere in den 1840er Jahren.
Was sind die wichtigsten Quellen für diese Arbeit?
Die wichtigsten Quellen sind Statistiken über Lohn- und Preisentwicklung, Daten über die Körpergröße, zeitgenössische Schriften und Beschreibungen aus der Sekundärliteratur.
- Quote paper
- Stefan Zimmer (Author), 2001, Lebensstandard und Armenreform von 1834 in Großbritannien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/107046