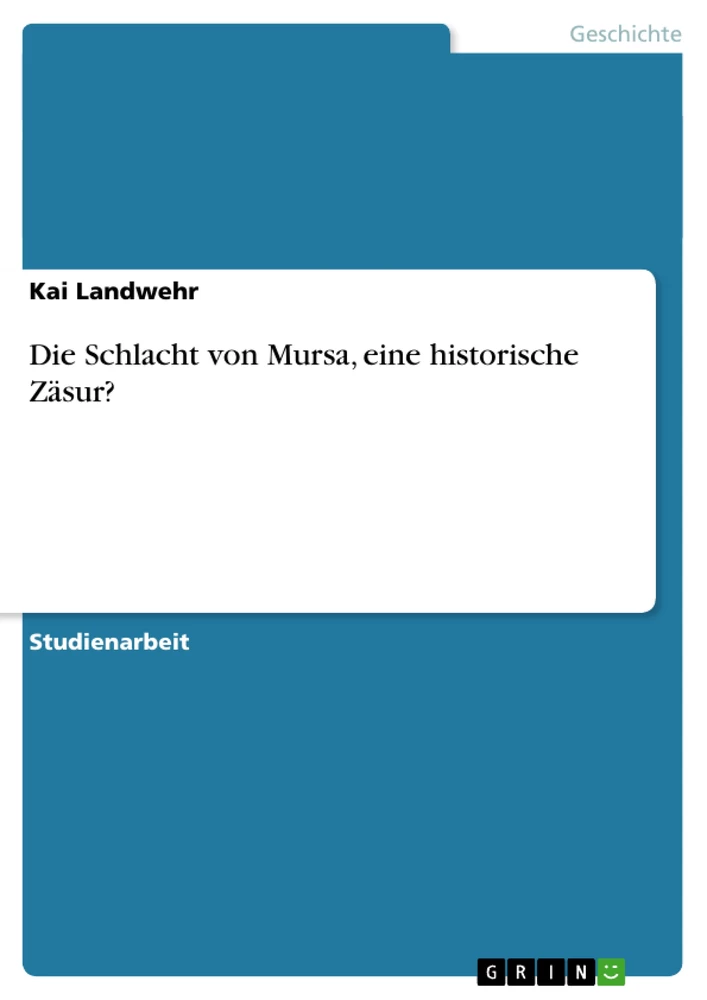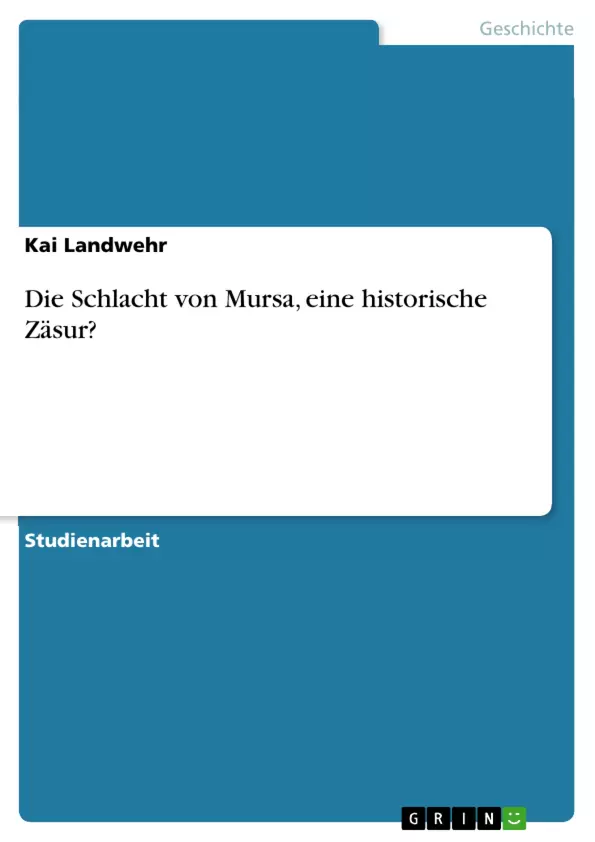Ein Reich in Flammen, eine Dynastie am Abgrund! Tauchen Sie ein in das düstere Jahr 350 n. Chr., als der Usurpator Magnentius eine blutige Rebellion gegen Kaiser Constantius II. anzettelte und das römische Reich in einen verheerenden Bürgerkrieg stürzte. Dieses Buch enthüllt die packende Geschichte eines Mannes, der nach der Macht griff und beinahe die Weltordnung verändert hätte. Verfolgen Sie Magnentius' Aufstieg vom Heerführer zum selbsternannten Augustus, seine riskanten politischen Schachzüge und seine militärischen Kampagnen, die im Chaos der Schlacht von Mursa gipfelten – einer der blutigsten und folgenreichsten Schlachten der römischen Geschichte. Entdecken Sie die komplexen Hintergründe der Usurpation, die politischen Intrigen am Hofe des Constantius und die religiösen Spannungen, die das Reich spalteten. Erfahren Sie mehr über die barbarische Herkunft des Magnentius, seine religiösen Überzeugungen und die Frage, ob er tatsächlich ein Heiden war oder nur um die Gunst des Volkes warb. Analysieren Sie die militärischen Strategien beider Seiten, die entscheidende Rolle der Kavallerie und die verheerenden Auswirkungen der Schlacht auf die römische Armee und die Stabilität des Reiches. War Mursa der Wendepunkt, der den Niedergang des Weströmischen Reiches einleitete? Dieses Buch bietet eine fundierte und fesselnde Analyse der Ereignisse, die das Schicksal des Reiches für immer veränderten. Begleiten Sie Constantius auf seinem Feldzug gegen den Usurpator, seine Rückeroberung Italiens und Galliens und seine brutalen Strafgerichte, die das Reich weiter destabilisierten. Erforschen Sie die Frage nach der Bedeutung des Magnentius für die römische Geschichte, seine Rolle als Wegbereiter für den Untergang des Westens und seine Auswirkungen auf das militärische Denken der Spätantike. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für römische Geschichte, Militärgeschichte und die Ursachen des Untergangs des Römischen Reiches interessieren. Es bietet eine neue Perspektive auf eine entscheidende Epoche und wirft ein Schlaglicht auf die politischen, militärischen und religiösen Kräfte, die das Schicksal eines Weltreiches bestimmten. Eine fesselnde Reise in eine Zeit des Umbruchs, der Intrigen und der blutigen Schlachten, die das Gesicht Europas für immer veränderten. Erleben Sie den Aufstieg und Fall des Magnentius, eines Mannes, der das römische Reich bis ins Mark erschütterte und dessen Vermächtnis bis heute nachwirkt. Die Analyse der antiken Quellen, die detaillierte Schilderung der Schlacht von Mursa und die fundierte Bewertung der langfristigen Folgen machen dieses Buch zu einem unverzichtbaren Beitrag zur Erforschung der Spätantike und des Untergangs des Römischen Reiches.
Inhaltsangabe:
I. Einleitung
II. Hauptteil
II.1 Verzeichnis der antiken Quellen
II.2 Darstellung des historischen Hintergrundes
II.2.1 Die Nachfolger Konstantins und die Entwicklung im Reich bis zur Usurpation des Magnentius
II.2.2 Der Bürgerkrieg und die Schlacht von Mursa
II.2.3 Das Ende des Magnentius
II.3 Die Schlacht und ihre Bedeutung für die spätrömische Militärgeschichte
III. Schlussfolgerung
IV. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Usurpation des Magnentius, die im Januar 350 nach Christus begann und mit dem Suizid des Usurpatoren im August 353 ihr Ende nahm. Dazwischen gelang es dem rund fünfzigjährigen Heerführer sich der Herrschaft fast des gesamten Westen des römischen Reiches zu bemächtigen und durch die Ermordung des Constans, des jüngsten Sohnes Konstantin des Großen, das Ende der konstantinischen Dynastie einzuläuten. Herausragendes Ereignis im Bürgerkrieg zwischen Magnentius und Constantius II, dem in Konstantinopel residierenden Augustus, war die Schlacht von Mursa (dem heutigen Osijek in Kroatien) im Jahr 351, die aufgrund der gewaltigen Verluste auf beiden Seiten vielerorts als epochal eingestuft wird.
Diese Arbeit setzt es sich einerseits zum Ziel, den Verlauf der Geschichte bis zu dieser Schlacht zu rekonstruieren, den Schlachtverlauf zu schildern und kurz zu erläutern, sowie, um das Bild abzurunden, die Ereignisse bis zum Ende der Usurpation nachzutragen. Andererseits liegt das Hauptaugenmerk darauf, von dieser Basis aus den Stellenwert der Schlacht und des gesamten Bürgerkrieges herauszuarbeiten. Damit soll eine Antwort auf die Frage gegeben werden, ob die Schlacht von Mursa tatsächlich eine solch epochale Zäsur darstellte, dass man in ihr einen Meilenstein zum Untergang des weströmischen Reiches sehen kann.
Der erste Abschnitt umreißt die antiken Quellen. Ein Schwergewicht liegt hier auf den literarischen Quellen. Die einzelnen Autoren werden kurz skizziert und in ein, sich nach der Intention ihrer Schriften richtendes, Raster eingeordnet. Im Folgenden wird der Verlauf der Usurpation des Magnentius geschildert. Hierbei wird zuerst die eigentliche Usurpation beleuchtet, wobei das Augenmerk auf einzelne strittige bzw. in den letzten Jahren wieder in die Diskussion gezogene Aspekte, wie die Herkunft des Magnentius und seine Religiosität, gelegt wird. Danach wird der Verlauf des Bürgerkrieges bis zur Schlacht von Mursa wiedergegeben, wobei auch dessen Zwangsläufig- bzw. eventuelle Vermeidbarkeit Gegenstand der Analyse sein wird. Der Verlauf der Schlacht vor den Toren Mursas wird dargestellt und ihr Ausgang begründet.
Der Schluss dieses Kapitels beschreibt den weiteren Verlauf des Bürgerkrieges und gibt ein kleines Fazit über den Usurpator.
Das nächstes Kapitel widmet sich eingehend der Schlacht und stellt die Frage nach ihren Auswirkungen und ihrer generellen Bedeutung für die Militärgeschichte des spätrömischen Reiches.
Abschließend werden sämtliche Schlussfolgerungerungen noch einmal gesammelt und im Bezug auf die Ausgangsfrage ausgewertet.
Als Anhang folgt das Verzeichnis der verwendeten Literatur.
II. Hauptteil
II.1 Verzeichnis der antiken Quellen
Die Quellen, die sich mit der Regierungszeit von Constantius und dem Bürgerkrieg befassen sind reichhaltig. Reichhaltig einerseits aufgrund der Vielzahl der Autoren - wenngleich gerade die Schreiber der Chroniken häufig auf die selben Quellen zurückgreifen -, andererseits bieten die unterschiedlichen Verfasser mit Ihren mitunter gegensätzlichen Hintergründen und Ansichten reichen Boden für Quellenkritiker.
Bruno Bleckmann unterscheidet drei Richtungen der antiken Bürgerkriegsdarstellung, denen gemeinsam der Versuch dieses für Zeitgenossen epochale Ereignis einzuordnen und zu bewältigen zu Grunde liegt.1 Die vielleicht ergiebigsten Quellen sind die Origines des späteren Kaisers Julian. Dieser war im Jahr 331 geboren und so also unmittelbarer Zeitgenosse der Ereignisse. Auch wenn er später mit seinem Vetter Constantius in Konflikt geriet, quasi selber zum Usurpator wurde, so war seine Intention doch eindeutig den Sieg der konstantinischen, seiner, Familie gegen den germanischen Aggressor zu rühmen. So erklärt sich auch das abgrundtief schlechte Magnentiusbild, das man aus seinem Werk gewinnt. Dieses Werk des Magnentius rechnet Bleckmann folglich einer imperial-progangandistischen Überlieferung zu.
Daneben spielt hier auch noch eine Rolle, dass Julian später auf die Loyalität der gallischen Legionen angewiesen sein sollte und es deswegen vermied, diese Legionen, die im Krieg auf der Seite des Magnentius standen, in Misskredit zu bringen. Diese sollen eher dazu gezwungen worden sein, sich dem hauptsächlich aus Franken und Sachsen bestehenden Heer anzuschließen.2 Vielmehr rühmt er sogar ausdrücklich deren Treue und Tapferkeit in der Schlacht.
Der Gruppe dieser Autoren ist auch Themistios zuzuordnen. Der bewunderte Redner(etwa 317-388) stammte aus dem konstantinischen Dienstadel und genoss bis zu seinem Tode höchstes Ansehen am Hof. Als Quelle selbst kann er in ergänzender Weise dienen.
Weitere Eindrücke bietet die Caesares des Aurelius Victor, bzw. die zu Unrecht in seinen Corpus aufgenommenen Epitome de caesaribus. Seine Schwerpunkte liegen vor allem in einer unparteiischen, moralisierenden Darstellung, die Epitome bestehen aus kurzgefassten Kaiserbiographien.
Die christliche Religion nahm ebenfalls Einfluss auf die Überlieferung der Schlacht von Mursa und des gesamten Bürgerkrieges. Verständlicherweise wird auch hier Magnentius in schlechter Weise geschildert und als heidnischer Barbar gebrandmarkt. Zugleich ist aber auch die Darstellung des Constantius mit Vorsicht zu genießen. Dieser war wegen seiner ihm vorgeworfenen Nähe zum Arianismus und seiner Gegnerschaft zu Bischof Athanasios von Alexandria3 bei den streng orthodoxen Autoren unbeliebt. Die arianische Geschichtsschreibung bietet ein ungleich freundlicheres Constantiusbild. Sie betonten eine Kreuzerscheinung in Jerusalem und die Gläubigkeit des Kaisers. Damit wurde der Erfolg bei Mursa in dem späteren auch literarisch ausgefochtenen Dogmastreit für die Sache des Areios instrumentalisiert.4 Aussagekräftig ist hauptsächlich das für häretisch erklärte verlorene Werk des Philostorgios. Teile der Bücher des um 368 geborenen Autoren haben aber wegen ihres literarischen Reizes in Sekundärquellen überlebt.
Für die orthodoxe Überlieferung ist Sulpicius Severus maßgebend. Seine Chronica hatte der Historiker und Hagiograph wohl um 403 als Vierzigjähriger verfasst. In diesem Kontext wären auch die Kirchengeschichten des Theodoret, Bischof von Kyrrhos (ca.393-466), Lucifer von Caralis, Hieronymus, Orosius, Sozomenos und Sokrates zu nennen. Herausragende Zeitdokumente, wenn auch mit weniger Augenmerk auf den Bürgerkrieg selbst, sind die Bücher und die Briefe des „violent partymans“5 Bischof Athanisios von Alexandria.
Der dritte wichtige Zweig der Überlieferung ist die aus dem senatorisch- heidnischen Milieu Roms selbst stammende. Als Hauptquellen gelten die beiden verschollenen Werke der Senatorin Proba (Frau des praefectus urbis 351) und von Nicomachus Flavianus (ca. 334-394) . Diese zeigen, soweit sie rekonstruierbar sein mögen, einen wiederum anderen Ansatz. Das gesellschaftliche Milieu, dem sie entspringen, war ganz entschieden in die Geschehnisse eines Bürgerkriegs involviert. Die stadtrömischen Senatoren waren Repräsentanten, sie mussten sich auf Gedeih und Verderb im Falle eines Bürgerkriegs für eine Seite entscheiden (meist natürlich für die Seite der Partei, die die Stadt in Besitz hielt). Somit waren die Senatoren häufig Leidtragende verschiedener Bürgerkriege, da ihre finanziellen Ressourcen gerne dazu verwendet wurden, die diversen Kriegskassen der Parteien zu füllen.6 So findet sich in diesen Quellen eine differenzierte Sicht auf die Dinge, ohne christliche oder propagandistische Verklärung. Allerdings folgen diese Werke bestimmten literarischen Topoi, so dass ihre Authenzität auch wieder stark gemindert wird.7
Zwei weitere Quellen, die der profanen Historiographie angehören und zum Teil auf den oben erwähnten beiden Quellen basieren., sind Zosimos und Zonaras. Neben Julian geben gerade diese beiden Quellen das umfassenste Bild von dem Geschehen vor den Toren der Stadt Mursa.
Zosimos verfasste um 500 seine Historien. Dieses Werk liefert trotz fehlender Scharfsinnigkeit und Virtuosität viele Information. Allerdings müssen auch diese genau beleuchtet werden, da der Autor sehr abhängig von seinen Quellen (Eunap8 ) war.
Zonaras lebte Ende des 11. Jhd. bis zur Mitte des 12. Jhd., er war zunächst hoher Hofbeamter in Konstantinopel, dann Mönch. Er schrieb eine Weltgeschichte vom Anbeginn bis zum Jahr 1118. Auch die Arbeit mit dieser Quelle bietet Tücken, ist aber durchaus aufschlussreich.9
Weiterhin sind abschließend noch Schriftsteller und Gelehrte wie Libanios, Eutropius und Ammianus Marcellinus anzuführen. Der Letztgenannte ist ein Sonderfall, denn der erhaltene Teil seines Werkes res gestae beginnt mit dem Jahr 353 im Buch 14. So gesehen ist es sehr bedauerlich, dass uns seine Bücher 1-13 nicht zur Verfügung stehen.
Als herausragende archäologische Quelle gilt die Kaiservilla von Centcelles (bei Tarragona). Magnentius selbst trug Sorge dafür, dass diese zu einem Grabmonument für den von ihm ermordeten Constans umgebaut wurde.
Auch die Numismatik gibt wichtige Eindrücke in den Bürgerkrieg und speziell in das Wesen der Kontrahenten. Als antikes Nachrichten- und Propagandamittel nutzte natürlich der Usurpator Magnentius die Münzen für seine Zwecke. Dabei stechen besonders drei Münzen ins Auge. Auf der ersten Münze sieht sich der Usurpator als Befreier der Römer (LIBERTAS ROMANORUM), damit versucht er seine Usurpation und die Tötung des Constans als Angriff auf und Erlösung von einer schlimmen Tyrannis darzustellen.10 Zum zweiten sind die Programmmünzen auffällig, die Magnentius 350 schlagen ließ, die ihn als untergeordneten Augustus gegenüber Constantius darstellen.11 Die dritte, sehr bekannte Münzart sind die sogenannten Christogramm-Münzen. Diese mit den christlichen Symbolen ǹ und ȍ versehenen Münzen geben zu einigen Diskussionen um die Religiosität von Magnentius Anlass.12
II.2 Darstellung des historischen Hintergrundes
II.2.1 Die Nachfolger Konstantins und die Entwicklung im Reich bis zur Usurpation des Magnentius
Obwohl der Tod Konstantins des Großen am 22. 5. 337 unerwartet eintrat, hatte der römische Kaiser seine Nachfolge geregelt. Er hatte seine Söhne schon früh zu Mitregenten ernannt. So wurde u.a. Constantius nach dem Sieg seines Vaters gegen Licinus im Alter von sieben Jahren zum Caesar ernannt. Allerdings stand die Reichseinheit nach dem Tod des Herrschers auf dem Spiel, da es Konstantin versäumt hatte dem Reich durch Ernennung eines Mitaugustus eine klare Spitze zu geben. Da sich die Soldaten von niemand anderem als den Söhnen Konstantins regieren lassen wollten,13 gab es im östlichen Teil des Reichs ein Blutbad unter möglichen Thronprätendenten aus den Nebenlinien der konstantinischen Dynastie. Ihm fielen u.a. auch Flavius Dalmatius, der ein Neffe Konstantin und von diesem zum Caesar für Thrakien und Konstantinopel bestimmt worden war, sowie auch mehrere hohe Reichsbeamte zum Opfer.
In Folge dieses Blutbads, an dem von einigen Autoren Constantius eine Mitschuld gegeben wird14, teilten die drei Brüder Konstantinus II, Constantius II und der junge Constans das Reich unter sich neu auf und ließen sich am 9.9.337 zu Augusti ausrufen. Ab 340 war das Reich praktisch nur noch zweigeteilt, denn der sich bei der Verteilung der Länder des Dalmatius geprellt sehende Konstantinus fand bei einem Feldzug gegen seinen jüngeren Bruder Constans den Tod. Somit beherrschte Constans nun den ganzen Westen, Constantius regierte von Konstantinopel aus den gesamten Osten. Dieser Zustand blieb trotz gelegentlicher Spannungen zwischen den Brüdern bis zum Jahr 350 unverändert. Am 18. Januar dieses Jahres erhob sich in Augustodonum in Gallien (dem heutigen Autun) der Heerführer Flavius Magnus Magnentius. Eine Woche später war Constans, der mit seinem Hof in Augustodonum residiert hatte, tot. Damit begann faktisch der drei Jahre währende Bürgerkrieg.
Magnentius wurde ungefähr 303 in Gallien geboren. Der Geburtsort und die Frage seiner Herkunft sind unklar.. Der allgemeine Tenor der Quellen besagt, dass er barbarischer Abstammung sei. Themistios spricht von einem verdammten Barbaren15, Aurelius Victor erklärt in 41,25 die Brutalität und Grausamkeit von Magnentius in seiner barbarischen Natur. Schließlich geben Zosimos und ein unbekannter Scholiast am Text von Julian ganz konkrete Berichte zu seiner Abstammung ab. Der griechische Historiker siedelt ihn unter den „leti“, einem, wie er sagt, gallischen Stamm an, und billigt ihm immerhin eine lateinische Erziehung zu.16 Der spätere römische Kaiser Julian wird noch genauer und erklärt, dass der Usurpator aus Ambianum in Gallien (Amiens) stammt, sein Vater ein Britannier und seine Mutter eine Fränkin war.17 Diese Abstammung gilt als allgemein anerkannt, den Stamm der Leti sieht man eher als „Laete“ an, d.h. als kriegsgefangene Franken, die in Gallien angesiedelt wurden.18 John F. Drinkwater vertritt allerdings die These, dass die Herkunft des Usurpators in keinerlei Weise barbarisch sei, vielmehr gar nicht sein könnte. Eine solche Herkunft würde ihn, der von den höchsten innenpolitischen Kreisen auf den Thron gehievt wurde - dazu später -, für den Rang des Augustus automatisch disqualifizieren. Er sieht in Magnentius eher einen Spross einer von Konstantin protegierten franko-römischen Familie, ähnlich dem in diesen Bürgerkrieg aktiv verwickelten und späteren Usurpator wider Willens Silvanus.19 Diese Argumentation ist stichhaltig, wobei eine Abstammung als „Laete“ zumindest für den Bereich des Heeres keinen Hinderungsgrund für eine große Karriere im Normalfall darstellte.20
Auch die Frage der Religiosität von Magnentius ist umstritten. Der Tenor der literarischen Quellen sieht in Magnentius einen Heiden. Er soll auch direkt wieder, die vor ihm verbotenen heidnischen nächtlichen Opfer wieder gestattet haben. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass Magnentius zumindest nominell Christ gewesen sein könnte.21 Das Prägen der Christogramm-Münzen kann als ein Werben um die Christen gesehen werden, genauso allerdings ist es möglich, dass das Aufheben des Verbots den selben Zweck im Bezug auf die Heiden erfüllen sollte. Wenngleich ein überzeugter Christ dies wohl trotzdem unterlassen hätte. Vielleicht wollte Magnentius mit dem Prägen der Münzen den christlichen Gott als Schlachtenhelfer auf seine Seite ziehen.22 Generell zeigte sich Magnentius in Religionsfragen tolerant, er versuchte sogar sich die innerkirchlichen Differenzen zunutze zu machen und suchte den Kontakt zu Athanasios.23
Unbestritten ist, dass Magnentius eine steile Karriere im römischen Heer machte, die ihn bis zum Datum seiner Usurpation bis in die Stellung des Legionskommandanten der beiden palatinischen, d.h. den Kaiser begleitenden, Legionen „Herculiani“ und „Ioviani“ brachte. Zugleich machte er sich Freunde auch in den höchsten Stellen der römischen Zivilverwaltung, was beides dafür spricht in Magnentius einen durchaus fähigen, ehrgeizigen Mann zu sehen.
Wie schon erwähnt wurde Magnentius in einer Verschwörung ziviler und militärischer Würdenträger dann am 18. Januar 350 zum Augustus ausgerufen. Die Drahtzieher waren Marcellinus, der comes rei privatae von Constans, sowie Fabius Titianus, der Prätorianerpräfekt von Gallien. Magnentius fand sehr schnell Anerkennung in der Stadt und beim anwesenden Militär. Dies war nicht unbedingt verwunderlich, schließlich waren die Legionäre ihrem Kommandanten ergeben und der geschasste Kaiser erfreute sich allgemeiner Unbeliebtheit. Persönliche Laster und Schwächen wie Arroganz, mangelnde körperliche Leistungsfähigkeit, Neigung zu Alkohol und homosexuellen Beziehungen brachten ihm ebenso die nicht unerhebliche Gegnerschaft von Militär, Provinzialen und Senat wie einige politische Fehlentscheidungen und Fehlbesetzungen bei den Statthaltern .24
Constans selbst wurde nicht sofort getötet, ihm wurde vielmehr die Möglichkeit zur Flucht gegeben. Seine Flucht, die eher eine Jagd war, dauerte fast eine Woche, bis der germanische Heermeister Gaiso den Pyrenäen einholte und tötete.25 Als Belohnung wurde Gaiso zum Konsul für das Jahr 351 von Magnentius berufen.
Ort und vor allem Zeitpunkt der Usurpation waren klug und eingehend geplant. Die Verschwörer wussten, dass es Constantius, wenn ihn Wochen später die Nachricht von der Usurpation und dem Tod des Bruders erreichen sollte, unmöglich sein würde, schnell mit großen Kräften gen Westen zu ziehen.26 Der Imperator des Ostens musste sich nämlich jedes Jahr um diese Zeit mit den persischen König Shapur auseinandersetzen. Dieser jahrzehntewährende Grenz- und Stellungskrieg zwang Constantius ständig ein Großteil seiner Truppen an der Kampflinie zu halten.
So drohte den Verschwörern im Moment keine Gefahr aus dem Osten. Allerdings wussten Magnentius und seine Anhänger nicht, ob die nun verstreichende Zeit ihr Freund oder ihr Feind werden sollte. Ihr Ziel war sicher nicht die Herrschaft über das komplette Reich, sie strebten nach Anerkennung als Augusti des Westens. Gründe zur Hoffnung gab es, denn schließlich war das Verhältnis der Brüder generell nicht gut und stand kurz vor einem auf religiösen Gründen basierenden Konflikt. Magnentius wollte beweisen, dass er ein würdiger Prätendent war. Vorher galt es allerdings die Herrschaft im Westen zu sichern.
II.2.2 Der Bürgerkrieg und die Schlacht von Mursa
Nach dem Tod des Constans konnte Magnentius seine Machtposition im Westteil des Reichs rasch ausbauen. In kurzer Reihenfolge fielen ganz Gallien, wo er eh breite Zustimmung hatte, Britannien, Spanien, die Provinz Africa und Italien an ihn. Der Gewinn Italiens dürfte kaum mehr als einen Monat an Zeit beansprucht haben, denn schon Ende Februar sind sowohl Anicetus als Präfekt von Italien als auch Titianus als Präfekt von Rom belegt.27
Trotzdem gelang es den Verschwörern nicht, sich den kompletten Reichsteil von Constans zu sichern, das weitere Vorrücken gegen Westen wurde von dem greisen Heermeister Vetranio, der sich nun selber wiederum den Purpur anlegen ließ, am 1.März dieses Jahres unterbunden. Vetranio war der magister peditum des illyrischen Heeres. Ihm unterstanden also die schlagkräftigen Legionen dieses Kernrekrutierungsgebiets der römischen Armee.
Auch in Italien selbst bekam Magnentius durch eine weitere Erhebung Probleme. In der Hauptstadt Rom hatte sich mit Julius Nepotianus ein Mann aus dem konstantinischen Haus gegen den Usurpator erhoben (3.6.). Diesem gelang es sogar den von Magnentius eingesetzten Präfekten Anicetus zu besiegen und zu töten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Erhebung Nepotianus von Constantius geplant war.28 Doch nach ganzen vier Wochen schlug Marcellinus den Aufstand der, wie die Quellen berichten, „Gladiatoren und verzweifelten Männer“ nieder. Darauf folgten Strafgerichte in Rom und die Senatoren, die sich Nepotianus angeschlossen oder ihn irgendeiner Weise unterstützt hatten, mussten dies teuer, häufig auch mit dem Leben bezahlen. Unter den Opfern dieser Maßnahmen waren auch einige Mitglieder der kaiserlichen Familie, so z.B. Eutropia.29 Die Einnahmen aus den Konfiskationen flossen in die Kriegskasse von Magnentius.30
Constantius hatte Vetranio sofort anerkannt und ihm als Zeichen dafür sogar ein Diadem gesandt. Dies mag mehrere Gründe gehabt haben. Constantius wäre einer möglichen Allianz zwischen Vetranio und Magnentius militärisch nicht gewachsen gewesen.31 Andererseits spielte ihm die Erhebung Vetranios in die Karten. So konnte er in Ruhe seine Ostgrenze sichern, vielleicht wird er auch darauf gehofft haben, dass Vetranio und Magnentius sich in einem Konflikt aneinander aufreiben und er mit seinen frischen Truppen für die Entscheidung sorgen könnte.32 Während sich Constantius zum Abmarsch Richtung Westen bereit machte, versuchte Magnentius immer noch einem Bürgerkrieg zu entgehen und warb um Anerkennung. Nachdem diese Versuche von Constantius abschlägig behandelt wurden - Magnentius hatte extra Münzen schlagen lassen, die Constantius mit ihm zusammen als höhergestellten Augustus zeigten -, bemühte er sich um Vetranio. Mit diesem soll er sogar nach einigen Quellen ein Bündnis geschlossen haben (u.a. Julian I 27 a,), allerdings gibt es keine Zeichen für eine längere Dauer dieses Bündnisses oder eine formale Anerkennung Vetranios, der nie Münzen für Magnentius schlagen ließ.33 Trotzdem sandten die Beiden im Spätsommer 350 Boten zu Constantius. Magnentius schlug dem Constantius eine Art Oberhoheit über sich und Vetranio vor, gleichzeitig bot er dem Augustus seine Tochter zur Heirat und warb selbst um Constantina, die Schwester des Constantius.
Constantius reagierte, indem er die Boten gefangen nehmen ließ und somit faktisch den Krieg erklärte. Er selbst rückte nun schnell vor und gegen Ende des Jahres brachte er die Truppen des Vetranio durch Bestechung, aber auch durch den immer noch großen Einfluss, den der Name seiner Familie besaß, auf seine Seite (u.a. Elbern, S.21). Damit zwang er Vetranio zum Rücktritt., was dieser am 25. Dezember in Naissus (Nis, Serbien) vor den beiden vereinten Heeren tat. Dafür wurde er von Constantius quasi in Pension nach Prusa in Bitynien geschickt.34
Im Frühjahr 351 begannen der Krieg. Magnentius rückte mit seinem Heer von Mailand über die Alpen, deren bewachte Pässe er einnahm, nach Pannonien vor.35 Vorher hatte er seinen Bruder Decentius zum Caesar ernannt und mit starken Verbänden mit der Sicherung der Rheingrenzen betraut. Ähnliches tat sein Gegenüber, der seinen 25-jährigen Vetter Gallus, der auch nach dem Blutbad von 337 unter Schutz von Constantius in Kappadokien lebte, zum Caesar ernannte und gegen die sich traditionell rührenden Perser im Osten schickte.
Im Laufe des Sommers gewann der Usurpator in Pannonien einige Kämpfe, so dass sich Constantius mit seinen Truppen nach Cibalae zurückzog. Durch den ungünstigen Verlauf der Gefechte beeinflusst unterbreitete Constantius dem Gegner ein Angebot, über dessen Wahrhaftigkeit spekuliert werden darf. Er bot Magnentius an, bei einem Rückzug die Herrschaft über Gallien behalten zu dürfen. Doch Magnentius lehnte ab, bzw. er stellte nun seinerseits überhöhte Forderungen.
Als Magnentius bei der Belagerung der Stadt Mursa (Osijek an der Drau) im September des Jahres in Schwierigkeiten geriet, war der Zeitpunkt für die entscheidende Schlacht gekommen. Constantius verlies die Stellung Cibalae, wo sein Vater rund dreißig Jahre vorher Licinus besiegt hatte, und bot Magnentius die Schlacht an.
Die Schlacht von Mursa fand am 28.9.351 statt. Laut Zonaras soll Magnentius 36000 Mann gegen Constantius ins Feld geführt haben, der durch seine vereinten pannonischen und östlichen Legionen mit ca. 80000 Mann seinen Gegner noch übertraf. Es gibt wenig Grund diese Zahlenangaben in Zweifel zu ziehen.36 Beide Heere hatten je einen ihrer Flügel an der Drau angelehnt, Constantius seinen rechten, Magnentius seinen linken. Das Gelände, die flache Ebenenlandschaft Pannoniens spielte Constantius in die Karten, der einen klaren Vorteil bei der Kavallerie hatte. Dies um so mehr, als im Zuge der vorigen Verhandlungen der spätere Usurpator, der Franke Silvanus mit seiner Kavallerieeinheit von Magnentius zu Constantius übergelaufen war.37 Gleichsam wusste Constantius, dass eine Flucht für sein Heer extrem verlustreich werden würde, da sich in seinem Rücken die Donau befand. Deswegen zögerte Constantius trotz der zahlenmäßigen Übermacht und überließ Magnentius das Heft des Handelns. Dieser begann am späten Nachmittag die Schlacht, die sich zur blutigsten dieses Jahrhunderts entwickeln sollte.
Dies geschah nach Bleckmann38 in zwei Phasen. Zuerst entschied die Kavallerie von Constantius quasi die Schlacht, indem sie vom linken Flügel aus die Armee des Kontrahenten umfasste und auseinander trieb. Diese verlor daraufhin, die Ordnung und floh. In der zweiten Phase formierten sich die Kerntruppen (Germanen und Kelten) des Magnentius neu und führten, die Drau im Rücken, einen erbitterten Kampf. Erst Constantius schwerer gepanzerter Reiterei gelang es, die Reihen entgültig zu durchbrechen und die verbliebenen Kämpfer des Magnentius, der frühzeitig die Flucht ergriffen hatte, aufzureiben.
Es gehörte lange Zeit zu einem feststehenden Teil der Überlieferung, das sich auch bei den meisten Historikern gehalten hat,39 dass Constantius selbst an der Schlacht nicht teilgenommen hat, sondern die Zeit betender Weise in einer Kapelle vor den Toren Mursas verbrachte. Das ist allerdings eher ein Verhalten, wie es zu einem Kaiser frühbyzantinischer Prägung passen würde. Vielmehr ist durch Julian an dieser, aber vor allem auch an anderen Stellen ein aktives Mitwirken des Kaisers bezeugt. So ist eher von einer aktiven Beteiligung des Constantius auszugehen, der seinerseits auch entscheidenden Anteil an der Schlachttaktik hatte. Das Bild des zagenden schwachen Kaisers ist als Verfemung der orthodoxen Überlieferung (insbesondere Sulpicius Severus) herauszustellen.40
Am Ende stand ein Sieg für den Augustus, aber es war ein teuer erkaufter Sieg. Insgesamt sollen 54000 Mann gefallen sein, davon ca. 30000 auf der Seite des Siegers. E.D. Hunt bezeichnet die Schlacht folgendermaßen: „Mursa become renowned as an epic encounter, one of the great conflicts of the age.”41 Die furchtbaren Verluste und ihr Einfluss auf das spätrömische Reich sind Thema von Kapitel III.
Die Frage nach den Gründen für den Sieg Constantius lässt sich relativ einhellig klären. Alle Autoren führen die Überlegenheit, besonders die der gepanzerten, Kavallerie des Constantius ins Feld.42 Weitere Faktoren waren sicherlich auch die allgemeine zahlenmäßige Überlegenheit der Truppen, sowie die hervorragend ausgebildeten und teilweise berittenen Bogenschützen.43
Zusammengefasst gewann Constantius die kriegsentscheidende Schlacht durch sein zahlenmäßig und an Kavallerie weit überlegenes Heer, das seien Vorteil in diesem Schlachtgelände optimal entfalten konnte. Dass hieraus aber keine allgemeine Überlegenheit der östlichen Legionen abzuleiten ist, wie Egon Flaig sie anführt,44 geben die höheren Verluste auf Seiten Constantius, hervorgerufen wahrscheinlich durch den erbitterten Kampf der Gegner, wieder.
II.2.3 Das Ende des Magnentius
Constantius hatte vor den Toren Mursas einen entscheidenden, wenn auch teuer erkauften Sieg errungen. Dennoch gelang es Magnentius sich noch einige Zeit zu halten. Dieser war schon während der Schlacht geflüchtet und nach Aquileia entkommen.45
Constantius aber setzte nicht entschlossen nach, sondern nutzte die Zeit um seine Verbände neu zu ordnen und die Flüchtlinge, die per Schiff aus Italien zu ihm kamen aufzunehmen. Der Augustus verbrachte den Winter in Sirmium (Sjiremska Mitrovica), von wo aus er Gesandtschaften des Magnentius abwies und einen Teil der Verbündeten seines Gegners, auch mit dem Versprechen der Amnestie, auf seine Seite zog.
Magnentius, der selber vergeblich versuchte ein neues Heer aufzustellen, wiegte sich in Sicherheit, da er die Pässe der julischen Alpen sperrte. Doch mit List und Geschick erzwang sich Constantius den Einlass nach Italien , ein kleines Heer, was sich im in den Pässen entgegen stellte, zwang er zur kampflosen Kapitulation. Als Magnentius diese Nachrichten erhielt, floh er aus Aquileia nach Gallien. Dabei gelang es ihm bei Ticinum in Norditalien sogar, der ihn unvorsichtig verfolgenden Vorhut des Constantius eine Niederlage beizubringen.46
Den Rest des Jahres 352 verbrachte Constantius damit Italien und die Provinzen Africa und Spanien wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Den Winter über residierte der Augustus in Mailand.
Von Gallien aus, wo er sich noch einer Zustimmung sicher sein konnte, startete Magnentius wohl einen letzten Versuch die drohende Gefahr abzuwenden. Er sendete einen Mörder gegen Caesar Gallus nach Antiochia, der aber ergriffen wurde (Zonaras XIII 8, Ammianus Marcellinus XIV 7,4). Dadurch hatte sich der Usurpator erhofft, wieder Unruhe in den Ostteil des Reiches zu bringen und damit Constantius zu nötigen, die Grenze gegen die Perser neu abzusichern. Über diplomatische Kontakte zwischen Magnentius und König Shapur von Persien, die in Anbetracht von Magnentius Gesandtschaft zu Athanasios nach Alexandria durchaus möglich gewesen sein können, wird spekuliert.
Das folgende Jahr brachte die entgültige Entscheidung des Bürgerkrieges und das Ende des Usurpators. Dieser hatte versucht den vorrückenden Augustus an den cottischen Alpen aufzuhalten. Dort wurde er aber im ein letztes Mal entscheidend besiegt (am Mons Seleucus, in der Nähe des heutigen Gap in Frankreich). Der geschlagene Usurpator zog sich nach Lugdunum (Lyon) zurück. Eine Vereinigung mit seinem Caesar Decentius, der eine schwere Niederlage gegen die ins Reich einfallenden Alamannen47 hingenommen hatte, scheiterte. Diesem Decentius verschloss die Stadt Trier, die Münzprägestätte des Magnentius, die Tore und schlug sich auf die Seite des Kaisers.
Am 10. August des Jahres wurde Magnentius gewahr, dass seine verbliebenen Soldaten, um sich selbst zu retten, seine Auslieferung planten. Daraufhin tötete seine anwesenden Freunde und Familie und anschließend sich selbst. Decentius, der davon ungefähr bei Verdun erfahren hatte, tat es ihm nach.
Damit endete die Usurpation und der Bürgerkrieg, was folgte, waren die Strafgerichte des Siegers. Trotz der versprochenen Amnestie ließ der argwöhnisch gewordene Constantius in der Folgezeit viele Leute hinrichten oder gefangen nehmen und deren Vermögen einziehen. Nach Ammianus Marcellinus geschah dies im besonderen Masse in Britannien, der Heimat des Vaters des Usurpatoren.48
Ein Fazit über die Rolle des Usurpatoren Magnentius zu ziehen ist nicht leicht. Wie schon vorher erwähnt, geben die Quellen ein verzerrtes Bild von ihm ab. Seine Usurpation trägt für diese Zeit absolut typische Züge, wie die allgemeine Unzufriedenheit mit einem regierenden Herrscher, seine Herkunft aus dem Militär etc..49 Seine Usurpation selbst war ein weiterer Meilenstein in einer zerrütteten Zeit, in der jede Generation mindestens einen Bürgerkrieg mitzuerleben hatte.50
Wie entscheidend der Bürgerkrieg und vor allem die Schlacht von Mursa mit ihren gewaltigen Verlusten für die Destabilisierung des Heeres und des Reichs nach außen war, wird im nächsten Kapitel beleuchtet. Auf jeden Fall sorgte die Erhebung des Magnentius und ihre Folgen in nicht unerheblichen Maß zu einer Destabilisierung des Reichs im Inneren, wenn auch nur auf den westlichen Teil des Reiches beschränkt.
Die Erhebung besiegelte das Ende der konstantinischen Dynastie,51 vor allem natürlich auch deshalb, weil Constantius kinderlos blieb. Gleichzeitig hatte sie schlimme Folgen für das wirtschaftliche Gleichgewicht und die Gesellschaft im Westteil des Reiches. Durch die Usurpation des Magnentius verstärkte sich noch der ihm von vielen Quellen vorgehaltene Argwohn und das Misstrauen von Constantius. Die Folge waren die blutigen und umfassenden Strafgerichte im Westen, die zusätzlich zu den Belastungen des Bürgerkriegs direkt und der schwierigen Lage an der Rheingrenze (siehe II.3) diesen Teil des Reiches in eine schwere Krise führte. Denn da die Soldaten sahen, dass die ausgelobte Amnestie nicht stattfand, zogen viele es vor, sich nicht zu stellen und lieber als Räuberbanden das Land unsicher zu machen. Diesen Zustand beendete erst Julian, der sie wieder in seine Truppen eingliederte.52
II.3 Die Schlacht von Mursa und ihre Bedeutung für die spätrömisch e Militärgeschichte
Die Schlacht, die am 29.8. vor den Toren der Stadt Mursa stattfand, war die verlustreichste Schlacht im 4. Jahrhundert nach Christus. Die Zahl der Gefallenen betrug 54000 Mann, dieser Angabe, die auf Zonaras beruht,53 können wir Glauben schenken. Dies hat schon die Zeitgenossen beeinflusst, die in dieser Schlacht einen historischen Wendepunkt sahen. Nur die kaiserlich-propagandistische Überlieferung54 erwähnt die Verluste und ihre Schrecklichkeit nirgends55. Hier wird von einem glanzvollen Sieg gesprochen, der sogar gegen einen auswärtigen Feind errungen wurde. Dieses Bild lässt auch klar werden, warum den besagten Quellen die germanisch-barbarische Herkunft des Magnentius so wichtig ist. Für sie ist es ein glanzvoller Sieg des rechtmäßigen Kaisers, der zwar zu einem Teil durch Gott errungen wurde, dessen Hauptgrund aber die Tüchtigkeit von den Truppen und des Augustus war.56
Das Echo in den profanen Geschichtsquellen ist jedoch ein eindeutig anderes.57 Zosimos spricht von großen Verlusten und gibt der Schlacht einen epochalen Charakter (Zos. II 50,4), Eutrop bedauert die Aufzehrung gewaltiger Kräfte, die gegen äußere Feinde hätten verwendet werden können (Eutropius, Breviarum, 10 12,1). Noch eingehender werden die Epitome de Caesaribus, die Mursa als epochales Ereignis betrachteten, dass das Glück des Imperiums veränderte (Epit.Cae. 42,4). Abschließend fasst Orosius die Geschehnisse wohl mit Blick auf seine eigene Zeit zusammen, indem er sagt: „Es folgte jener grauenhafte Krieg, der zwischen Constantius und Magnentius bei der Schlacht von Mursa geschlagen wurde und in dem die große Verschwendung römischer Kräfte sogar bis in die nachfolgenden Generationen schädlich war.“58
Dieser Ansicht, dass Mursa für eine nachhaltige Schwächung der römischen Streitkräfte gesorgt hat und somit als Schritt hin zum Untergang des weströmischen Reichs zu sehen ist, haben sich viele der modernen Autoren angeschlossen.59 Die gewaltigen Verluste betont auch Dietrich Hoffmann, der in ihnen auch einen Grund dafür sieht, dass die Heeresstärke, mit der Julian vor Strassburg die Alamannen bekämpfte, recht gering gewesen sei.60 Als Quintessenz mag vielleicht die Aussage von Otto Seeck zu den Konsequenzen der Schlacht von Mursa dienen: „Wer aber durch diese Schlacht am meisten gewonnen hatte, das waren die Barbaren, die rings der Grenzen lauerten. Denn mochte es seit den Zeiten Diokletians auch stark vermehrt sein, so blieb das Reichsheer doch schwach genug, dass ein Verlust von 54000 seiner besten Krieger , ganz abgesehen von denen, welche schon in früheren Kämpfen gefallen waren, seine Schlagfertigkeit sehr ernstlich gefährdete.“61
Diese Schwächung der römischen Wehrkraft und vor allem ihre Langzeitwirkung bedürfen einer eingehenderen Untersuchung. Es ist festzustellen, dass es in Folge der Schlacht von Mursa kein Verschwinden von Truppenteilen gab. Alle Truppen und Einheiten, die für Magnentius in die Schlacht zogen, sind später wieder nachweisbar.62
Es muss den Römern gelungen sein, die Lücken nach einer Zeit wieder aufzufüllen. Auch wenn das Komplettieren der Reihen länger dauert haben mag,63 besteht die Frage, wie und womit diese Auffüllung geschah. D.h., kam es zu Umstrukturierungen im Heer, die die Zusammensetzung vielleicht nachhaltig veränderten, bzw. aus welchem Reservoir schöpfte das römische Heer die Kräfte hierfür ?
Wenn man nach möglichen Umstrukturierungen als Antwort auf die schweren Verluste sucht, so erscheint es als möglich, in den ab der Mitte des 4. Jahrhunderts auftretenden Doppeltruppen, die Martijn Nicasie in seiner Arbeit betrachtet64, eine mögliche Lösung zu sehen. Diese Seniores-iuniores-Einheiten könnten als zwei Einheiten, die mit verminderter Stärke aus einer ursprünglichen Einheit hervorgegangen waren, durchaus ein Mittel sein, die enormen Verluste durch Splitting aufzufangen bzw. zu mindern.65 Der genaue Zeitpunkt für diese Teilung der Einheiten ist nicht genau festzulegen. Er kann schwerlich nach 356 stattgefunden haben.66 Aufgrund der vielen Probleme, die eine solche große Reform des Heeres bereitet, kann sie nur in einer Zeit politischer Stabilität stattgefunden haben. Die Zeit nach Mursa käme dafür vielleicht in Betracht, ebenso so wie die Zeitpunkte 337 oder 340, die als eine Teilung in Folge der Reichsteilungen der Brüder zu sehen wären. Als Summe der Überlegungen bleibt schlussendlich bedauerlicherweise bestehen, dass die Vermutung, in der Aushebung der Doppeltruppen eine direkte Reaktion auf die Verluste von Mursa zu sehen, nicht zu beweisen ist.67
Weiterhin stellt sich die Frage nach den Rekrutierungen. Der Verlust von 54000 Soldaten lässt sich durch eine Heeresteilung allein nicht ausgleichen, zumal, wie Nicasie zu Recht anführt, so eine Teilung selber auch den Bedarf nach neuen Rekruten steigen lassen würde.68 Woher kamen also diese neuen Kräfte?
Man kann davon ausgehen, dass das große römische Reich immer noch über ein so gewaltiges Rekrutierungspotential verfügt. Die Verluste könnten in einer ähnlichen Form ausgeglichen worden sein, wie dies zur Zeit Konstantins des Großen praktiziert wurde, bei dessen Bürgerkriegen die Anzahl der Verluste insgesamt in ähnlichen Bereichen lag.69 Es ist dabei anzunehmen, dass dieses Reservoir an neuen Rekruten nicht hauptsächlich im Kernrekrutierungsgebiet Illyrien - immerhin Schauplatz der Schlacht, mit Beteiligung der illyrischen Armeen - lag, sondern außerhalb der Grenzen des Reichs. Dietrich Hoffmann stellt die nicht gänzlich von der Hand zu weisende These auf, dass die Auffüllung der Kontingente durch „die diensteifrigen Barbaren“ jenseits des Rheins erfolgte.70
Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, dass die gewaltigen Verluste von Mursa das römische Reich und sein Heer vor große Probleme stellten und kurzfristig mit Sicherheit zu einer Schwächung des selben führten Dennoch gelang es, die Lücken wieder aufzufüllen. Da eine Reform unmittelbar im Anschluss an Mursa nicht zu beweisen ist, muss davon ausgegangen werden, dass ein großangelegtes Ausheben von neuen Rekruten erfolgte. Dabei wird ein nicht unwichtiger Teil der neuen Rekruten außerhalb der Grenzen angeworben worden sein.
Zu einer übermäßigen Germanisierung bzw. Barbarisierung mit negativen Folgen ist es aber wohl nicht gekommen. Der Anteil von Germanen im römischen Heer ist vor allem im dritten Jahrhundert sprunghaft angestiegen. Zur Zeit des Bürgerkrieges und in dessen Folge war der Anteil an Germanen im Heer durchaus hoch. Allerdings waren die germanischen Krieger loyal, außerdem besaßen sie kein nationales „Wir- Gefühl“. Die moralische und kulturelle Überlegenheit Roms hatte immer noch eindeutig den Vorrang.71 Zu einem Problem wurde die Barbarisierung erst ab Theodosius. Auch wäre es nicht legitim, in den Folgen von Mursa und der daraus resultierenden starken Rekrutierung auswärtiger Männer eine Basis für die Entwicklung des germanischen, Staat und Politik anstelle des Kaisers machenden Heerführertyps wie Ricimer oder Stilicho zu sehen.72
Die Teilung des Heeres als Folge von Mursa ist nicht nachweisbar, ein verstärktes Hinwenden zur Kavallerie hingegen schon. Wie vorher schon herausgearbeitet entschied vor allem die Reiterei auf Seiten von Constantius die Schlacht. Das Mittel der schweren Kavallerie, d.h. gepanzerte Männer auf gepanzerten Pferden, hatte Constantius aus dem Osten mitgebracht, wo unter anderem seine Gegner, die Perser, dies einsetzten. Julian beschreibt die Wirkungsweise dieser „tanks of antiquity“73: „Die Schlacht blieb unentschieden, bis die Panzerreiter und die restlichen Reitertruppen eingriffen. Die einen töteten viele durch Pfeilschüsse, die anderen, indem sie im Galopp die Feinde niederritten.“(Iul. Or. 1,36 d). Die Anzahl dieser Reitereinheiten (cataphracti und clibanarii) stieg in der Regierungszeit von Constantius merklich an.74 Wahrscheinlich hatte er aus seinen Erfahrungen in den Perserkriegen schon diesen Truppenanteil verstärkt, die Erfahrung von Mursa dürfte aber erst recht zu einer noch stärkeren Hinwendung geführt haben.
Allerdings ist die schwere Reiterei mit Vorsicht zu genießen. Hoffmann sieht in ihrem Anstieg nur den für die Spätrömer typischen Reiz des Neuen, also eine Art Modetrend. Das mag überzogen sein, doch zu Recht stellt er fest, dass die Schlagkraft und militärische Effizienz dieser Einheiten geringer einzuschätzen ist, als es der erste Blick vermuten läßt. Anhand mehrerer Schlachtbeispiele ersieht man, dass eine gut ausgebildete Armee gegen diese Reiter nicht nur bestehen konnte, sondern dass die unbeweglichen Kavallerieeinheiten sogar unterlegen waren, wenn ihr Aufprall aufgefangen wurde oder ins Leere lief.75 Also muss hinter der Effizienz dieses Kriegsmittels ein Fragezeichen gesetzt werden, auf jeden Fall stieg trotzdem dessen Bedeutung in Folge von Mursa rapide an. Eventuell kann man sich sogar der Meinung Martijn Nicasies anschließen, der in der römischen schweren Kavallerie einen ersten Schritt auf dem Weg sieht, der bei den Rittern des Mittelalters endet.76
Wenngleich die Stärke des spätrömischen Heeres durch verschiedene Anstrengungen nachhaltig nicht durch Mursa abnahm, so ist bei allen Bemühungen dennoch von einer kurzfristigen Schwächung auszugehen. Für die äußere Stabilität des Reiches erwies es sich als fatal, dass viele der gallischen Truppen in den Krieg verwickelt wurden. So kam es schon während des Bürgerkrieges zu einem Eindringen der Alamannen und anderer germanischer Stämme auf römischen Boden. Wie schon erwähnt musste Decentius gegen Sie eine Niederlage einstecken. Feststeht, dass die Alamannen nicht allein aus eigenem Antrieb ins Reich eindrangen, sondern, dass sie gerufen wurden und dafür sogar Bezahlung erhielten. Es ist wahrscheinlich, dass Constantius sie rief, um seinen Gegner zu schwächen.77 Die aus dem Bürgerkrieg resultierende vorübergehende Schwächung des Heeres bedingte sicherlich auch, dass die Aggressoren erst entgültig zwischen 357-359 zurückgeschlagen werden konnten. Bis dahin hatten sie aber in diesem Teil des Reiches schlimme Verwüstungen hinterlassen. Es gelang ihnen nicht nur die heutige Stadt Köln einzunehmen, sie zerstörten das gesamte System des römischen Rheingrenzschutzes so gründlich, dass Dietrich Hoffmann von „tabula rasa“ spricht.78 Zumindest für diesen Teil des Reiches bedeuteten die Folgen des Krieges und der Schlacht eine tiefe Zäsur.
III . Schlussfolgerung
Die Usurpation des Magnentius von 350-353 war ein wichtiger Punkt bei der Beendigung der konstantinischen Dynastie. Sie niederzuschlagen bedeutete für den rechtmäßigen Augustus gewaltige Anstrengungen und forderte viel Blutvergießen. Die Entscheidung fiel am 28.9.351 auf dem Schlachtfeld von Mursa, wo ca. 54000 Soldaten auf beiden Seiten ihr Leben ließen. Das Ausmaß dieser Katastrophe hat viele, sowohl die bürgerkriegsgewohnten Zeitgenossen, als auch viele Historiker (moderne und antike), dazu verleitet, diese Schlacht als eine große Zäsur im vierten Jahrhundert nach Christus zu erachten.
Dabei muss man die unterschiedlichen Intentionen der Autoren berücksichtigen. Schreiber im Sinne einer imperialen Propaganda feierten einen großen Sieg und hatten kaum ein Auge für die Verluste und ihre Bedeutung für das Reich. Kirchlichen Autoren war die Schlacht je nach Lager ein willkommenes Mittel im Streit zwischen Arianismus und Orthodoxie. Die eigentliche Trauer und die (An)klage über die immensen Verluste stammen hauptsächlich von Autoren aus dem profangeschichtlichen Bereich, die teilweise auch über das Wissen über die folgenden hundert Jahre verfügten. Sie prangern die Geschehnisse an und ziehen aus ihnen eine direkte Verbindung zum Niedergang des weströmischen Reiches. Tatsache ist, dass zu dieser Zeit das römische Reich aufgrund seiner Ressourcen noch in der Lage war, die Verluste wieder auszugleichen. Wenngleich dies auch etwas Zeit in Anspruch nahm und zumindest zu einer kurzfristigen Schwächung führte.
Diese kurzfristige Schwächung im Verbund mit von dem von nun an vollends misstrauisch gewordenen Augustus Constantius einberufenen Strafgerichten bedeutete für einen Teil des Reiches, nämlich seinen nordwestlichen einen tiefen Einschnitt.
Alleingenommen darf man die Ereignisse dieser vier Jahre sicher nicht als Grund für den Niedergang im Westen anführen. Zusammen mit sämtlichen Bürgerkriegen, die das Reich in diesem Zeitalter erschütterten und den immensen Kosten und Mühen, die deren Bewältigung jedes Mal in Anspruch nahm, sowie den fatalen Schwächungen in der Infrastruktur, sind die Erhebung des Magnentius und die Schlacht von Mursa nicht zu gering zu bewertende Abschnitte auf dem Weg, der in den Niedergang der westlichen Hälfte des Reiches mündete.
III. Literaturverzeichnis
Timothy Barnes, Athanasius and Constantius, London, 1993
Bruno Bleckmann, Die Schlacht von Mursa und die zeitgenössische Deutung eines spätantiken Bürgerkrieges, in: Hartwin Brandt (Hrsg.), Gedeutete Realität, Historia Einzelschriften, Heft 134 Stuttgart 1999
John F. Drinkwater, The Revolt and Ethic Origin of the Usurper Magnentius (350-353) and the Rebellion of Vetranio, in Chiron 30, 2000
Stephan Elbern, Usurpationen im spätrömischen Reich, Bonn 1984 Walter Ensslin, Constantius II, in: RE IV, 1925
Walter Ensslin, Magnentius I, in: RE XIV, 1928
Egon Flaig, Für eine Konzeptionalisierung der Usurpation im spätrömischen Reich, in: E.Pashoud. J. Szidat, Usurpationen in der Spätantike, Stuttgart 1997
Dietrich Hoffmann, Das spätrömische Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum, Rheinlandverlag Düsseldorf 1969, Bd. 2
E.D. Hunt, The Successors of Constantine, in : Cambridge Ancient History XIII, Cambridge 1998
M.J. Nicasie, Twilight of Empire. The Roman Army fronm the Reign of Diocletian until the Battle of Adrianopel, Amsterdam 1998
Otto Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, Bd.4, Stuttgart 1922 Pat Southern. Karen Ramsey Dixon, The Late Roman Army, London 1996 Konrad Vössing, Flavus Magnus Magnentius, Düsseldorf 2000
[...]
1 Bruno Bleckmann, Die Schlacht von Mursa und die zeitgenössische Deutung eines spätantiken Bürgerkrieges, in: Hartwin Brandt (Hrsg.), Gedeutete Realität, Historia Einzelschriften, Heft 134 Stuttgart 1999, Seiten 47-101, hier S. 47,48
2 Julian, Origines, 1, 34
3 siehe hierzu: Timothy Barnes, Athanasius and Constantius, London, 1993
4 Dazu und zu der Unterscheidung orthodox-arianisch: Bleckmann, S. 58-68
5 W.Whinston, An historical preface to primitive christianity reviv’d, London, 1711 in Barnes, Einband
6 siehe hierzu auch Abschnitt II.2.2
7 für den Abschnitt: Bleckmann, S. 68-74
8 Eunapios aus Sardes, 345/46- ca.420 war Platoniker und Redner. Verfasste ein Geschichtswerk das die Zeit von 270-404 beschreibt. Zeigt stark gegenchristliche Tendenzen.
9 Für Zosimos siehe: Bleckmann, S. 75 f.; für Zonaras: ebd. S.77-80; für beide im Vergleich: ebd. S.81 ff.
10 Stephan Elbern, Usurpationen im spätrömischen Reich, Bonn 1984, Seite 105 f.
11 dazu siehe Abschnitt II.2.1
12 ebd.
13 Zosimos, II 40,3
14 so z.B. von Julian I,17, der als Überlebender später unter Constantius Schutz stand und in Kappadokien in einer Art ehrenvoller Gefangenschaft lebte
15 Themistios, Orationes, 3.43a
16 Zosimos, II. 54,1
17 Schol. Ad Jul. Orat. 2.95C
18 so u.a. auch bei Konrad Vössing, Flavus Magnus Magnentius, Düsseldorf 2000
19 John F. Drinkwater, The Revolt and Ethic Origin of the Usurper Magnentius (350-353) and the Rebellion of Vetranio, in Chiron 30, 2000, S. 138-144
20 Pat Southern. Karen Ramsey Dixon, The Late Roman Army, London 1996, S.48
21 Vössing, S.3
22 Elbern, S. 102 f.
23 u.a. Vössing, S.3, bzw. Ausführlich Barnes, S. 101-109
24 Elbern, S. 42 mit Angabe aller Quellen 27-jährigen Constans am Fuße der
25 Drinkwater beweist eingehend, das dieses Verhalten dazu dienen sollte, zu beweisen, dass Magnentius im Vergleich zum verweichlichten, auch in seiner letzten Chance versagenden Constans die bessere Alternative, „the fitter emperor“war. S.135-137
26 Für den folgenden Abschnitt: Drinkwater, S.132-135
27 E.D. Hunt, The Successors of Constantine, in : Cambridge Ancient History XIII, Cambridge 1998, S. 15
28 Elbern, S.20,50
29 Julian,Or.,11.58 c-d
30 Otto Seeck schreibt in seinem Werk, dass das Geld zum Anwerben der freien Germanen verwendet wurde. Otto Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, Bd.4, Stuttgart 1922, S.108
31 Vössing, S.2
32 Walter Ensslin, Constantius II, in: RE IV, 1925, S.1063
33 Walter Ensslin, Magnentius I, in: RE XIV, 1928, S.448. Stefan Elbern führt an, dass Vetranio nur mit Magnentius in Verhandlungen trat, weil er keinen Krieg wollte und von Constantius noch keine Hilfe bekam. So ist dieses Bündnis auch als Finte gegen Magnentius zu sehen (Elbern, S.50)
34 Die Rolle des Vetranio, der noch sechs Jahre komfortabel in Prusa lebte, ist unklar. Es wäre falsch ihn als richtigen Usurpator anzusehen. Schließlich bezeugen die Quellen einheitlich, dass er von Constantina, die als Augusta dazu sogar eine Berechtigung hatte (Philostorg, HE III 22), zu dieser Tat gedrängt wurde. Als erfahrener Heermeister wird er gewusst haben, dass seine Männer loyal zum Haus Konstantins standen. E.D.Hunt hat die Rolle des Vetranio treffend skizziert: „ Vetranio hardly deservers the label of ‚usurper`at all: for most of his nine-month duration his rule has serveed as a convenient instrument of the dynasty, holding Magnentius at bay until the real conflict could begin.”(S.17)
35 zum Heer des Magnentius siehe Anmerkung 2
36 Dietrich Hoffmann, Das spätrömische Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum, Rheinlandverlag Düsseldorf 1969, Bd. 2, S.209
37 Egon Flaig gibt als Grund Loyalität an, die Silvanus dem Haus Konstantins schuldete, da sein Vater diesem viel zu verdanken hatte. Egon Flaig, Für eine Konzeptionalisierung der Usurpation im spätrömischen Reich, in: E.Pashoud. J. Szidat, Usurpationen in der Spätantike, Stuttgart1997, S.63
38 Bleckmann, S.48. Er bezieht sich hier auf einen für mich leider nicht erhältlichen Artikel, nämlich auf: J. Sasel, The Struggle between Magnentius and Constantius II for Italy and Illyricum 1971, in Opera Selecta, Ljuubljana 1992, S. 716-727
39 So u.a. bei Seeck, S. 113 f.
40 hierzu: Bleckmann, S.63-65
41 Hunt, S.20
42 so u.a. Vössing S.2; Seeck, S.112; Hunt S.20, Bleckmann S.48
43 Seeck, S.112
44 Flaig, S.28
45 zur Art und Weise der Flucht und ihrer legendenhaften Beschreibung, siehe Bleckmann, S.80
46 zu diesem Abschnitt: Ensslin, Magnentius, S.451
47 siehe hierzu Kapitel II.3
48 Ammianus Marcellinus, Res gestae, 14,5 6-8
49 siehe die Arbeit von Stefan Elbern
50 Was auch ein Grund dafür ist, dass das Werk von Aurelius Victor auch bekannt als „Die Geschichte der Bürgerkriege“ ist.
51 u.a. Vössing, S.2
52 Ensslin, S.1065
53 Zonaras, XIII, 8.17
54 siehe Kapitel I
55 siehe: Bleckmann, S. 52,54,84,92
56 Bleckmann, S.66
57 siehe Bleckmann, S.92
58 Orosius, 7. 29,12 zitiert aus Bleckmann, S.92
59 so z.B. Hunt S.20; Vössing, S.2; Ensslin S.1065
60 Hoffmann, S.201,202
61 Seeck, S.113
62 Hoffmann, S.206
63 Hoffmann, S.467
64 M.J. Nicasie, Twilight of Empire. The Roman Army fronm the Reign of Diocletian until the Battle of Adrianopel, Amsterdam 1998
65 Nicasie, S.27 Der Autor bezieht sich hier auf einen Artikel von R.Scharf, Seniores-iuniores und die Heeresteilung des Jahres 364, ZPE 89, 1991.
66 Nicasie, S.26
67 Nicasie, S.33
68 Nicasie , S.31,32
69 Bleckmann, S.93
70 Hoffmann, S.204
71 Southern. Dixon, S.50,51
72 zu diesem Typus, Flaig, S.21,22
73 Nicasie, S.197
74 ebd.
75 Hoffmann, S.271
76 Nicasie, S.198
77 u.a. Vössing, Ensslin; demgegenüber Drinkwater, der auf Seite 142 Magnentius selbst als Urheber sieht
Häufig gestellte Fragen zum Inhaltsangabe
Worum geht es in dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich mit der Usurpation des Magnentius, die im Januar 350 n. Chr. begann und mit dessen Suizid im August 353 endete. Ein zentrales Ereignis war die Schlacht von Mursa im Jahr 351, die als bedeutend für die spätrömische Militärgeschichte gilt.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit rekonstruiert den Verlauf der Ereignisse bis zur Schlacht von Mursa, schildert den Schlachtverlauf und erläutert die Ereignisse bis zum Ende der Usurpation. Hauptaugenmerk liegt auf der Bedeutung der Schlacht und des Bürgerkrieges für den Untergang des weströmischen Reiches.
Welche antiken Quellen werden verwendet?
Die Arbeit greift auf eine Vielzahl antiker Quellen zurück, darunter die Schriften des Kaisers Julian, Themistios, Aurelius Victor, christliche Geschichtsschreiber wie Sulpicius Severus, und Autoren aus dem senatorisch-heidnischen Milieu Roms wie Zosimos und Zonaras. Auch archäologische Quellen wie die Kaiservilla von Centcelles und numismatische Funde werden berücksichtigt.
Wie wird Magnentius in den Quellen dargestellt?
Die Darstellung von Magnentius variiert je nach Quelle. In imperial-propagandistischen Schriften wird er negativ als barbarischer Aggressor dargestellt. Christliche Autoren brandmarken ihn als Heiden. Die senatorisch-heidnischen Quellen bieten eine differenziertere Sicht, während profan-historische Quellen wie Zosimos und Zonaras umfassende Bilder liefern.
Was waren die Ursachen für die Usurpation des Magnentius?
Die Usurpation wurde durch eine Verschwörung ziviler und militärischer Würdenträger ausgelöst. Constans, der regierende Kaiser, war unbeliebt, und Magnentius nutzte die allgemeine Unzufriedenheit aus, um sich zum Augustus ausrufen zu lassen.
Wie verlief der Bürgerkrieg zwischen Magnentius und Constantius II?
Magnentius konnte seine Macht im Westen des Reichs rasch ausbauen. Es kam zu Erhebungen und Kämpfen in verschiedenen Regionen. Der Höhepunkt war die Schlacht von Mursa, die Constantius gewann. Magnentius wurde schließlich besiegt und beging Suizid.
Welche Bedeutung hat die Schlacht von Mursa für die spätrömische Militärgeschichte?
Die Schlacht von Mursa war eine der verlustreichsten Schlachten des 4. Jahrhunderts. Sie führte zu einer Schwächung der römischen Streitkräfte und wird von einigen Historikern als ein Schritt zum Untergang des weströmischen Reiches gesehen. Insbesondere wird die Bedeutung des Krieges für die Destabilisierung des Heeres betont.
Wie wirkte sich die Schlacht von Mursa auf das römische Heer aus?
Die Schlacht führte zu gewaltigen Verlusten, die aber durch Rekrutierungen wieder ausgeglichen wurden. Es kam zu Umstrukturierungen im Heer, wie z.B. das Aufkommen von Doppeltruppen (Seniores-iuniores-Einheiten) und einer verstärkten Hinwendung zur Kavallerie. Man rekrutierte mehr außerhalb der Kernrekrutierungsgebiete, aber es gab keine übermässige Barbarisierung. Die Moralische Überlegenheit Roms hatte immer noch den Vorrang.
Welche Folgen hatte die Usurpation des Magnentius für das Römische Reich?
Die Usurpation besiegelte das Ende der konstantinischen Dynastie und hatte negative Folgen für das wirtschaftliche Gleichgewicht und die Gesellschaft im Westteil des Reiches. Constantius' Strafgerichte verstärkten die Krise zusätzlich.
War Mursa der Grund für den Untergang des Weströmischen Reichs?
Die Ereignisse um die Usurpation und die Schlacht von Mursa waren nicht der alleinige Grund für den Untergang des Weströmischen Reiches. Sie trugen jedoch zusammen mit anderen Faktoren, wie Bürgerkriegen und wirtschaftlichen Problemen, zur Destabilisierung des Reichs bei und spielten somit eine nicht zu unterschätzende Rolle auf dem Weg des Niedergangs.
- Quote paper
- Kai Landwehr (Author), 2002, Die Schlacht von Mursa, eine historische Zäsur?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/106722